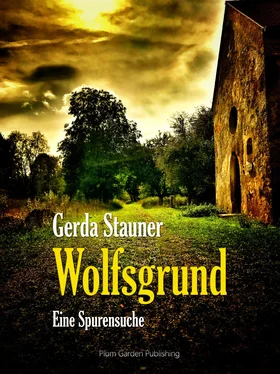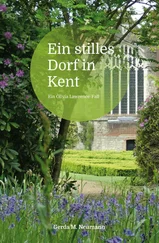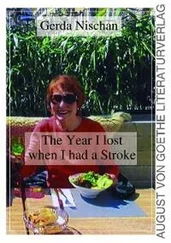Wenn sie sich jetzt nach links wenden würde, könnte sie einen Blick auf die Wirtschaft werfen, doch das traut sie sich nicht. Vielleicht würde sie Ludwig noch einmal sehen, aber ihr Blick bleibt weiterhin auf ihre Hände gerichtet, wohl wissend, dass sie andernfalls schluchzend zusammenbrechen würde. Agathe zählt langsam bis zehn und trocknet ihre Augen mit einem Baumwolltuch. Dann erst schaut sie wieder nach vorne. Gerade passieren sie die Schmiede, die nach der Brauerei den Gebäudekomplex der Wirtsfamilie vervollständigt. Sie denkt an den einzigen Brunnen im Ort, der direkt hinter dem Anwesen liegt und in diesem Spätsommer schon lange kein Wasser mehr vorhält. Als Kind saß sie oft auf dem gemauerten Rand und blickte in die undurchdringliche Dunkelheit hinunter, fest davon überzeugt, dass das Böse dort lauern würde.
Der Vater hebt hier und da die Hand zum Gruß und die Mutter lächelt eigentümlich, fast stolz. Dann haben sie endlich das Dorf hinter sich gelassen und biegen kurz darauf auf einen breiteren Weg ab. Aber schon nach dieser kurzen Strecke hat sich die staubige Erde in einer feinen Schicht auf ihre Aussteuer gelegt. Nach ihrer Ankunft wird sie erst einmal die Stühle, den Tisch, die große Truhe und das breite Bett reinigen und feucht abwischen müssen. Doch irgendwie ist es für die junge Frau ein Trost zu wissen, dass sie mit dem trockenen, braunen Staub auch etwas Heimat nach Fichtenried bringen wird.
Es fällt Melchior tatsächlich leicht, sich in die Zeit vor über 120 Jahren zurückzuversetzen, in die Vorstellungswelt und die Empfindungen der Menschen. Trotzdem ist es eine Gratwanderung für ihn. Er hat nur wenige Anhaltspunkte und echte Dokumente aus dieser Zeit. Alles, was mit und zwischen seinen Figuren geschieht, muss er neu erfinden. Es ist genau das Gegenteil dessen, was er als Journalist für seine Zeitung schreibt. Und genau daran liegt der Reiz für ihn. Zufrieden schaltet er spät am Abend den Computer aus. Für heute ist es genug, ein Anfang ist gemacht.
Er geht in die Küche, gießt sich den restlichen Rotwein vom Vortag in ein Glas und sucht im Kühlschrank nach etwas zu Essen. Mit einem Stück Käse, vier Cocktailtomaten und Toastbrot setzt er sich an den Esstisch. Akribisch teilt er die roten Paradiesäpfel und schneidet ausnahmsweise den Strunk nicht extra heraus. Melchior gibt ordentlich Salz dazu und steckt sich abwechselnd Käse und Tomaten in den Mund.
Er isst konzentriert und versucht an nichts anderes zu denken. Doch mit dem letzten Bissen Toastbrot und dem letzten Schluck Wein taucht die Erinnerung an das Gespräch mit seiner Redaktionsleiterin wieder auf.
„Undankbare Kuh“ ist der Ausdruck, mit dem er seiner Wut und der Enge in seiner Brust Luft macht. Doch er weiß ganz genau, dass seine junge Vorgesetzte nicht die Schuld an seinem Zwangsurlaub trägt. Sie war nur die Überbringerin der Botschaft. Melchior fragt sich, was er in seinem Berufsleben falsch gemacht hat. Er muss nicht lange überlegen, die Antwort kennt er. Schon immer fehlte ihm der Antrieb, sich mit anderen für Projekte oder gemeinsame Vorhaben zusammenzuschließen und ein sogenanntes Netzwerk zu bilden. Schon allein dieses Wort ist ihm zuwider. Teil eines solchen Netzwerkes zu sein, bringt ihm seiner Meinung nach keinen Vorteil. Er fühlt sich vielmehr darin gefangen und eingeengt. In den langen Jahren als Redakteur hatte er oft genug erlebt, wie ihn andere mühelos auf der Karriereleiter überholt haben, obwohl sie seiner Ansicht nach schlechtere Schreiber waren. Im Netzwerken lag hingegen ihre Stärke.
Was ihm half, war seine Fähigkeit, den Überblick zu bewahren. Gerade in hektischen Situationen, wenn eine unerwartete Nachricht über die Redaktion hereinbrach und es sich dort plötzlich anfühlte, als sei man in einen Bienenstock geraten, blieb er kühl, versuchte schnellstmöglich an gesicherte Informationen zu kommen und sich nicht an den Spekulationen der anderen zu beteiligen. Er arbeitete für sich, effektiv, präzise und war stets verbindlich. Vielleicht kostete ihn dieses Voranpreschen im Alleingang Kraft und Lebensenergie, die er dann für andere Dinge nicht mehr übrig hatte? Trotz aller Anstrengung blieb ihm eine Position als Ressortleiter verwehrt. Wollte er solch einen Posten wirklich haben oder ging es hier nur um sein Prestige, um Anerkennung?
Melchior steht energisch auf, stellt das benutzte Geschirr auf die Küchenablage und geht zu Bett. Für heute hat er mehr als genug gegrübelt. Luxusproblem einer Wohlstandsgesellschaft, das ist wohl der richtige Ausdruck für das, was in seinem Kopf vorgeht. Er denkt an Agathe und daran, was wohl in Fichtenried auf sie wartete, und ob sie Ludwig wiedersehen würde? Müde zieht er die Daunendecke mit dem verschlissenen, karierten Baumwollbezug bis zum Kinn hoch. Die Geschichte um die unglückliche Liebe und um Schmidheim nimmt in seinem Kopf weiter Gestalt an, während er träge die Augen schließt.
Das vertraute Läuten der Kirchenglocken hallt Agathe schon entgegen, bevor der kleine Ort eine viertel Stunde später vor ihr auftaucht. Mit wenigen Minuten Verspätung schlüpft sie in die Kapelle und entflieht somit der Hitze, die sich schon früh an diesem Julisonntag über die Gegend gelegt hat. Den zweijährigen Donatus hält sie an der einen Hand, den Säugling Anderl wiegt sie sanft im anderen Arm. Die junge Mutter ist froh, sich im hinteren Teil auf einer Bank ausruhen zu können. Eigentlich wollte sie die Kinder bei ihrer Mutter in Oberschmidheim lassen, doch dann hätte sie einen Umweg machen müssen und wäre nicht rechtzeitig zur Messe erschienen. Der eigentliche Grund aber war das Wiedersehen mit Ludwig. Um nichts in der Welt hätte sie dieses noch länger hinausschieben mögen.
Ihre beiden Kinder sind erschöpft von der langen Anreise, schon vor dem Morgengrauen hatten sie sich auf den Weg zum Bahnhof gemacht, um mit dem Zug bis zur nächsten Station zu fahren. Von dort aus konnten sie bei einem Kutscher aufsitzen und ein gutes Stück mit ihm fahren, die letzten vier Kilometer mussten sie jedoch zu Fuß gehen. Keine zehn Minuten nach ihrer Ankunft schlafen beide friedlich, Donatus auf der Kirchenbank, Anderl als Bündel in ihrem Arm.
Agathe blickt sich verstohlen um. Erst als sich die Gemeinde zum Gebet hinkniet, erkennt sie den braungebrannten Nacken und die sonnengebleichten Haare von Ludwig, der in diesem Moment seinen Kopf zur Seite dreht. Ein Schlag durchzuckt ihren Körper und für einen Moment ist sie davon überzeugt, dass der Herrgott sie für ihre sündigen Gedanken mit einem Herzanfall strafen wird. Doch nichts passiert, ihr Pulsschlag wird wieder ruhiger und ihre Atmung normalisiert sich.
Um sich abzulenken und nicht immer auf den sehnigen, verführerischen Hals zu starren, lehnt sie sich zurück und schließt die Augen. Einer jungen Mutter wird man es verzeihen, wenn sie sich kurz ausruht.
Sie denkt zurück an die erste Hochzeit, die sie als Sechsjährige hier erlebt hatte. 1880 hat der damalige Wirt für die Vermählung seiner Tochter, Ludwigs Tante, aus den Überresten der verfallenen Kapelle eine neue errichten lassen und sogar eine Glocke gespendet. Agathe war damals überwältigt vom prächtigen Kirchengebäude und dem ungewohnten Klang, der vom Kirchturm weit über das Dorf hinausgetragen wurde. Schon damals träumte sie von ihrer eigenen Hochzeit mit Ludwig an diesem Ort.
Panisch öffnet sie die Augen und schaut sich um. Nein, sie hat sich nicht versündigt. Sie hat nur an die Träume und Wünsche eines Kindes gedacht. Ihr Leben hat sich seitdem in eine ganz andere Richtung entwickelt. Sie ist nun die Frau eines anderen. Und dabei bei Weitem nicht so unglücklich, wie sie anfangs geglaubt hatte, gesteht sie sich selbst ein. Anton hat zwar ein rastloses Wesen, von Zeit zu Zeit kann er auch trübsinnig werden, aber dann denkt er wieder über ein neues Ziel nach, entwickelt einen neuen Plan und steckt auch sie mit seiner Hochstimmung an. Und seine liebevolle und zärtliche Art hat ihr bereits zwei Buben beschert, das kann sie nicht leugnen.
Читать дальше