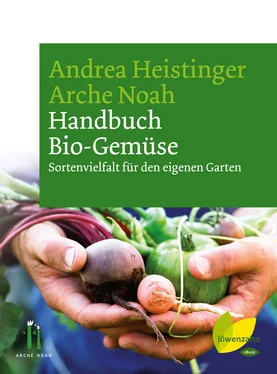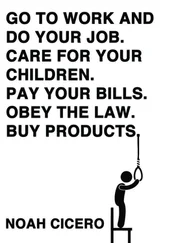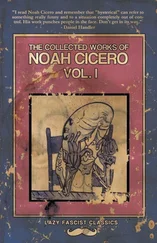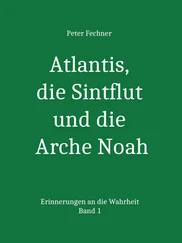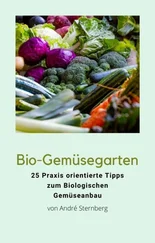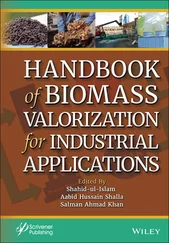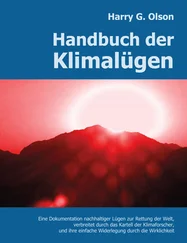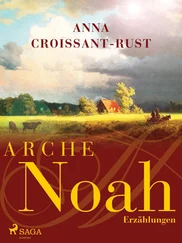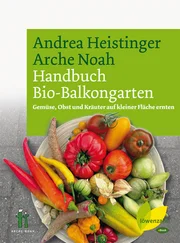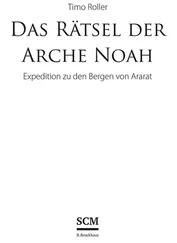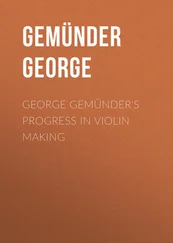Checkliste für einen Bio-Gemüsegarten
• Welchen Boden habe ich?
• Wann ist mit den letzten Frösten im Frühling zu rechnen?
• Wann mit den ersten Frösten im Herbst?
• Wie verlaufen die Tages-, wie die Nachttemperaturen im Laufe des Gartenjahres?
• Wie hoch sind die durchschnittlichen Jahresniederschläge?
• Gibt es für die Region typische Trockenzeiten und wie verteilen sich die Niederschläge über die Monate?
• Wie gieße ich den Garten? Kann ich mit Regentonnen Dachwasser sammeln?
• Wer gießt den Garten, wenn ich auf Urlaub fahre – die Nachbarn oder eine automatische Bewässerung?
• Hat sich die Witterung in der Region in den letzten Jahren verändert?
• Soll der Gemüsegarten den Großteil des Bedarfs an Gemüse, Obst und Kräutern decken oder einen kleineren Teil?
• Wie viel Zeit habe ich fürs Gärtnern?
• Habe ich eine Bezugsquelle für Mist und/ oder Kompost?
• Braucht mein Garten einen Zaun?
• Habe ich die Möglichkeit, Jungpflanzen vorzuziehen?
• Haben Nützlinge genügend Unterschlupfmöglichkeiten in meinem Garten?
• Habe ich gutes Gartenwerkzeug?
| Größe des Nutzgartens pro Kopf und Nase |
| teilweise Selbstversorgung: Gemüse und Kräuter, Beeren und Obst inklusive Wege und Kompostflächen |
25 m 2pro Person |
| weitgehende Selbstversorgung |
70 m 2pro Person |
| vollständige Selbstversorgung |
170 m 2pro Person. Davon 20 m 2Gemüse für den Frischverzehr, 40 m 2Lagergemüse und Erdäpfel, 100 m 2für Beeren, Äpfel, Birnen, Nüsse etc. und 10 m 2für Wege und Kompostflächen. |
Quelle: Natur im Garten 2000
Aussäen … in Vorkultur oder direkt ins Freiland
Die Vorkultur von Pflanzen kann aus einigen Gründen wichtig sein: Viele Pflanzen haben sehr hohe Keimtemperaturen, die wir ihnen in unseren Gärten gar nicht bieten können – oder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Die Jungpflanzenanzucht im Haus oder im Gewächshaus ermöglicht eine Vorkultur der Pflanzen und die Pflanzen haben so einen Wachstumsvorsprung und können rascher beerntet werden. Einige Kulturarten wie Melanzani oder Paprika können bei uns ausschließlich über die Jungpflanzenzucht angebaut werden. Bei einer Aussaat im Freiland wäre ihre Kulturdauer so lange, dass die ersten Fröste früher als die ersten reifen Früchte dran wären. Viele Kulturpflanzen wie Salat oder Fenchel können vorgezogen oder direkt gesät werden. Beides hat Vorund Nachteile. Als Vorteil ist immer die Ernteverfrühung zu nennen. Weiters können so manche Schädlinge den bereits größeren Pflanzen nicht mehr so leicht zu Leibe rücken: Etwa Drahtwürmer bei Salatpflanzen oder auch Schnecken bei bereits größeren Gurken- oder Kürbispflanzen. Weiters werden einige vorgezogene Pflanzen wie Sellerie oder Fenchel 1- bis 2-mal pikiert (siehe unten), was jeweils ihr Wurzelwachstum anregt. Andererseits ist das Vorkultivieren eine zusätzliche Arbeit, benötigt einen hellen und warmen Platz, die Pflanzen müssen einige Tage vor dem Auspflanzen abgehärtet werden – also untertags ins Freie und in der Nacht wieder eingeräumt werden – und das Aussetzen ist für die Pflanze ein kleiner Kulturschock. Anders, wenn sie im Freiland von der Keimung an heranwachsen. Diese Pflanzen konnten sich von klein auf an niedrige Nachttemperaturen, an den Wind und an intensive Sonneneinstrahlung gewöhnen. Und: Sie bilden ein anderes – tiefer gehendes – Wurzelsystem aus und sind weniger auf die Gießfreudigkeit der Gärtnerin oder des Gärtners angewiesen. So reichen die Wurzeln von direkt gesätem Salat bis zu 60 cm in die Tiefe, jene von gesetztem nur ca. 30 cm (→ Zeichnung). Aus diesem Grund stresst direkt gesäte Pflanzen Trockenheit nicht so schnell und sie sind schossfester. Die Direktsaat ist bei den meisten Kulturarten nur auf unkrautarmen Böden möglich. Nur Schnellstarter können, wenn sie bereits bei tieferen Temperaturen rasch wachsen können, dem Unkraut davon wachsen. Die Vor- und Nachteile der Vorkultur und Direktsaat sind bei den einzelnen Kulturarten angegeben.
Kleines 1 x 1 der Vorkultur
Die Aussaat
• Jede Kulturpflanze hat eine optimale Keimtemperatur und eine Mindestkeimtemperatur. Bei der optimalen Keimtemperatur keimen die Samen am raschesten und viele Auflaufkrankheiten (meist Pilze, die die kleinen Pflänzchen befallen und rasch hinwegraffen), haben keine Chance, die Pflanzen wachsen ihnen einfach davon. Unterhalb ihrer Mindestkeimtemperatur keimen Samen nicht. Einfache Hilfsmittel, um den Samen genügend Wärme für die Keimung bereitstellen zu können: Aufstellen der Aussaatschalen über einer Wärmequelle wie einem Heizkörper oder einem Kachelofen (allerdings Vorsicht vor dem Austrocknen – am besten mit einer Sprühflasche immer wieder leicht befeuchten). Im Fachhandel erhältlich sind Heizmatten für die Jungpflanzenanzucht, die man genau regulieren kann. Für Pflanzen mit besonders hohen Keimtemperaturen wie Melonen oder Melanzani tun diese Matten gute Dienste (ebenso Heizmatten aus dem Zoofachhandel für Haustiere).
• Neben der Temperatur braucht ein Samen zunächst Feuchtigkeit, damit die Keimprozesse in Gang kommen können. Ein keimendes Samenkorn darf niemals austrocknen, es darf aber auch nicht zu lange im Wasser liegen, sonst erstickt es.

Wer Platz sparen muss, kann Paradeiser auch dicht säen, aber jetzt rasch pikieren.
• Es gibt Samen, die nur keimen, wenn sie am Licht liegen, andere, die nur in der Dunkelheit keimen, und eine dritte Gruppe, die sowohl im Licht, wie auch in der Dunkelheit keimen kann. Ausgesprochene Lichtkeimer sind Salat, Kresse und Basilikum.
• Samen benötigen zum Keimen keinen Dünger. Die Nährstoffe, die sie brauchen, um den Keimprozess am Laufen zu halten, haben sie selbst gespeichert. Im Gegenteil: Keimlinge sind äußerst empfindlich gegen ein Substrat mit zu hohen Düngergaben, diese Salzkonzentration verätzt die feinen Würzelchen und bringt sie rasch zum Absterben oder verursacht Kümmerwuchs. Aussaaterde ist daher stets ungedüngt, Jungpflanzenerde hingegen schon leicht gedüngt.
• Viele Pflanzen können auch im Gewächshaus oder im Frühbeet in Saatkisten ausgesät werden.
• Die optimale Keimtemperatur gilt jeweils nur bis zur Keimung, danach müssen die Pflanzen kühler gestellt werden (auch diese Temperaturen sind bei den einzelnen Kapiteln angegeben). Schließlich müssen die vorgezogenen Pflanzen ja bald mit den kühleren Temperaturen im Freiland zurechtkommen (vor allem mit den größeren Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht).
• Wenn die Nährstoffe im Substrat aufgebraucht sind, müssen die Pflanzen zügig ins Beet gesetzt werden. Müssen die Pflanzen dann noch im Topf bleiben, werden sie „überständig" – sie zeigen Nährstoffmangelsymptome wie aufgehellte und vergilbte Blätter und neigen zum Schossen. Einige Pflanzen wie Gurken oder Melonen sind hier besonders empfindlich und erholen sich ein ganzes Pflanzenleben lang nicht mehr.
• Alle näheren Angaben siehe die einzelnen Kulturarten.

In die Aussaatschale wird zunächst Erde gefüllt, diese gut angepresst und mit einem feinen Strahl befeuchtet. Nach der Aussaat werden Dunkelkeimer leicht mit Erde übersiebt und Erde sowie Samen gut angedrückt, damit die Samen guten Kontakt zum Substrat haben.
Читать дальше