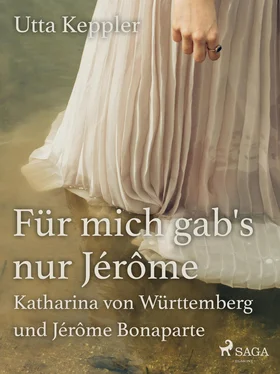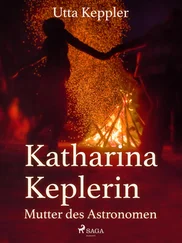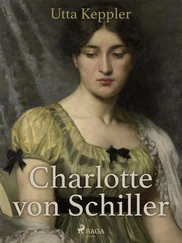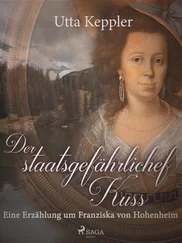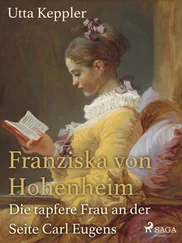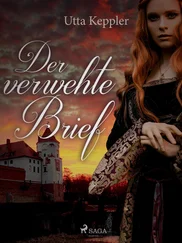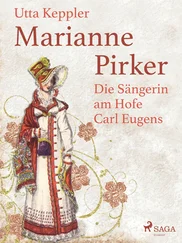Erstaunliches erfuhr man in Europa über seine hingeworfenen Gedanken: Er sei, hieß es, durch den Fehler eines ägyptischen Führers an den »Quellen Mose« bei Suez von der Flut überrascht worden und habe beschlossen, das Land zu vermessen und einmal, in befriedeten Zeiten, einen Kanal dort zu bauen – er habe, angeregt durch die monumentalen Grabmäler, die Pyramiden, die seinen Hang zum Kolossalischen ansprachen, nach Leben und Kultur Ägyptens geforscht und ein Team von Gelehrten aufgeboten, die erstaunliche Ergebnisse einbrachten, denn die frühe Geschichte Ägyptens lag für die Europäer im dunkeln. Vor allem ihre Schrift interessierte Napoleon, von ihr erhoffte er Aufschlüsse über die Geheimnisse des Landes. Schließlich gelang es dem Orientalisten Champollion, den »Stein von Rosette« zu entziffern, auf dem in drei verschiedenen Sprachen ein Dekret niedergeschrieben war – ägyptisch, demotisch und griechisch –; die Hieroglyphen konnten in der Folge entziffert werden. Es verstand sich, daß medizinische und organisatorische Reformen dazukamen, daß der Eroberer das besetzte Land sich und seinen Ideen »anverwandelte«.
Friedrich von Württemberg – oder Wirtenberg, wie es damals noch hieß – ließ sich nicht ungern auf solche Einzelheiten der Berichte ein, obgleich ihm die großen Linien napoleonischer Politik wichtiger und vielleicht sogar durchsichtiger waren als vielen seiner Mit-Rheinbundfürsten. Denn in kleinerem Maßstab war sein Charakter dem des großen Korsen sogar ähnlich, wenn ihm auch – abgesehen von den engeren Verhältnissen und ohne den ungeheueren Vorangang und Auftrag der Revolution – die Verpflichtung zum Neuerer fehlte. Friedrich war bei hoher Intelligenz und einem erstaunlichen Gespür für kaum zu formulierende Antriebe in der Wurzel ein Mann der Ordnung, der starren, versteiften Tradition, er glaubte an das göttliche Recht seines Fürstentums und an die gottverliehene Würde – oder zumindest, er ließ Land und Leute samt Mathilde und Katharina glauben, daß er daran glaubte …
Ein bißchen Geschichte könne den Frauen nicht schaden, meinte er bei einem seiner raschen Besuche beiläufig; Katharina kannte ihn gut genug, um zu wissen, daß er diese Visiten nur halbherzig machte, mit halbherziger Teilnahme, nur selten mit einer aufflackernden väterlichen Zärtlichkeit für seine Tochter. Die Frau, immer unförmiger und unbeweglicher geworden, behandelte er mit der vorgeschriebenen Höflichkeit als Fürst und offizieller Gatte, bei Festen und Auftritten mit der Courtoisie des Herrn aus altem Haus.
Katharina war ziemlich isoliert mit ihren Damen, der Hof sollte wenig Kosten machen und klein gehalten werden. Ein paar Briefbekanntschaften, flüchtige Ballplaudereien, einmal das Kompliment eines trockenen norddeutschen Prinzen, der sich mühsam zu gestotterten Höflichkeiten aufschwang. Die wenigen Gespräche mit dem Vater, der sogar gelegentlich über den Halbgott Napoleon und dessen italienische Abkunft aus der Toskana ein paar Worte verlor, waren eigentlich das einzige, was sie mehr als nur flüchtig interessierte. Die »Buonaparte« seien bei den Ghibellinen gestanden, den Waiblingern, und also eigentlich schwäbische Untertanen, behauptete er, und genauso die Buonarroti, was ›guter Stein‹ heißen könnte und zu dem Bildhauer Michelangelo passe.
Er gönnte ihr selten solche Unterhaltungen, und sie hatte keine Mutter, nur Mathilde, die zu kühl war, um ihr nahzukommen. Sie las, ritt, wanderte in den Schloßgärten herum mit den Damen und hatte zu den beiden Brüdern kaum Kontakt. Es gab eigentlich nichts, was ihr wirklich Vergnügen gemacht hätte, und wenn sie gern Musik hören oder Theater sehen wollte, hielt das der Vater für allzu kostspielig. Er pflegte nur eine Art von Familienstolz, Standestradition, und sah mit Kummer, daß sie nicht eigentlich schön war – niedlich, lieblich, knospenhaft und kindlich, aber zu rund, zu kurz geraten, mit dicken Beinen und einem molligen Unterkinn …
Sie ritt am liebsten im Herbst, allein, in den Schloßanlagen, zwischen dicken Ahornstämmen, die gefleckt, grau-weiß gesprenkelt unter dem bunten Laub standen; wenn sie Galopp anschlug, raschelten die Hufe rhythmisch im wiegenden Trab durch die dürren Blätter. Sie saß gern im Damensattel, die Beine um das »Horn« gewinkelt, und lenkte das gut trainierte Tier mit ihrer Gerte, sanft, als habe sie kein Temperament. Man hatte ihr gesagt, Reiten tue ihrer Figur gut, die schon füllig wurde, und gäbe ihrem Gesicht frische Farben, den rundlichen Backen unter dem gekräuselten Haaransatz.
Aber eigentlich Spaß machte ihr nur das Einverständnis mit dem geduldigen Tier, das willig auf sie einging und ihr nichts vorschrieb und nichts befahl.
Sobald sie dann wieder in den Schloßhof einbog, präsentierten die Wachen, sie setzte sich gerade auf, und wenn sie dann die Treppe hinaufstieg, schlug sie die Schleppe im gelernten Schwung über den Arm.
Einmal hatte sie die Reitschute schnell abgeworfen und den Sessel damit verfehlt, und die Hofdame war zugelaufen, um das Hütchen aufzuheben, als ihr Vater hereintrat, unverhofft, wie er das manchmal tat, entgegen der strengen Etikette, die er von anderen verlangte.
Er hatte sie später zu sich kommen lassen und zornig angeschrien: »Das tut eine Prinzessin nicht! Man bleibt gemessen vor den Bedienten! Form und Ordnung sind das, was wir beherrschen und wodurch wir herrschen müssen. Was ungeregelt ist, muß draußen bleiben …«
Katharina hatte fast geweint, nur die Angst vor einem neuen Tadel hatte sie davor bewahrt. »Das Ungeregelte« – sie spürte, daß es ihre Mutter getötet und den Vater aus Rußland getrieben hatte, daß die Furcht davor wie ein Krampf und Zwang sein Menschliches niederhielt, vielleicht seine schwerblütige, cholerische Natur verbogen und verzerrt hatte. Und auch, daß die englische Frau mit aller geistlosen Form ihm nicht helfen konnte.
Gegen Ende des Jahres 1803 hatte Jérôme Bonaparte die bildhübsche junge Elisabeth Patterson in Baltimore geheiratet, mit kirchlichem Segen von der Hand eines hohen geistlichen Würdenträgers.
In Württemberg wurde nicht mehr davon geredet, seit Mathilde die romantische Geschichte mit mißbilligenden Zusätzen an Katharina weitergegeben hatte.
Um so mehr in den Pariser Salons, denn die Affäre des wildverliebten, tollköpfigen Jungen, dem dazuhin der Ruf des waghalsigen Seehelden anhing, bewegte alle empfindsamen Gemüter, zumal eine Tragödie wie eine düstere Wolke über seinem Lockenkopf drohte: Der Zorn des großen Bruders war zu erwarten. Napoleon hatte auf die Ankündigung seines Besuchs hin depeschiert, daß er zwar bereit sei, seinen Bruder zu empfangen, ihn sogar, wenn er reuig und folgsam heimkomme, trotz seiner Eskapaden anzunehmen, nicht aber diese junge Person, »jene Mademoiselle Patterson, mit der er lebt«.
Jérôme faßte einen typischen Entschluß: Diplomatische Winkelzüge lagen ihm nicht; er war sicher, den Bruder überrumpeln zu können, denn Elisabeths Schönheit, ihr Takt, ihre Intelligenz, ihr Charme würden, so verkündete er, »das Herz des Ersten Konsuls im Sturm erobern«.
Also sollte Elisabeth ohne Kenntnis der zahlreichen Agenten, die Napoleon in Baltimore verteilen ließ, nach Frankreich gebracht werden. Jérôme mietete eine Brigg, ging im Herbst 1804 in Baltimore an Bord und nahm seine Frau, ihre Tante und ein nicht eben dürftiges Gefolge mit, außerdem eine Summe von 3 000 Dollar samt reichlicher Bagage. Die Brigg segelte bei gutem Wind den Fluß abwärts, und alles ließ sich recht hoffnungsvoll an, doch als man das offene Meer erreichte, nahm der Seegang zu, die junge Frau fühlte sich übel, Jérôme ängstigte sich um sie und das vielleicht erwartete Kind und befahl dem Schiffsführer, vor Anker zu gehen.
Anderntags, als man wieder »in See stechen« wollte, wie Jérôme das fachmännisch nannte, hatte der Wind umgeschlagen, und die Flut ging bedenklich hoch. Der Kapitän murrte: In einer halben Stunde hätte man Cap Henlopen erreichen können, wenn man gleich weitergesegelt wäre, aber durch den Aufenthalt sei man jetzt in das wüsteste Unwetter geraten, das in dieser Gegend möglich sei …
Читать дальше