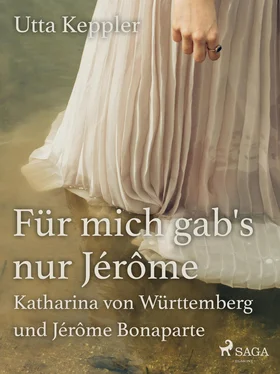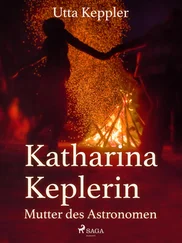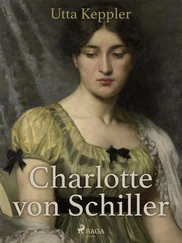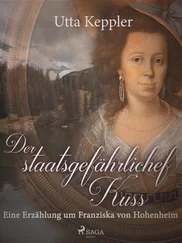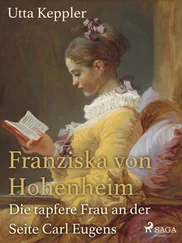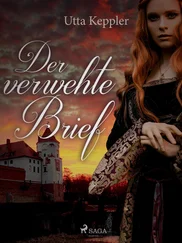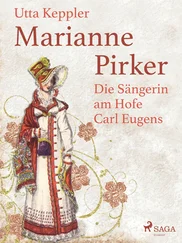Die Leute vor der Tür guckten sich verschüchert an. »Da sei was nicht ganz hasenrein … heißt es.«
»Um Gottes willen«, warnte der Grauhaarige, »sag das nicht!«
Es gab freilich nichts, was die schwäbischen Pietisten hätte empören können, nur eine Art Sohnesfreundschaft und ehrfürchtige, manchmal nachsichtig-zärtliche Rücksicht auf den dunklen Koloß und seine vulkanische Natur; und vom Herzog her vielleicht den heftigen, gewalttätigen, fordernden Anspruch auf unbedingte Zuverlässigkeit.
Er hatte gelacht und gelächelt, wenn Zeppelin hereingetreten war, und jetzt stieß und würgte den Alleinherrscher das Gefühl der Machtlosigkeit einer rätselhaften Krankheit gegenüber.
»Vorgestern«, flüsterte der jüngere Kammerdiener, »war er eingeschlafen, mit dem Kopf auf dem Tisch. Er hat nicht geläutet, aber weil ich ihn schnarchen hörte – ich hatte das erstemal Dienst –, kriegte ich Angst, es könnte ihm etwas fehlen, er schnarchte so laut … da bin ich doch hinein, ganz leis, und sah ihn sitzen und ließ ihn.«
Friedrich klingelte. Zwei Diener kamen unter Bücklingen herein.
»Wecken, morgen früh, wie immer!« Der massige Kopf ruckte auf den Schultern, als rühre sich ein Steinblock auf dem Sockel. »Und morgen um zehn Uhr soll der Dannecker antreten, der Sculpteur, verstanden?«
Als Dannecker sich meldete, ein kräftiger Mann mit einem schwäbischen großen Mund und halblangem hellbraunem Haar, ließ ihn Friedrich sofort hereinrufen, unterbrach die Besprechung mit dem russischen Geschäftsträger und winkte: »Prenez place , Dannecker! Ich brauche einen Entwurf, eine Skizze, nach Ihren Notizen – das Modell steht im Moment nicht zur Verfügung.«
Dannecker zog vorsichtig einen Stuhl heran, verbeugte sich noch einmal und setzte sich. »Zu Diensten, Durchlaucht.«
»Ich will von Ihnen ein Porträt des Grafen Zeppelin. Er ist krank, die Ignoranten von Medizinern wissen wieder einmal nicht weiter. Ich will, daß Sie das so vorbereiten, daß Sie ihn nach seiner Genesung – Gott füg’s! – nicht mehr lange zu quälen brauchen, er hat ja auch immer wenig Zeit, wenn er gesund ist … Lassen Sie sich das Gemälde des Schick ins Atelier bringen, ich erwarte etwas wie das Wesen des Grafen, und es soll ihn freuen, wenn er’s sieht.« Friedrich riß an seiner Hemdspitze herum. »Können Sie das?«
Dannecker sagte bescheiden, der Herzog kenne ja seine Arbeit an der Schillerbüste, die er schon 1796 begonnen habe, den Gipsguß, den er gern, so der Herr es wünsche, noch einmal aus der Werkstatt herschaffen lasse.
»Der Schiller ist anders«, knurrte Friedrich, »der ist knochiger, männlich und heldenhaft, ein Volksheros. Diesen da will ich für mich, einen hellstirnigen Menschen, ein geistiges Bild.«
Dannecker sah erstaunt auf. Der Gigant da vor ihm hatte die kleinen Augen fast ganz geschlossen, um den Mund zogen sich die Schrammen bis zum Kinn hinunter, keine Falten mehr, tiefe Risse, trotz des unschönen Fetts, das die Wangen blähte und den Hals fast verschwinden ließ.
»Schau Er mich nicht so abschätzig an!« schrie Friedrich und brauchte absichtlich das altmodische »Er«.
Dannecker entschuldigte sich, er sei Künstler und sehe jedes Gesicht als Vorwurf für eine Plastik. Das sei ehrfürchtig gemeint, sagte er noch.
Friedrich schwieg darauf und stemmte sich aus dem Stuhl in die Höhe.
»Lassen Sie das Gemälde ins Atelier tragen! Ich weise das an.« Friedrich schellte, während der Meister sich unter Bücklingen zur Tür tastete. Draußen wurde ihm versichert, das Werk werde pünktlich in seinem Hause sein. Dannecker ging.
»Hofbildhauer …«, murmelte er ärgerlich, »Hofknecht!« Im Weitergehen wurde er gelassener. Aber doch, dachte er, der alte Carl Eugen hat’s ganz gut gemacht, daß er mich meinem Vater abgeluchst hat … Sonst wäre ich dem sein Roßbub geblieben, und wie hätt’ ich je zum Le Jeune kommen sollen ohne ihn? Gerecht muß man schon sein, auch gegen die Fürsten, sogar wenn’s arg menschliche Menschen sind! Und der da drin ist scheint’s bös geplagt worden in Rußland, und Genaues weiß keiner von uns. Da denkt er halt nicht viel Gutes von den Leuten, und seine englische Mathilde gilt ihm auch wenig. Der Zeppelin ist der einzige, dem er traut – und jetzt will er ihn festhalten im Stein, wo er bald Kurfürst wird, und ihn selber soll ich auch machen.
Man klatschte viel am Stuttgarter Hof über die englische Heirat, es war klar, daß dies eine rein politische Angelegenheit war. Aber für die Princess Royal, Charlotte Augusta Mathilde, war die Heirat doch wohl mit ein paar fraulichen Hoffnungen verknüpft gewesen. Seiner Tochter Katharina hatte Friedrich geschrieben:
»Mein liebes Kind! Seit dem achtzehnten Juli hast Du eine neue Mutter, die das Glück Deines Vaters bedeutet und bedeuten wird, und die Du infolgedessen lieben und achten wirst, davon bin ich überzeugt …«
Als das junge Mädchen den Umschlag öffnete, weinte es, schon bei den ersten Sätzen. Was der Vater tat, war immer unberechenbar und eigentlich zum Fürchten. Und er erklärte nichts, er verfügte bloß. Er hatte sie mit den beiden Brüdern aus Rußland nach Württemberg gebracht, das sie kaum kannte, nur aus Berichten und von Bildern her, und sie wußte nicht, was aus ihrer Mutter, der Braunschweigerin, geworden war. Man sagte ihr, sie sei tot, aber die russische Kinderfrau hatte ihr erzählt, die Prinzessin-Mutter sei mit einem kleinen Engel im Arm weit fortgeflogen.
»Und das war mein Schwesterchen oder mein Bruder?« fragte Katharina einmal, aber niemand gab Antwort darauf. Daß der Vater seit damals anders geworden war, noch verschlossener, selbstherrlicher, härter, spürte sie bald. Sie gewöhnte sich daran, ihn zu meiden, und merkte doch, daß er für sie offener und zugänglicher war als für die Brüder. Er erzählte sogar manchmal von Rußland, von seinem Gouvernement in Cherson, zu dem ihn die große Katharina, ihre Patin, berufen hatte. Mit ihr hatte er manchmal deutsch gesprochen, sie war eine deutsche Prinzessin aus Anhalt-Zerbst, vom großen Friedrich, dem Preußen, für den russischen Paul ausgesucht … Von Cherson, an das sie eine unklare und meist verdrängte Erinnerung hatte, war die Kleine nach Mömpelgard gebracht worden; sie dachte oft an die Zeit in dem großen Stadtschloß und an das weiter draußen gelegene Staint Étupe, an den Weg neben dem Flußufer, unter hängenden Buchenzweigen, zwischen denen immer wieder Stadt und Schloß sichtbar wurden, an die vielen Kanäle, die alles Gemauerte einschlossen.
Man hatte ihr gesagt, Mömpelgard gehöre seit dreihundert Jahren zu Württemberg, von jener Henriette als Heiratsgut eingebracht, die den Friedrich von Zollern in der Schlacht besiegt hatte, den Ahnen des Preußenkönigs. Inzwischen war das Gebiet oft von Truppen durchzogen, geplündert und verwüstet worden. Sie kannte nur das alte Bild aus der Kinderzeit, ihr hafteten kleine Blitzlichter, helle Funken ohne Zusammenhang, ein rosenumwachsener Balkon, ein schmaler Dachfirst, im Gedächtnis.
Katharina war mit achtzehn Jahren noch immer ein halbes Kind, wie es die blonden, hellhäutigen Typen oft sind; und sie war in ihrem Umkreis gefangen, in ihrer Kaste, ihrer Tradition, wie unter einer Glasglocke, die ihr keinen Ausgriff in die »gewöhnliche Menschenwelt« ließ. Sie war naiv, aber klug genug, um wenigstens im eigenen Wesen, in der eigenen Sippschaft, in der Geschichte der Familie zu forschen, da sie wissen wollte, »mit welchen Pferden sie fahren sollte«. Sie verglich Züge im Charakter des Vaters mit ihren eigenen Antrieben, fragte nach seiner Jugend und nach der Mutter, die noch immer, kaum gekannt, wie ein Traumwesen in einem Nebelflor vorüberschwang, wenn sie das Thema beim Kurfürsten anschlagen wollte.
Dann tauchte auch, sichtlich vorsichtig berührt, nur mit undeutlichen Floskeln erwähnt, die berühmte Großtante auf, ihre Patin, die große Zarin Katharina. Sie merkte bald, daß die Herrscherin wie ein Tabu, ein bedrückendes, quälendes Phantom über dem Vater hing, das einzige Bild, vor dem der Mächtige sich duckte, das er mied und fürchtete. Das erschreckte sie, denn sie glaubte zu wissen, daß der Name ein Zeichen, ein Stempel und ein Signum sei, das eine Richtung weise, und man hatte ihr den Namen dieser Frau mitgegeben.
Читать дальше