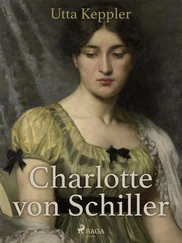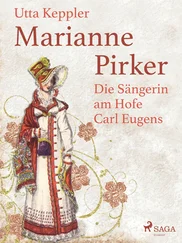Leclerc – eingezwängt zwischen Auftrag und Einsicht – machte dringend auf die Agenten Englands aufmerksam, die den Zwiespalt ausnutzten und den Kolonisten Hilfe anboten … Spannungen, Emotionen, zwischen denen der Kommandeur sich wand, ohne Rückhalt und auch nur Verständnis bei seinen Nächsten. Pauline erfuhr durch Briefe aus der Heimat von der Enthauptung Ludwigs XVI., redete sprudelnd und naiv über den armen, dummen König, machte sich gegen Leclercs Wunsch wichtig damit und verstand erst zu spät, daß die Spanier, noch immer begierig auf den Besitz der Kolonie, aus diesem Königsmord eine Legende machten, um die Schwarzen aufzuhetzen, denen der König noch immer ein magisches Symbol und ein halbgöttlicher Heros war, auch bei einem fremden Volk. Übrigens nutzten gerade die spanischen Pflanzer ihre Sklaven, die Unfreien, barbarisch aus und straften Ungehorsam mit grausamen Folterungen.
Einer der Freigelassenen, ein riesiger, reinblütiger Neger, Toussaint Louverture, organisierte seine Landsleute, trieb sie zu Massakern in einsam gelegenen Gehöften an, drillte sie nach europäischem Muster und ließ sie glauben, ihre Seelen kehrten, nach dem Tod durch die verhaßten Weißen, in die afrikanische Heimat, zu ihren Geistern, Medizinmännern und Wodu-Heiligtümern zurück …
Leclerc versuchte den Rebellen mit hinhaltenden Scharmützeln zu begegnen, setzte auf ihre Desorganisation und allmähliche Ermüdung, hoffte auf ein langsames Versickern des Widerstandes, als er von einer üblen Nachricht aufgeschreckt wurde: Jérôme hatte eine junge Negerin entführt, geschwängert und verschwinden lassen … Das war nicht mehr nur ein harmloser Streich, sondern lieferte der Hetze gegen Frankreich reichliche Nahrung. Aber noch viel brisanter wurde die Sache, als bekannt wurde, daß es sich bei dem Mädchen um eine Verwandte des Generals Toussaint Louverture handle. Daß sie mit einem Boot verschwunden war und die Ruderer schließlich, scharf verhört, zugaben, man habe sie nicht getötet, ließ vermuten, daß sie das Abenteuer weiterverbreitete und daß Toussaint inzwischen davon wußte.
Leclerc wurde ungeachtet seiner trockenen, verbissenen Redeweise so heftig, daß Pauline aus dem Zimmer lief. Jérôme weinte fast; er jammerte, er habe bei seiner Jugend und seinem romantischen Feuer ja nicht anders handeln können – aber Leclerc schnitt ihm brutal das Wort ab, und gemahnt, das Mädchen zu suchen und abzufinden, stöhnte Jérôme, er habe doch kein Geld, nur große Schulden …
Schließlich drehte sich dér Generalgouverneur angewidert weg. »Ich werde die Sache bereinigen«, sagte er, »und das arme Geschöpf bezahlen.« Nicht einmal Paulines Schwesternzärtlichkeit kam dem Leichtsinnigen mehr zu Hilfe: Solche Eskapaden, vollends wenn sie bekannt geworden waren, mochte sie nicht.
Leclerc ließ sich trotz seines Ärgers herbei, Jérôme noch einmal über die Vorgeschichte und die politischen Schwierigkeiten und Ziele der Kolonialisierung Haitis aufzuklären. Müde, sichtlich von Jérômes Unverständnis überzeugt, zeigte er ihm auf der Karte die portugiesischen, englischen und spanischen Eroberungen und Verluste, Toussaints Unternehmungen, seine – Leclercs – Gegenzüge und die Erlasse und Dokumente, die zwischen Napoleon und dem Rebellenführer gewechselt worden waren. Jérôme bekam zum erstenmal Papiere in die Hand, die ihm das Maskenspiel, in dem er sich vergnüglich umzutreiben glaubte, als Aufgabe, als Verantwortung, als Arbeit, die einen reifen Mann verlangte, auswies.
»Sie sehen, Bürger Jérôme«, sagte Leclerc, »welch großes Ansehen dieser Schwarze genießt, Sie verstehen, daß der Erste Konsul wünscht, ihn zu schonen und freundlich zu stimmen, und Sie ahnen wohl jetzt endlich« – seine Stimme wurde scharf –, »wie aufgebracht er sein wird, wenn er von Ihrem üblen Streich erfährt. Segeln Sie nach Paris und stiften Sie hier keine Unruhe mehr, das ist ein Befehl!«
Es war nur die halbe Wahrheit, die Leclerc preisgegeben hatte, aber weder Pauline noch gar Jérôme durchschauten das.
Nach den Kämpfen, die noch während des Briefwechsels der Anführer wieder ausbrachen, nach Toussaints bissigen Vorwürfen gegen Napoleon, dem er den eigenen ungesetzlichen Staatsstreich vorwarf, lag weder dem Generalgouverneur noch dem Ersten Konsul mehr allzuviel an Toussaints Schonung und Freundschaft. Schließlich erließ Leclerc einen Tagesbefehl, mit dem er die Aufständischen außerhalb des Gesetzes stellte.
Obwohl der Partisanenkampf in dem mörderischen Klima, die Moskitos und der Durst die Franzosen furchtbar schwächten, hatte Leclerc die Festung Crête Pierrot erobert, sechshundert Schwarze gefangennehmen und erbarmungslos niedermachen lassen. Und eben jetzt, fast gleichzeitig mit der Verabschiedung des Schwagers, verlangte Leclerc die bedingungslose Unterwerfung Toussaints, seiner Unterführer und Vasallen und plante gleichzeitig die Überlistung und Gefangennahme des gefürchteten Feindes. Der harmlose »Kleine« sollte Leclercs freundliche Gesinnung bekannt machen und zugleich gemaßregelt und aus der bedrängten Kolonie entfernt werden.
Toussaint, militärisch durch den Verrat seiner Verbündeten fast wehrlos, baute auf einen bösen Helfer: Er verzögerte durch Guerillakämpfe die Übergabe, versteckte sich und ließ hier und dort einen unübersichtlichen grausamen Buschkrieg auflodern; denn er hoffte auf die Regenzeit, die alljährlich das Gelbfieber brachte, die Seuchen, gegen die seine Schwarzen nahezu immun, die Franzosen aber kaum widerstandsfähig waren – es würde sie, schrieb er, »niederwalzen wie Gras«, vielleicht, wie schon einmal bei der ersten Eroberung vor Jahrhunderten die Spanier, zu Aufgabe und Verzicht zwingen …
Jérôme schiffte sich auf der Cisalpin ein und landete am 11. April in Brest.
Pauline hatte ihn – trotz allem – gerührt fortgewinkt, Leclerc war erleichtert, den unberechenbaren und letztlich unbrauchbaren Burschen loszusein, den er nicht maßregeln durfte.
In Saint Domingue nahm die Hitze zu, in der brütenden Glut brachen fast täglich Tropengewitter und Regengüsse los, die wie Urweltkatastrophen niederstürzten, alles überschwemmten und wegrissen, was nicht fest verankert war, Felsen kahlfegten und Hütten mitspülten. Die Keller liefen voll, die Pferde standen bis an den Bauch im Wasser. Danach wurde es dann schnell kühler, aber nur für Viertelstunden. Die Hitze drückte bald wieder auf die Dächer, und auch im Gouverneursbau halfen die Springbrunnen nicht viel; Pauline lag den Tag über auf einem Diwan und ließ sich Luft zufächeln, man trug Wassersprenger mit duftenden Essenzen durch die Zimmer, die schwarzen Mädchen standen um Pauline herum und schwitzten; sie verlangte mehr und anderes Parfum und plagte Leclerc mit immer neuen Wünschen, die sie ihm melden ließ.
Schließlich unterbrach er seine Arbeit und ging zu ihr hinüber. »Liebe, du mußt dich zufriedengeben«, sagte er matt, »wir haben gewußt, daß uns das Tropenklima drücken würde, mich quält es auch. Aber schau, es regnet ja schon. Und wenn ich das Fenster öffne, wie kühl es hereinweht – spürst du den Schauder, Pauline?«
Sie sah ihn erstaunt an. »Ich spüre keinen Schauder, mein Freund!« Sie stöhnte weinerlich. »Ich spüre bloß die trockene Glut. Komm, setz dich zu mir und tröste mich!«
Leclerc ließ sich auf den Rand des Lagers sinken. Er nahm ihre Hand, und sie zuckte zurück.
»Du bist heiß – fast zu heiß!« murmelte sie und legte ihre Fingerspitzen auf seine Stirn, wo das dunkle Haar klebte. Er warf die Hände vor die Augen und ächzte: »Mir ist schlecht, Pauline, ich fürchte …«
»Du hast Fieber, mon cher !« schrie sie ekstatisch und sprang auf. »Ein Arzt soll kommen, schnell!«
Eines der schwarzen Mädchen lief kreischend hinaus, Leclerc fiel auf das Lager und krümmte sich wimmernd. Es war das Gelbfieber, das schon seit Tagen unter den Soldaten grassierte und das die Fliegen, die Moskitos eingeschleppt hatten. Man brachte ihn zu Bett.
Читать дальше