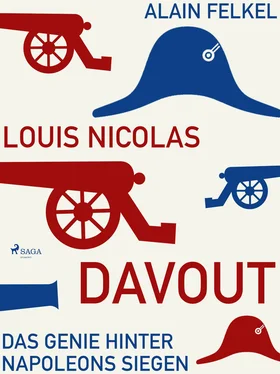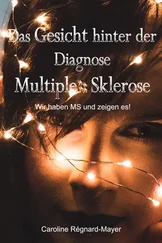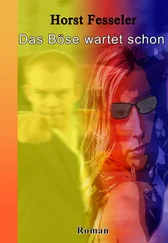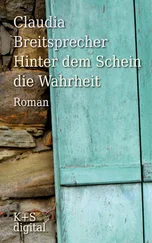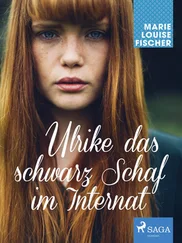1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Zu Beginn des Jahres 1780 betrat der »Cadet gentilhomme« Louis Nicolas Davout in einer blauen Uniform mit roten Aufschlägen und weißen Knöpfen das alte Jesuitenkollegium von Amyot, die Militärschule von Auxerre. Diese wurde von Benediktinern geleitet und war erst 1776 gegründet worden. Die Militärschule von Auxerre war Baustein eines umfassenden Reformprogramms, das die Ausbildung des französischen Offizierskorps von Grund auf zu erneuern trachtete. Die schweren Niederlagen des Siebenjährigen Krieges hatten die taktischen Schwächen und das strategische Unwissen vieler französischer Offiziere offenbart, die das Schlachtfeld für einen besseren Exerzierplatz hielten. Katastrophale Niederlagen wie die Schlachten von Rossbach (1757) und Minden (1759) hatten den guten Ruf der einst gefürchteten französischen Armee schwer erschüttert.
Mit der Reform von 1776 hoffte das Kriegsministerium, dies zu ändern. Zu diesem Zweck wurde ein Dutzend Militärschulen gegründet, die ihre Standorte in der Provinz hatten. Mit dieser Maßnahme sollte vor allem der niedere Landadel, dessen Angehörige oft zu arm waren, um Offizier zu werden, mithilfe von Pensionen die Chance erhalten, die Offizierslaufbahn einzuschlagen.
In dieser Hinsicht hatte der Besuch des Militärkollegs die Funktion, dem Schüler eine solide Allgemeinbildung und militärische Werte wie Disziplin und Standhaftigkeit zu vermitteln. Die Lehrer dieser Kollegien waren in Ermangelung geeigneter Pädagogen keine Offiziere, sondern erfahrene Geistliche, die klassische Lehrfächer wie Latein, Mathematik, Englisch und sogar Fechten unterrichteten. Hatten die Schüler sich nach fünf Jahren Schulunterricht bewährt, entschied ein Auswahlverfahren darüber, ob sie in Paris die École Royale Militaire, das West Point des Ancien Régime, besuchen durften.
Dass ausgerechnet Davout sämtliche Instanzen dieser Einrichtung erfolgreich durchlaufen würde, schien zu Beginn des Jahres 1780 noch völlig undenkbar. Der Neunjährige tat sich mit der strengen Disziplin im Militärkolleg äußerst schwer und kam mit dem Erziehungskonzept der Benediktiner nicht zurecht. Er störte oft den Unterricht und glänzte eher als Raufbold denn als Musterschüler. Dies ging sogar so weit, dass er eines Tages einem Mitschüler vorschlug, ihn bei den tagtäglichen Schulhofschlägereien zu beschützen, falls dieser für ihn lästige Hausaufgaben erledigte.
In einem Brief aus dem Jahre 1807 meinte Davouts Mutter rückblickend, dass ihr Sohn während seiner Kindheit dafür bekannt gewesen sei, mit äußerster Kaltblütigkeit für viel Lärm zu sorgen. Diese und andere Eigenschaften – der Hang zur Provokation und Rebellion sowie eine außergewöhnliche Nervenstärke – sollten sich im Lauf der Jahre zu seinen Hauptcharakterzügen entwickeln.
Aber noch etwas anderes zeigte sich in diesen prägenden Jahren: sein Hang zu den Kriegskünsten sowie seine hohe analytische Begabung. Während er überhaupt keine Neigung zu Latein zeigte und in Deutsch versagte, war er ein guter Fechter und erbrachte unter der Anleitung des Pädagogen Dom Laporte in Algebra und Geometrie ausschließlich exzellente Leistungen.
Wie es schien, erreichte dieser hervorragende Lehrer, dass der Klassenrabauke langsam Interesse am Unterrichtsstoff entwickelte. Dies lag zum einen an seiner einfühlsamen Pädagogik, zum anderen an seinem Charisma. Dom Laporte war nicht ausschließlich Pädagoge und Geistesmensch wie seine Lehrerkollegen, sondern auch ein hervorragender Sportsmann mit gewaltiger Körperkraft. Sein Lieblingssport war Ringen. In dieser Disziplin erreichte Dom Laporte eine derartige Meisterschaft, dass ein Schausteller es auf dem Jahrmarkt mit der Angst zu tun bekam, als der Geistliche ihm anbot, einen Schaukampf gegen seinen Tanzbären zu machen. Statt sich auf die Urkraft seines Untiers zu verlassen, zog es der Bärenführer vor, die Flucht zu ergreifen. Augenscheinlich hatte er von Dom Laportes Ringkünsten gehört und Angst bekommen, dass dieser seinen Tanzbären schwer verletzen und somit seine Existenz ruinieren könnte.
Erzählungen wie diese waren natürlich dazu angetan, den Schüler Louis Nicolas für Dom Laporte zu begeistern. Davout legte sich ins Zeug. Fast wäre er sogar bei einer Schulfeier mit einem Preis in Mathematik ausgezeichnet worden, hätten ihm nicht zwei seiner Charakterschwächen einen üblen Streich gespielt, die ihm während seines Lebens noch oft schaden sollten: krankhafter Argwohn und sein Hang zum Jähzorn.
Folgendes war passiert: Beim alljährlichen Abschlussfest seiner Schule hatte Louis, in der Annahme, bei der Preisverleihung unfairerweise übergangen worden zu sein, aus Rache die Birnenbäume seiner Lehrer verwüstet und war dabei von Dom Laporte erwischt worden.
Doch es kam noch schlimmer. Nachdem Dom Laporte dem Wüterich vor versammelter Schule seine Verfehlungen vorgehalten hatte, erhielt Louis den Preis nicht, den man ihm ursprünglich zugedacht hatte. Es war eine peinliche Situation, an die sich Davout noch Jahrzehnte später erinnerte.
Von nun an änderte sich Davouts Wesen. Der einstige Problemschüler tat alles, um die Scharte auszuwetzen, und brachte bis zum Ende seines Aufenthalts in Auxerre gute Leistungen. Trotzdem hätte er sich nie für die École Royale Militaire von Paris qualifiziert, wenn sein Onkel Jean Edme Davout sich nicht für ihn verwendet hätte. Dieser nutzte seine guten Beziehungen zum stellvertretenden Generalinspekteur der Militärschulen und verschaffte seinem Neffen im Handumdrehen den heiß begehrten Platz. Klüngeleien wie diese waren im Ancien Régime an der Tagesordnung und der Türöffner für so manche Karriere.
Mit der Reise nach Paris öffnet sich für das Halbwaisenkind aus der Provinz das Tor zur großen weiten Welt. Wie muss der Junge gestaunt haben, als er zum ersten Mal die von 5000 Straßenlaternen beleuchtete Metropole mit ihren gepflasterten Straßen, luxuriösen Karossen und dem Königspalast sah. Wie wird er innerlich gejubelt haben, als er seine neue Schule, die »École Royale Militaire de Paris«, entdeckte, die ein junger Korse namens Napoleon Bonaparte erst einen Monat zuvor mit seinem Offizierspatent verlassen hatte.
Die Akademie, die für weitere zwei Jahre sein Heim werden sollte, glich in keinster Weise dem Militärkolleg von Auxerre, sondern einem königlichen Lustschloss. Eine große Allee führte durch einen gepflegten Park auf das Portal des Haupthauses, ausladende Seitenflügel verliehen dem Gebäude Grandeur. Was jedoch auf den ersten Blick wie ein Paradies anmutete, erwies sich schnell als goldener Käfig. Architektonisch ein Prachtbau, wehte in diesen scheinbar so glanzvollen Mauern der eisige Wind schneidender Kommandos und die moralische Sittenstrenge klösterlichen Lebens.
Von Montag bis Samstag wurden die Zellen der Kadetten pünktlich morgens um halb sechs aufgeschlossen, damit sie sich waschen konnten. Dann gingen die Offiziersanwärter gemeinsam zur Messe, bevor sie sich zum Uniformappell sammelten. War diese allmorgendliche Prozedur überstanden, begannen nach einem kräftigen Frühstück um 7 Uhr morgens die Kurse. Klassische Unterrichtsfächer wie Geschichte, Geografie, Englisch, Deutsch und Mathematik wechselten sich mit Fächern wie Festungsbau, Exerzieren, Schießen, Fechten, Reiten ab.
Darüber hinaus wurden die Zöglinge der École Royale Militaire im öffentlichen Recht unterwiesen und bekamen Tanzstunden. Schließlich musste ein Offizier auch bei gesellschaftlichen Anlässen glänzen.
Der Stundenplan war dicht, das Leben in der Schule hart und entbehrungsreich. Die Kadetten sollten in der École Royale derartig geschliffen werden, dass der spätere Dienst in ihren Einheiten ihnen wie ein Kinderspiel vorkam.
Und so verging jeder Unterrichtstag im steten Wechsel von Kursblöcken, Uniformappellen, Messen und Pausen, bis es 20.45 Uhr schlug und die Kadetten erschöpft auf ihre Zimmer gingen und wieder eingeschlossen wurden.
Читать дальше