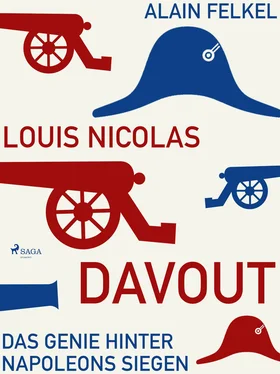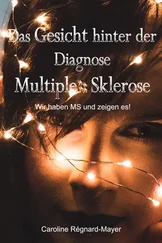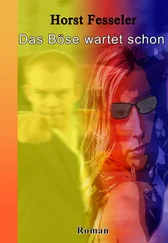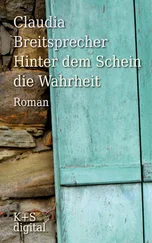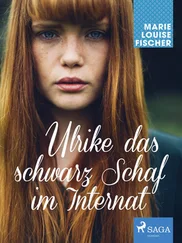In Paris ahnte man von alldem nichts. Am 19. Juni wiegte sich die Seinemetropole in trügerischer Sicherheit. Obwohl der Feldzug noch nicht beendet war, suchten an jenem herrlichen Sommertag Tausende unbeschwert ihr Vergnügen auf den Boulevards und in den Cafés. Der Krieg, so schien es, war weit weg und der endgültige Sieg nah. Wozu sich also sorgen?
Und trotzdem gab es Franzosen, die an jenem Tag ein ungutes Gefühl hatten, einen untrüglichen Instinkt, dass etwas nicht stimmte. Einer von ihnen war der Kriegsminister von Frankreich, Louis Nicolas Davout, Herzog von Auerstedt und Fürst von Eckmühl.
Grund dieser Beunruhigung war eine Depesche, die Davout im Laufe des Tages zugestellt bekommen hatte. Die Nachricht enthielt die dringende Aufforderung, alles an Waffen, Ausrüstungsgegenständen und verfügbarer Munition sofort in die Magazine der Nordarmee zu schicken und den Ausbau der Pariser Befestigungen voranzutreiben. Dies ließ Davout aufhorchen. Als Kriegsminister wusste er die Arsenale der Nordarmee bestens ausgerüstet. Waren diese Vorräte etwa in die Hände der Alliierten gefallen? Wenn ja, konnte das nur bedeuten, dass der Kaiser eine Niederlage erlitten hatte. Davout brauchte Gewissheit. Befolgte er den Befehl blindlings, drohten die Munitionstransporte in die Hände des Feindes zu fallen. Mit banger Erwartung wartete er auf Nachrichten aus dem Louvre. Hier befand sich der Anfangs- und Endpunkt des optischen Telegrafennetzes Frankreichs, die Schaltzentrale des Kaiserreichs, befehligt von Joseph Bonaparte, dem älteren Bruder Napoleons. Kam eine Nachricht an, entschlüsselten Telegrafisten die Botschaften, welche die Signalflügelarme des Balkentelegrafen anzeigten, und gaben diese an Depeschenreiter weiter, die sie zu ihrem Bestimmungsort beförderten.
Doch so sehr der Kriegsminister auch auf die erlösende Nachricht hoffte, der Louvre blieb stumm. Davout beschloss, seine düsteren Ahnungen vorerst zu verdrängen. Aber Gästen eines gemeinsamen Abendessens entging an diesem Tag nicht, dass der fast 1,80 Meter große, kahlköpfige Mann mit dem feingeschnittenen Gesicht äußerst nervös war. Der Kriegsminister wirkte fahrig, beinahe geistesabwesend und beteiligte sich kaum an den Gesprächen bei Tisch.
Die Antwort auf seine Fragen sollte der Marschall schon am nächsten Morgen erhalten. Als Davout im Norden von Paris die Befestigungsarbeiten bei Villette leitete, fiel ihm eine Kutsche auf, die in Begleitung eines Adjutanten geradewegs aus Belgien kam. Der Fürst von Eckmühl beschloss, sich mit dem Offizier zu unterhalten, der den Leichnam eines gefallenen Generals nach Hause brachte. Was der Adjutant erzählte, bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Der Offizier berichtete ihm, von flüchtigen Soldaten gehört zu haben, dass die französische Armee vernichtet und auf der Flucht sei. Dies reichte, um den Kriegsminister davon zu überzeugen, dass seine Anwesenheit beim Ausbau der Befestigungen überflüssig war und er sofort andere Prioritäten zu setzen hatte. Eine Nachricht von derartigem politischen Sprengstoff bedurfte der Überprüfung, zumal der Bericht des Adjutanten in den Augen des argwöhnischen Kriegsministers nicht vollkommen glaubwürdig war. Schließlich hatte jener Adjutant weder bei Waterloo gekämpft, noch die Flucht der Truppen vom Schlachtfeld selbst beobachtet. Was der Mann berichtete, fußte auf den Aussagen flüchtiger Soldaten, die er in Avesnes getroffen hatte. Diese konnten jedoch noch während der Kämpfe desertiert sein und aus Angst vor Strafe ihre Flucht mit dem Gerücht einer Niederlage bemäntelt haben. Nein, der Marschall musste sich selbst überzeugen und erteilte einem vertrauenswürdigen Offizier, Colonel Michelet, den Befehl, die Lage zu sondieren.
Davout brauchte noch nicht einmal einen Tag zu warten. Noch am Abend des 20. Juni bestätigte Michelet die Aussage des Adjutanten in allen Punkten. Davout war erschüttert und verlor für einen Augenblick die Fassung, dann fügte er sich in das Unvermeidliche. Verhielt es sich so, wie Michelet berichtete, galt es, sofort energische Maßnahmen zu ergreifen. Noch stand der Feind nicht in Frankreich, noch waren die Grenzfestungen unbezwungen. In seiner Funktion als Kriegsminister schickte der Marschall zwei telegrafische Depeschen zum Gouverneur von Lille und zum Generalkommandanten des 16. Militärbezirks, in denen er sie dazu aufforderte, ihre Plätze standhaft zu verteidigen und auf weitere Anweisungen zu warten. Dann begab er sich in den Élysée-Palast, wo der Ministerrat unter Joseph Bonaparte schon zusammengetreten war und der Bruder des Kaisers den Brief vorlas, den Napoleon ihm geschickt hatte. Der Rat war wie Davout geschockt. Einzig Polizeiminister Fouché behielt die Fassung, da die Niederlage ihm in die Karten spielte und er im Geheimen den Sturz Napoleons vorbereitete.
Joseph Fouché war der verkörperte Gegensatz zu Davout, weshalb ihn dieser aus tiefstem Herzen verabscheute. Seinen Feinden galt der schmächtige, äußerlich wenig einnehmende Polizeiminister als der geborene Opportunist und Intrigant. Die Ranküne war sein Metier, Verschwörungen und Bespitzelungen sein Lebenselixier. 1793 hatte er als radikaler Jakobinerführer für den Tod König Ludwigs XVI. gestimmt, dann Robespierre unterstützt, um diesen kurz darauf mit der bürgerlichen Opposition zu stürzen und aufs Schafott zu bringen. Während der folgenden Zeit des Direktoriums war Fouché zum Polizeiminister aufgestiegen und hatte sich mit dem korrupten Regime arrangiert. In einer weiteren Volte schloss er sich Napoleon Bonaparte an, der am 18. Brumaire 1799 gegen das Direktorium putschte und sich selbst zum 1. Konsul der Republik ernannte. In den folgenden Jahren des Konsulats und des Kaiserreichs hatte Fouché Napoleon als Polizeiminister gedient, bis er Hochverrat beging und mit England Geheimverhandlungen führte, was ihm die Verbannung auf seine Güter einbrachte.
Danach war es lange Zeit still um ihn gewesen, bis Napoleon Fouché wieder begnadigte und ihm die Verwaltung Illyriens übertrug 3, wo er bis zur ersten Abdankung Napoleons blieb. In der folgenden Zwischenzeit der ersten Restauration hatte es Fouché nicht geschafft, ein wichtiges Amt zu bekommen. Erst als Napoleon Elba verließ und in Frankreich landete, war es ihm gelungen, die Gunst des Kaisers wiederzuerlangen. Doch zu seiner Enttäuschung hatte ihm Napoleon erneut nur das Amt des Polizeiministers in Aussicht gestellt, was den Ehrgeizigen sehr verbitterte, da er sich zu Höherem berufen glaubte.
Jetzt, nach Waterloo, witterte Fouché seine Chance, sich für all die durch Napoleon erlittenen Erniedrigungen zu rächen und den Despoten endgültig zu stürzen. Dies erforderte jedoch eiserne Verstellung und so gab sich der Altmeister der Intrige seinen Kollegen gegenüber zutiefst betrübt über die Niederlage von Waterloo. Scheinheilig kam er mit Davout und seinen Ministerkollegen darin überein, dass es besser sei, vorerst keine übereilten Schritte zu tätigen und die Ankunft Napoleons abzuwarten.
Dieser Beschluss, mit dem sich der Ministerrat selbst zur Untätigkeit verdammte, kam Fouché wie gerufen. Noch in derselben Nacht schürte er die Angst der Abgeordneten, indem er gezielt Gerüchte streuen ließ, dass Napoleon nach Paris käme, um die Kammern aufzulösen und die Diktatur auszurufen.
Dies konnten die Liberalen, allen voran der Marquis de Lafayette, nicht zulassen. Als der Morgen dämmerte, waren er und seine Gefolgsmänner bereit, sich dem Kaiser zu stellen und im Sinne Fouchés jene historischen Entscheidungen zu treffen, die letztendlich zur Entmachtung Napoleons führen sollten.
Der Kaiser kam um 9 Uhr völlig erschöpft und ausgelaugt in einer schäbigen zweispännigen Kalesche in Paris an. Napoleon, so viel wurde auf den ersten Blick klar, war nur noch ein Schatten seiner selbst und stand körperlich wie seelisch kurz vor dem Zusammenbruch. Schwer atmend, mit wächsernem Gesicht, stieg er aus dem Wagen. Keuchend quälte er sich die Treppen des Palastes hoch, wo er von seinem Außenminister Caulaincourt empfangen wurde. Seine einst durchdringenden blauen Augen waren leblos, der Blick stumpf. Mit brüchiger Stimme befahl er den Lakaien, ihm ein Bad zu bereiten. Dann beklagte er sich lauthals bei seinem Außenminister über den Verlauf der verlorenen Schlacht, bis er sich der erneuten Hoffnung hingab, mithilfe der beiden Kammern eine neue Armee zu erschaffen.
Читать дальше