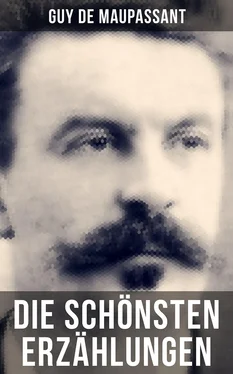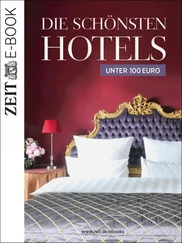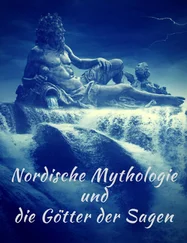1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 Sobald der Tag anbrach, wachte der Mann auf. Der Schwiegervater lebte noch immer! Er schüttelte seine Frau, unruhig über das lange Leben des Alten.
– Sag mal Du, Phemie, das will nich alle werden, was meenste denne?
Er wußte, sie hatte immer guten Rat bei der Hand. Sie antwortete:
– Nu, den Tag überlebt er doch nich, das ist mal sicher! Mir brauchen keene Angst zu haben. Wenn der Vorstand nischt dagegen hat, kann man ihn doch morgen begraben. Beim alten Renard war’s ooch nich anders.
Das leuchtete ihm ein, und er ging auf’s Feld. Seine Frau setzte die Äpfel zum schmoren auf, dann besorgte sie alle Arbeit auf dem Hof.
Mittags war der Alte immer noch nicht gestorben!
Die Tagelöhner, die für die Feldarbeit gemietet waren, kamen nun gruppenweise, um sich den Alten anzusehen, der noch immer die Erde nicht verlassen wollte. Jeder sagte etwas, dann gingen sie auf’s Feld hinaus.
Als man um sechs Uhr heimkehrte, atmete der Alte noch immer!
Nun erschrak sein Schwiegersohn doch:
– Phemie, was meenste denn jetzt?
Sie wußte nicht, was sie thun sollte. Sie gingen zum Vorstand. Der versprach, er wollte ein Auge zudrücken und trotzdem das Begräbnis morgen erlauben. Der Arzt, zu dem sie dann gingen, hatte auch nichts dagegen, und Frau und Mann kehrten ruhig heim.
Sie legten sich zu Bett und schliefen wie am Tage vorher, indem ihr starker Atem sich mit dem schwachen des Alten mischte.
Als sie erwachten, war er noch immer nicht tot!
Nun waren sie ganz verzweifelt. Am Fußende des Bettes blieben sie stehen und betrachteten mißtrauisch den Alten, als hätte er sich über sie lustig machen,sie betrügen, sie gradezu ärgern wollen. Vor allen Dingen waren sie ihm gram wegen der Zeit, die er sie verlieren ließ.
Der Schwiegersohn fragte:
– Nu, was soll denn nu werden?
Sie wußte sich keinen Rat und antwortete:
– Fatal ist’s!
Man konnte ja jetzt die Eingeladenen, die bald kommen mußten, nicht wieder ausladen. Man entschloß sich also, zu warten und ihnen die Sache auseinander zu setzen.
Zehn Minuten vor zehn erschienen die ersten, die Frauen in schwarz mit langen Schleiern und trauriger Miene; die Männer etwas verlegen in ihren Tuchjacken, näherten sich freier zu zweit neben einander und sprachen von Geschäften.
Der Bauer und seine Frau empfingen sie ganz verstört und verzweifelt, und beide begannen plötzlich im gleichen Moment, als sie an die ersten herankamen, zu weinen. Sie erzählten, was da vor sich ging, ihre große Verlegenheit, boten Stühle an und entschuldigten sich. Sie setzten auseinander, jeder andere hätte es genau so gehalten, wie sie, redeten endlos und wurden plötzlich ganz schwatzhaft, um nur niemand zu Wort kommen zu lassen.
Sie gingen von einem zum andern:
– Das hätte doch keiner gedacht, der hat eene Lebenskraft, das gloobt niemand!
Die Gäste waren ein wenig erstaunt und verlegen, wie Leute, denen eine erwartete Festlichkeit entgeht, und sie wußten nicht, was sie thun sollten. Sie blieben, sitzen, oder standen herum, ein paar wollten wieder fortgehen, aber der Bauer hielt sie zurück:
– Na ä Stickel Brot werden mer doch essen, mir hatten Äppelklöße gemacht, die müssen nu doch gegessen werden!
Die Gesichter hellten sich bei dieser Aussicht auf, man begann leise zu sprechen. Allmählich füllte sich der Hof mit Leuten; die, die zuerst da waren, erzählten die Geschichte den neuen Ankömmlingen, man tuschelte, der Gedanke an die Äpfelklöße aber erfüllte alle mit Freude.
Die Frauen kamen herein, um sich den Sterbenden anzusehen, sie bekreuzten sich am Bett, stammelten ein Gebet und gingen wieder hinaus. Die Männer waren weniger auf dieses Schauspiel erpicht und warfen nur einen Blick durch das Fenster, das offen stand. Frau Chicot erzählte von dem Todeskampf:
– Zwee Tage ist er nu schon so, nich mehr und nich weniger. Nich lauter geht’s und nich schwächer. ‘s is, wie eene Pumpe, die kee Wasser hat.
Als alle den Sterbenden gesehen hatten, dachte man an das Essen, und da es zu viele Menschen waren, als daß sie alle in der Küche Platz gehabt hätten, setzte man den Tisch vor die Thür, die vier Dutzend goldenen appetitlichen Äpfel zogen die Blicke auf sich.
Sie standen auf zwei großen Schüsseln, jeder streckte den Arm aus, um schnell einen zu nehmen, in der Furcht, es könnte nicht genug geben; aber es blieben noch vier übrig.
Der Bauer meinte, indem er mit vollem Munde kaute:
– Ach, wenn der Vater uns hier essen sähe, dem käm’s schwer an, der aß sie vor sein Leben gern. Ein alter, jovialer Bauer erklärte:
– Na, der ißt nu keene mehr, jeder kommt mal dran!
Diese Äußerung, statt die Gäste traurig zu stimmen,, schien sie nur zu erfreuen, sie waren froh, daß sie dran waren, die Klöße zu essen.
Frau Chicot war außer sich über die Ausgabe, sie lief unausgesetzt an das Apfelweinfaß, die Gläser leerten sich immerfort.
Jetzt lachten sie alle, man redete immer lauter und begann bald zu schreien, wie bei allen Mahlzeiten.
Plötzlich erschien eine alte Bäuerin, die beim Sterbenden geblieben war, in der entsetzlichen Angst vor diesem Ende, das ihr bald selbst bevorstand, am Fenster und rief laut und gellend:
– Er ist weg! Er ist weg!
Alle schwiegen, die Frauen erhoben sich schnell, um ihn zu sehen. In der That, er war tot. Das Röcheln hatte aufgehört.
Die Männer blickten sich an, schlugen die Augen nieder, ihnen war doch unwohl zu Mut, sie hatten noch ihr Essen im Mund. Der Kerl hatte den Moment wirklich schlecht abgepaßt.
Die Chicot’s weinten jetzt nicht mehr, es war aus, jetzt waren sie ruhig, und sie sagten:
– Na, das haben wir doch gleich gewußt, lange konnte es nich dauern. Wenn er sich nur die Nacht ‘n bißchen gerappelt hätte, hätten wir nich all die Unannehmlichkeiten gehabt!
Ach was, nun war es aus; Montag würde er begraben werden, und bei der Gelegenheit aß man eben noch mal Äpfelklöße.
Die Gäste gingen davon, schwatzten über die Sache, ganz glücklich, ganz zufrieden, daß sie das erlebt und was zu essen gekriegt hatten.
Und als Mann und Frau allein sich gegenüberstanden, sagte sie mit vor Entsetzen verzerrtem Gesicht:
– Nu müssen mir nochmal vier Dutzend machen, er hätte sich weeß Gott die Nacht dazuhalten können!
Und der Mann antwortete etwas resignierter:
– Jeden Tag könnten mir uns das nich leisten!
Inhaltsverzeichnis
Er hieß allgemein in der Gesellschaft der schöne Signoles. Sein Name war Vicomte Gontran Josef de Signoles. Ohne Eltern und im Besitz eines genügenden Vermögens, spielte er eine Rolle, wie man zu sagen pflegt.
Er hatte gute Manieren, ein angenehmes Äußere und wußte sich leicht auszudrücken, so daß man glaubte, er wäre ein gescheiter Kerl; er besaß eine gewisse natürliche Gracie und den Schein von Vornehmheit – Stolz, einen schönen Schnurrbart und ein schmachtendes Auge, Dinge, die den Weibern gefallen.
In den Salons war er gern gesehen, ein gesuchter Tänzer, und den Männern flößte er jene Scheu ein, die man Leuten gegenüber empfindet mit einem besonders energischen Aussehen.
Ein paar Liebschaften wurden ihm nachgesagt, die ihm einen gewissen Junggesellen-Ruf einbrachten: er lebte fröhlich, ruhig dahin im völligen Gleichgewicht. Man wußte, daß er ein guter Fechter war und noch besser Pistole schoß.
- Wenn ich einmal ein Duell kriegen sollte - pflegte er zu sagen, - würde ich Schußwaffen wählen, denn ich bin meines Schusses sicher.
Eines Abends hatte er zwei junge Frauen seiner Bekanntschaft, die übrigens in Gesellschaft ihrer Männer waren, ins Theater begleitet und bot ihnen nachher ein Eis bei Tortoni an.
Sie waren schon einige Minuten da, da sahen sie einen Herrn an einem der Nebentische, der unausgesetzt die eine seiner Nachbarinnen anstarrte. Sie schien das zu stören, sie wurde unruhig und senkte den Kopf. Endlich sagte sie zu ihrem Mann:
Читать дальше