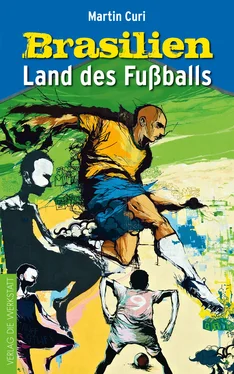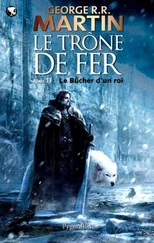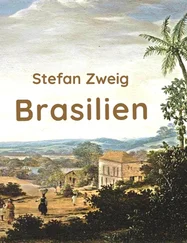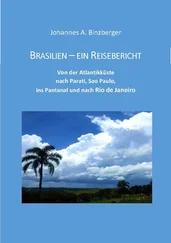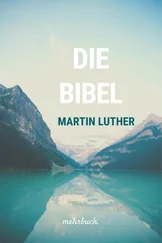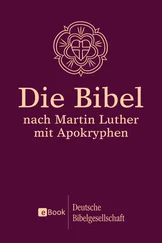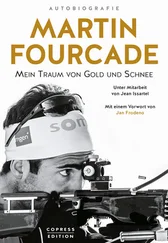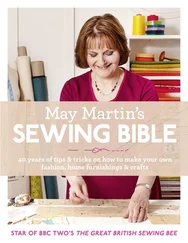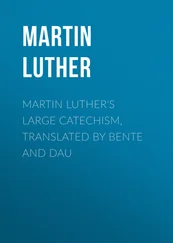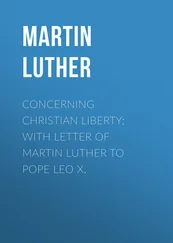In der brasilianischen Gesellschaft schlug die Stimmung anschließend jedoch um. Der Schriftsteller Nelson Rodrigues beschrieb die Situation so: „Jedes Volk hat sein Hiroshima. Unseres ist der 16. Juli 1950.“ Der Mythos 1950 ging als größte Katastrophe in die Geschichte Brasiliens ein, die immer wieder neu erzählt wurde. Unzählige Bücher, wissenschaftliche Arbeiten und Filme zum Thema wurden veröffentlicht.
Eines der besten Bücher ist Perdigãos „Anatomie einer Niederlage“. Der Autor stellt das Spiel in allen Einzelheiten dar, analysiert es von verschiedenen Seiten und transkribiert den kompletten Radiokommentar. Es enthält auch eine poetische Aufarbeitung der Ereignisse: Der Autor stellt sich vor, er hätte eine Zeitmaschine und könnte nach 1950 zurückreisen, um die Geschichte zurechtzubiegen. Er sieht sich als kleiner Junge mit seiner Familie im Stadion. Er erkämpft sich seinen Weg zum Spielfeldrand, vorbei an den Sicherheitsbeamten, die wegen des Torjubels unaufmerksam sind. Als Gigghia aufs Tor zurennt, schreit der Junge Barbosa zu: „Ins kurze Eck! Ins kurze Eck!“ Doch genau diese Schreie verunsichern Barbosa so, dass er erneut das Tor kassiert.
Der Autor macht sich gewissermaßen selbst dafür verantwortlich, dass Brasilien verliert. Die Botschaft ist: Wir, als Volk, haben versagt. Unsere (weißen, europäischstämmigen) Politiker haben die WM geholt, das schöne Maracanã gebaut und so die Voraussetzungen für den Sieg geschaffen. Aber die (farbigen) Volksvertreter auf dem Platz haben versagt, und somit hat das ganze Volk versagt.
Der Mythos 1950 treibt völlig absurde Blüten. So habe ich ein Kinderbuch mit dem Titel „So entstand das Maracanã“ gefunden, das mit kindgerechten Illustrationen eine ähnliche Geschichte wie Perdigão erzählt: Ein Bauarbeiter ist Teil einer Firma, die das Stadion errichtet. Am Finaltag nimmt er die ganze Familie mit, um das Spiel im Maracanã zu sehen. Doch Brasilien verliert. Wie kann es sein, dass sich ein Volk immer wieder selbst eine so traurige und selbstzerstörerische Geschichte erzählt? Sogar den Kindern wird sie schon eingetrichtert.
Es ist schwierig, Bücher über die fünf brasilianischen WM-Siege zu finden. Zu den Niederlagen, speziell 1950, hingegen gibt es Publikationen wie Sand am Meer. Unter dem Titel „Tragödien, Schlachten und Versagen“ widmet sich Pacheco sogar ausschließlich den Niederlagen zwischen 1950 und 1982 und lässt damit die drei ersten WM-Titel aus. Der Versagenskult nimmt bisweilen bizarre Züge an.
Nach dem Endspiel 1950 begann die Suche nach den Schuldigen. Die involvierten Politiker distanzierten sich rasch wieder von der Nationalmannschaft. Trotzdem wurde Präsident Dutra nicht wiedergewählt, und Vargas kehrte zurück ins höchste Amt des Staates. Weitaus schlimmer erging es Stadionverwalter Herculano Gomes, der nie mehr in seinem Beruf Fuß fassen konnte und bis an sein Lebensende Korruptionsvorwürfe zurückweisen musste.
Die Spieler der Nationalmannschaft wurden ebenso abgestraft. Sie waren in der Seleção fortan unerwünscht. Nur fünf der Spieler, die 1950 gegen Uruguay auf dem Platz gestanden hatten, schafften es in den Kader der WM 1954, bei der sie dann nur Ersatzspieler waren. Am härtesten traf es Torwart Barbosa, der zu einer Persona non grata wurde. Im Jahr 2000 sagte er in einem Interview: „In Brasilien beträgt die Höchststrafe 30 Jahre, ich leide nun schon 50.“ 1963 wurden die Torpfosten des Maracanã ausgetauscht. Das hölzerne und viereckige Gebälk wurde durch ein modernes und rundes aus Kunststoff ersetzt. Die Stadionverwaltung kam dabei auf die absonderliche Idee, die alten Pfosten Barbosa als Andenken zu schenken. Dieser nahm das Geschenk an und nutzte das Holz für einen Grillnachmittag. Er versuchte also der Tragödie Herr zu werden, indem er die Pfosten verbrannte. Barbosa wurde so zum umgekehrten Aschenputtel: Nicht aus der Asche zum Ruhm, sondern vom Ruhm in die Asche ging er seinen Weg.
Der Sündenbock Barbosa hatte eine hohe symbolische Bedeutung, denn er war einer der schwarzen Spieler im Team. Die weiße Elite hatte sich schnell gefangen und schob die Schuld der dunkelhäutigen Unterschicht in die Schuhe. Barbosa wurde zur Galionsfigur der nationalen Schande.
Diese Argumentationslinie wurde auch bei der darauf folgenden WM 1954 in der Schweiz deutlich. Brasilien reiste diesmal ohne große Ambitionen an und stand noch sichtlich unter Schock. Trotzdem wurde die Vorrunde relativ problemlos überstanden. Im Viertelfinale traf man auf den späteren Finalisten Ungarn. Dieses Spiel ging als die Schlacht von Bern in die Geschichte ein. Schon auf dem Feld kam es zu ersten Prügeleien. Nach drei Platzverweisen (zwei für Brasilien, einer für Ungarn) gewann Ungarn mit 4:2. Nach dem Schlusspfiff gingen die Auseinandersetzungen in den Kabinengängen weiter.
Diese Ereignisse analysierte der Unternehmer, Politiker und selbsternannte Soziologe João Lyra Filho in seinem Buch „Einführung in die Soziologie des Sports“. Er stammte aus einer reichen Landbesitzerfamilie im Nordosten Brasiliens und gelangte durch Beziehungen in Schlüsselpositionen des öffentlichen Lebens. Seine Soziologie folgt nicht den unabhängigen Regeln der Wissenschaft, sondern ist ein Manifest, das die Minderwertigkeit des brasilianischen Volks beweisen soll.

Die Verkörperung brasilianischer Fußballkünste: Pelé und Garrincha.
Lyra charakterisiert das brasilianische Volk als unreif, überemotional und undiszipliniert. Das habe man auch anhand der Nationalmannschaft erkennen können, deren Spieler ihre Gefühle nicht im Griff hatten und die deshalb den Ungarn unterlegen gewesen seien. Diese Wesenszüge seien auf die Rassenmischung zurückzuführen. Im Gegensatz dazu hätten die Ungarn ihre europäische Kultur, Kontrolle und Rationalität gezeigt. Lyra ging sogar so weit, den ungarischen Spielern Universitätsdiplome zu unterstellen. Dagegen hätten die ungebildeten Brasilianer natürlich keine Chance gehabt, denn während die Ungarn rational überlegen seien, würden die Brasilianer nur ihrem Instinkt folgen. Lyra selbst sieht sich dabei nicht als Teil des brasilianischen Volkes, sondern als Teil der gebildeten Europäer.
Die 20 Jahre, die der Schlacht von Bern folgten, sollten zu den erfolgreichsten der brasilianischen Fußballgeschichte werden. Von den vier darauffolgenden Weltmeisterschaften gewann man drei und schied nur 1966 in England bereits in der Vorrunde aus. Dabei wurden genau die Eigenschaften, die von Lyra gegeißelt wurden, nun als Stärken interpretiert: Improvisation, spielerisches Instinkthandeln und Emotionen statt kühler Berechnungen.
Aushängeschild dieser neuen Spielweise wurden vor allem zwei Spieler: Garrincha und Pelé. Ersterer spielte 1958 und 1962, Letzterer von 1958 bis 1970 bei gleich vier Weltturnieren. Wenn die beiden gemeinsam auf dem Platz standen, haben sie nie ein Spiel verloren.
Garrincha, eine der großen mythischen Gestalten des Weltfußballs, wurde 1933 als Manoel Francisco dos Santos in Pau Grande, im Hinterland von Rio de Janeiro, geboren. Hauptarbeitgeber in seinem Geburtsort, dessen Name mit „Großer Penis“ übersetzt werden könnte, war eine englische Textilfabrik, in der fast alle Männer des Dorfes arbeiteten. Auch Garrincha unterschrieb dort mit 14 Jahren seinen ersten Arbeitsvertrag und kickte bald in der Betriebself. Dort wurde man auf sein Talent aufmerksam, und so bekam er Arbeitserleichterungen, um seine Kräfte für die Spiele zu schonen. Er wird oft als der unbekümmerte Junge vom Land beschrieben, der seine freie Zeit damit verbrachte, dem Ball oder den Tieren des tropischen Regenwalds nachzujagen. Daher auch sein Spitzname Garrincha: Strohschwanzschlüpfer, ein kleiner, brasilianischer Vogel. Bald fand der junge Fabrikarbeiter aber auch Gefallen an der Jagd auf das andere Geschlecht. Seine Eroberungen wurden legendär.
Читать дальше