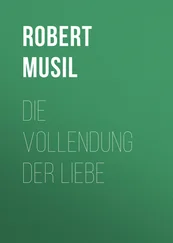Die elf Scharfrichter, die das Treiben der „Überbrettlhyäne“, wie sie ihren Konkurrenten getauft, bisher mit hohnvoller Überlegenheit verfolgt, spürten nun den Sieg ihres Feindes auf der ganzen Linie.
Im letzten Augenblick, kurz, ehe die so viel versprechende Vorstellung beginnen sollte, zeigte die Diva telegraphisch aus Hamburg an, dass sie nicht mehr rechtzeitig zu diesem Abend eintreffen konnte.
Der Direktor, der schon die letzte Stunde in fiebernder Erwartung verbracht und kaum mehr das kleine Loch am Vorhang verliess, durch das man das fröhlich schnatternde Publikum beobachten konnte, geriet ausser sich. Die Verlegenheit war nicht zu verbergen, denn es fehlte an und für sich schon an guten weiblichen Gesangskräften.
Mie hörte kaum von der Verlegenheit Valliers, da erbot sie sich, einzuspringen. Sie hatte des öfteren ihre niedliche, kleine Stimme erprobt.
Ihr Ehrgeiz, zum Brettl überzugehen, war alt, aber der Direktor wies sie barsch ab, der Kapellmeister lachte sie aus.
Mie liess sich nicht irre machen.
Sie folgte weder einer Überzeugung noch einer Laune, als sie an ihrer Begabung für das Überbrettl festhielt. Sie gehorchte einfach einem Instinkt. Dieser Spürsinn war in Mie in seltener Weise entwickelt, so sehr, dass er sie auch späterhin stets in das rechte Verhältnis zu den Aussendingen stellte und ihr in entscheidenden Momenten eingab, was die Klugheit erforderte.
Auf diese Weise kam Mie in den Verdacht eines besonderen Raffinements, während sie in Wahrheit bloss ein Triebleben führte. Doch war dieser Instinkt, ein hereditäres Erbteil aus Urzeiten her, so stark in ihr, dass sie geradezu mit einem prophetischen Spürsinn ausgestattet war.
Sie hatte sich vor Wochen von einem halbverhungerten Komponisten einen kleinen Singsang für einige Taler gekauft. Voll Aufregung lief sie in die kleine Künstlerkneipe zur Sonne, wo das verkommene Genie verkehrte, und liess sich das Chanson in einer schmierigen Nebenstube einstudieren. Atemlos kam sie zur Vorstellung zurück und wiederholte ihr Begehren, sie statt der ausgebliebenen Sängerin auftreten zu lassen.
Der Direktor sagte in seiner Verzweiflung zu.
Der Anfang des Abends war nicht sonderlich verheissend. Er spielte va, banque, gab schon nach der vierten Nummer, die gänzlich abfiel, seine Sache verloren und konnte auch von Mie nicht mehr Schlimmeres erwarten, als was ihm ohnedies bevorstand. —
Der Kapellmeister bat alle Grazien um Vergebung, als er sich endlich dazu entschliessen musste, Mie, die nicht einmal Lampenfieber hatte, zu begleiten. Da sie keine passende Toilette besass und keine ihrer Kolleginnen sich bereit erklärte, ihr ein Kostüm zu leihen, Mie aber, vom Fieber des Ehrgeizes erfasst, unter keinen Umständen nachgeben wollte, so trat sie in ihren fleischfarbenen Trikots auf, deren Schlachthauswirkung sie durch einen Flittermantel zu mildern suchte. Zum Überfluss setzte sie einen grauen Zylinder auf, den ihr Chanson, das irgendeine Eindeutigkeit aus dem Gebiete der Reiterei behandelte, rechtfertigen sollte.
Das Publikum war erst über den geschmacklosen Aufzug verdutzt, dann brach es in ein mitleidloses Gelächter aus. Aber die Kindlichkeit der Erscheinung, die in einer Atmosphäre der Sinnlichkeit aufging, erregte bald Befremden, allmählich Interesse und nahm schliesslich gefangen.
Nun begann Mie mit ihrer ungeschulten Stimme zu singen. Es war kein Singen, sondern ein Zwitschern, das nervenerregend sich in die Sinne stahl und dort in dunklen Tiefen ein zitterndes Echo weckte.
Augenblicklich wurde es still. Die Augen der jungen Männer glänzten dunkel. Man horchte; das gab Mie, die erst schon dem Weinen nahe war, neuen Mut. Mit Mischung von Naivität und Lasterhaftigkeit, die der Inbegriff ihres Lebens und ihrer Gefühle war, sang sie ihr dummes, freches Chanson zu Ende, in dem der abgeschmackte Refrain immer wiederkehrte: „Das Reiten, das ist mein Vergnügen.“
Dabei lächelte sie, halb ungeschickt, halb berechmend, das hell-laute Lachen eines Kindes und das tiefe, lüsterne Lächeln einer Dirne, das süsse Mundspitzen der Unschuld und das breite Versprechen des Lasters, ein Lächeln, das unbeschreiblich widerspruchsvoll, vielartig, schillernd, dunkel und tief war, wie eben Mie selber einen Zusammenhang der verschiedensten Leidenschaften bildete, die langsam ihre Akkorde anschlugen, ehe sie zu machtvollen Tönen wurden, die den jungen Leib durchzitterten. Als sie geendet, klatschten sich die Studenten in einen Rausch des Beifalls. Das Publikum, selbst die Frauen, auf welche dieses Kind mystisch erregend wirkte, wurden mitgerissen.
Sie sah sich veranlasst, noch eine Zugabe zu gewähren und taumelte schliesslich glückstrahlend, zu Tode erschöpft, hinter die Kulissen, wo der Direktor sie in den Armen auffing. Sie hatte den Abend gerettet. Er küsste sie im Enthusiasmus der Dankbarkeit und schalt sich im stillen einen Toren, der dieses Talent, diese Wunderblume nicht gleich entdeckt und beinahe gewaltsam unterdrückt hatte.
Der Kapellmeister kam herbei und drückte Mie die Hände. „Sie sind ein Stern,“ stammelte er. „Wir werden etwas aus Ihnen machen ... Sie brauchen nur noch das grosse Repertoire und eine schmeichelnde Musik ...“
„Und eine Regie, die aus diesem geschmeidigen Talent hervorholt, was noch verborgen schlummert,“ setzte der Direktor mit einem halben Lächeln hinzu.
Mie enteilte in ihre Garderobe, nicht ohne mit überlegenem Triumph einige hasserfüllte Blicke von Kolleginnen aufzufangen.
„Was sagen Sie?“
Kapellmeister und Direktor sahen sich an.
Vallier gab ein neues Klingelzeichen. Unter dem nachhaltigen Eindruck Mies gefielen auch die anderen Attraktionen. Aber in jeder Pause, die zwischen den einzelnen Nummern entstand, verlangten einige kecke Studenten von neuem nach Mie.
„Sie wird morgen berühmt sein.“
„Wir müssen ein eigenes Repertoir für sie schaffen.“
„Sehr richtig. Ein Schlagwort, das durch alle Gassen klingt. Das wie eine Fanfare ihre Erscheinung, ihre Eigenart, ihr Demiviergetum ankündigt. Sie werden die Musik schreiben. Aber wer schafft uns für diese Kraft das Chanson?“
Der Kapellmeister schlug Namen vor ... Namen ... der Direktor schüttelte den Kopf. Plötzlich:
„Ich hab’s! Dieser oder kein anderer.“
Am nächsten Tage sprach man in den Kreisen, die den Nächten pikante Sensationen ablauschen, von nichts anderem als von Mie. Man wusste eigentlich nichts Bestimmtes von ihr zu sagen. Man konnte nicht behaupten, dass sie gut sang, noch weniger, dass sie gut vortrug. Man wusste nicht, sollte man sie schön oder hässlich, lasterhaft oder naiv nennen, aber man sprach, und gerade das verlegene, doch überquellende Stammeln in dem öffentlichen Urteil machte auch andere neugierig. —
Direktor Vallier klopfte am nächsten Morgen in einer stillen Hinterstube eines alten Hauses in der Amalienstrasse an. In einem mit Papieren und Büchern, mit Folianten und alten Stichen vollgepfropften Zimmer, das durch den uralten Lehnstuhl noch trödlermässig aussah, sass vor einem Riesenschreibtisch, im Angesicht eines alten Lindenbaumes, der durchs offene Fenster lugte, ein hagerer junger Mann mit slavischem Typ und schrieb:
Das war der kaum mehr als zwanzigjährige Herausgeber des „Eselspiegels“, einer radikalen Zeitschrift unsicherer, aber jedenfalls ungemein freier Tendenz, eines Blattes, das gleich einem feurigen Schwert alle tollen Einfälle der Sturm- und Drangperiode eines kleinen, leidenschaftlichen Dichter- und Malerkreises ins Publikum trug und wie die Posaunen vor Jericho gegen die festgefügtesten Mauern der gesitteten Gesellschaft Sturm blies. Es war ein Risiko, gerade den Herausgeber des „Eselspiegels“, der noch drei ähnliche Zeitschriften leitete und über dem beständig das Damoklesschwert der Staatsjustiz schwebte, als den berufensten Dichter für Mie gewinnen zu wollen. Aber Direktor Vallier hatte einen sicheren Blick für Gegensätze, die sich ergänzen. Und er war seit dem gestrigen Abend entschlossen, alles zu riskieren, literarische Beachtung zu erringen um jeden Preis, die Konkurrenz niederzurennen, selbst auf die Gefahr hin, die eigene Existenz bei dem Unternehmen einzubüssen.
Читать дальше