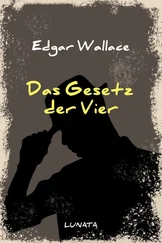Printheer nickte.
„Dann kommen zwei Institute in Betracht. Das eine ist das Staatliche Forschungslaboratorium, dem Sie, Herr Konsul, als Ehrendoktor angehören. Das andere ist das Universitätsinstitut. Die intensivere Arbeit ließe sich am Staatlichen Institut ermöglichen.“
„Einverstanden.“
„Wie hoch gedenken Sie die Stelle zu dotieren?“
„Machen Sie mir einen Vorschlag.“
„Ich denke, ein junger Mensch, der wirklich unbeschwert arbeiten soll, müßte wenigstens dreihundert Mark Gehalt bekommen.“
„Sagen wir vierhundert.“
„Damit allein ist es noch nicht gemacht, Herr Konsul. Krebsforschungen bedingen einen großen Verbrauch an Versuchsmaterial. Und der Etat des Instituts ist in diesem Jahre schon um dreitausend Mark überschritten worden. Aus diesem Grunde sind besondere Sparmaßnahmen bereits verfügt worden.“
„Bedauerlich! Wie hoch ist der gesamte Materialetat für diese Abteilung?“
„Immerhin fünfundzwanzigtausend Mark, Herr Konsul.“
„Moment“, Printheer griff zum Hörer, „soziale Abteilung! Bitte, die Aufstellung über Dotationen an wissenschaftliche Institute. Wie hoch ist mein jährlicher Beitrag zum Staatlichen Forschungsinstitut?“
„Fünftausend Mark“, hörte er durchs Telephon.
„Machen Sie Vermerk, wird mit Wirkung vom Ersten ab verdoppelt. Genügt’s Ihnen, Herr Ministerialrat, für unsere Zwecke?“
„Mehr als genügend, Herr Konsul.“
„Natürlich wünsche ich, daß der Mehrbetrag vorzugsweise der Krebsforschungsabteilung zur Verfügung steht. Würden Sie nun doch die Freundlichkeit haben, mir zu sagen, auf welchem Weg man der jungen Forscherin die Anstellung verschaffen könnte, ohne daß sie im geringsten merkt, daß sie begünstigt wird?“
„Das stelle ich mir sehr einfach vor. Wir teilen dem Akademischen Arbeitsamt mit, daß eine solche Stelle frei ist. Ich wette neunundneunzig zu hundert, daß sich die junge Dame bewerben wird. Das übrige lassen Sie meine Sorge sein.“
„Gemacht, Herr Ministerialrat.“
Ein paar Tage später kam Agnete, wie täglich, in das Studentenwerk, um nach Arbeitsvakanzen zu fragen. Vor dem Schwarzen Brett stieß sie auf Wolfgang Rautenberg.
„Komm mal her, Agnete“, sagte der. „Hör mal, was hier steht: Staatl. Forschungsinstitut, Abteilung für Krebsforschung. Die neu geschaffene Stellung eines Assistenten (Assistentin) soll sofort besetzt werden. Gehalt vierhundert Mark monatlich, Privatpraxis nicht gestattet. Dienststunden neun bis drei. Bewerbungen mit Lebenslauf an das Kultusministerium, Abteilung Medizinalwesen, Personalreferenten.
Na, Agnete, wäre das was?“
Agnetes blasses, bedrücktes Gesicht spannte sich, erleuchtete sich förmlich von innen her:
„Ob das was wäre? Ach, Wölfchen, ich weiß nicht, ob du das schon begreifen kannst. Du bist ja auch noch nicht soweit. Bist wohl auch ganz auf das praktische Arztsein eingestellt. Aber ich? Zu denken, daß man wieder forschen könnte? Einem Ziele nach, das vor einem steht, das einen ruft, immerfort ruft. Und zu dem man nicht kommen kann, weil diese ekelhafte Armut dazwischensteht. Arbeiten können, wie man möchte: Laboratorium, Mikroskope, Versuchsmaterial —“, sie zuckte die Schultern, „ach, was hat’s für einen Sinn, Luftschlösser zu bauen. Glaubst du, diese gebratene Taube wird gerade mir in den Mund fliegen? Da mache ich mir keine Hoffnung. Für unsereinen gibt’s ja so was doch nicht.“
„Warum eigentlich nicht?“
„Frag doch nicht so dumm. Hast du vielleicht Protektion oder ich? Na also.“
Fritz machte einen wütenden Lufthieb:
„Protektion! Immer Protektion. Das ist, um an den Wänden hochzugehen! Und daß du summa cum lande über den Krebs gearbeitet hast, ist das gar nichts? Den einen Erfolg müßte es doch wenigstens haben, daß du in die engere Wahl kommst!“
„Ach, du dummes Wölfchen! Ich bin doch nicht größenwahnsinnig. Bestimmt sitzt da irgendwo jemand, der die Stellung schon im voraus sicher hat, noch ehe sie überhaupt ausgeschrieben war. Die Ausschreibung erfolgt doch nur pro forma, um der Vorschrift zu genügen.“
„Wenn du von vornherein so mutlos bist, meine Teure, dann wird es natürlich nichts. Bewirb dich doch mal, und wenn es nur aus Trotz ist. Mal sehen, welcher Bonze dir vorgezogen wird.“
„Schade um Briefpapier und Porto, mein Junge.“
„Porto ist nicht nötig. Wir geben den Brief persönlich beim Ministerium ab, und zwar sofort. Du kommst jetzt mit mir herunter in die Kantine und schreibst das Bewerbungsschreiben.“
„Schrecklich energisch bist du, Wolf“, seufzte Agnete. Aber sie ließ sich heut nur zu gern führen. Wolfgang hatte recht. Versuchen mußte man es, schon damit man sich hinterher nicht den Vorwurf zu machen brauchte, eine Chance nicht genutzt zu haben.
Sie gingen zum Ministerium und gaben den Brief ab.
Wolfgang machte drei Kreuze hinter dem Sekretär her, der ihnen mit einem unwirschen Blick über die verrutschte Brille das Schreiben abnahm.
„Er ruhe sanft“, sagte Wolfgang salbungsvoll. „Hören werden wir wohl nichts mehr weiter.“
„Ein ekelhafter Kerl bist du, Wölfchen, erst putschst du mich auf und dann läßt du mir nicht einmal ein paar Tage Hoffnung.“
„Mit der Hoffnung ist nichts zu erben, Agnete. Hättest du nicht lieber dem Ministerialrat persönlich um den Bart gehen sollen? Sicherlich würde er so entzückt von dir sein —“
„Bei ernsthaften Männern habe ich kein Glück! Allenfalls bei so jungem Gemüse wie du bist. Schade, daß du noch keine Assistentenstellungen zu vergeben hast.“
„Na, und dein Printheer? Dem würde es vielleicht nur ein Wort kosten und du bekämst die Stellung.“
„Kommt nicht in Frage“, sagte Agnete heftig.
„Und warum nicht?“
„Weil ich nicht will.“ Es kam hart heraus. Agnete dachte an den Scheck, den Printheer ihr geschickt. Aber davon wollte sie Wolf nichts erzählen. „Lieber hungere ich mich weiter durch.“
„Versteh’ einer die Frauen! Ich, wenn ich einen solchen Krösus kennen würde, dem würde ich den Revolver auf die Brust setzen: Stellung oder das Leben!“
„Eine Frau kann so etwas nicht, Wolfgang.“
Agnete sagte es ganz harmlos. Wolf Rautenberg sah sie wieder schnell an.
„Vielleicht nicht, Agnete.“
„Und was nun“, fragte Agnete. „Hast du was vor? Ich weiß nicht, mir ist so unruhig zumute. Töricht ist doch der Mensch. Da erlebt man seit Monaten einen Fehlschlag nach dem andern und jedesmal denkt man, diesmal wird’s keine Niete sein. Hast du Zeit für mich? Wollen wir noch ein bißchen zusammenbleiben?“
Agnete stellte diese Frage eigentlich nur, weil sie die Antwort schon vorauszuwissen glaubte. Denn wann hätte Wolfgang Rautenberg für sie keine Zeit gehabt? Er machte das Unmöglichste möglich, um mit ihr zusammen zu sein.
Aber diesmal sagte Wolfgang:
„Geht nicht, Agnete. Jetzt unmöglich.“
„Nanu, Wölfchen, Rendezvous? Auf Abwegen? Na, schadet nichts! Wird dir guttun. Wer ist denn die Auserwählte deines Herzens“, neckte Agnete.
Wolfgang machte ein komisch-beleidigtes Gesicht:
„Du sollst nicht an meiner Treue zu dir zweifeln, Agnete. Meine Auserwählte ist gar keine Auserwählte, sondern Doktor Nicola, der neue Privatdozent. Sein Kolleg heute möchte ich keinesfalls versäumen.“
„Nanu, Wölfchen, du noch Kolleg? Jetzt nach Toresschluß? Früher brachten dich doch keine zehn Pferde in ein Kolleg, das du nicht unbedingt belegen mußtest. Und jetzt, wo du mit dem Examen schon fertig bist?“
„Ja, Kolleg und Kolleg ist ein Unterschied, meine Teure. Dieser Nicola ist ein geradezu enormer Mensch. Da können unsere alten Bonzen einpacken. Was der alles ’rausknobelt, und wie der seine Entdeckungen begründet! Also ich sage dir, grün und gelb könnte man vor Neid werden, wenn man den Mann nicht so bewundern müßte. Und dabei eine Bescheidenheit! Gestern hat er erst im Beisein von Geheimrat Mannberg von der verzweiflungsvollen Krise der inneren Medizin geredet.“
Читать дальше