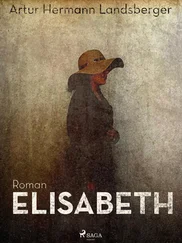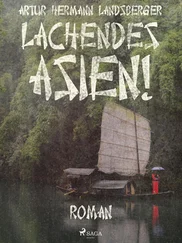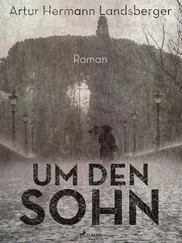„Aber das Kennertum hat doch auch seine Berechtigung“, erwiderte Katz.
„Wenn man Geschäfte damit macht,“ sagte die Baronin, „gewiss! für Juweliere. Für uns aber kommt allein der Affektionswert in Frage.“ — Sie gab ihrem Schwiegersohn ein Zeichen; er trat eilfertig an sie heran und reichte ihr den Arm. „Hier zum Beispiel“, sagte sie und wies auf den Glasschrank, zu dem der Rittmeister sie führte, „sehen Sie diesen Kardinalsring, verliehen von Sixtus dem Vierten im Jahre 1475, hat ein ...“ Plötzlich ging ein Ruck durch ihren Körper und sie hielt sich am Arme ihres Schwiegersohnes fest; dann hob sie die weissgepuderte Hand und wies auf den leeren Platz im Schrank, auf dem die Mantelschliesse gelegen hatte, wurde kreidebleich und sagte: „Wo ... wo ... ist denn ... der ... Ring?“
Katz trat dicht an Frau Ina heran und wies unauffällig auf seine Tasche, in der das Schmuckstück war. Die begriff sogleich und sagte:
„Ich habe Herrn Katz gebeten, den einen der Steine auf seine Echtheit hin zu prüfen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der eine Stein während unserer letzten Reise durch einen anderen ersetzt worden ist.“
„Zeigen Sie her!“ rief die Alte erregt und ging jetzt ohne Stütze auf Katz zu, der den Ring aus der Tasche zog, aber in der Hand behielt.
Die Frau Baronin prüfte genau mit der Lorgnette und erklärte:
„Ich lasse meinen weissen Kopf dafür: an diesem Stück ist alles genau so, wie es in meiner frühesten Kindheit war“ — und nun erzählte sie die Geschichte dieses Ringes, so wie sie von Mutter und Grossmutter ihr überkommen war.
Gerade, als sie den Ring wieder an ihre gewohnte Stelle legen wollte, meldete der Diener:
„Der Herr Graf v. Scheeler will sich verabschieden.“
Er trat zur Seite, und der Graf erschien auf der Schwelle. Er nahm von Katz keine Notiz, schritt auf die Baronin zu und ergriff ihre Hand, in der sie den Ring hielt. Er stutzte und sah Katz an.
Die Baronin erriet seine Gedanken.
„Wir waren in Sorge um die Echtheit eines Steines“, sagte sie. „Darum baten wir Herrn Katz“ sie stellte ihn dem Grafen vor — „der Kenner ist, ihn zu prüfen. — Gott Lob, er ist echt“ — und sie legte den Ring wieder in den Schrank.
Aber auch Katz wusste, was vorging. Der Glaube des Grafen, dass der Glanz dieses Hauses echt war, durfte nicht erschüttert werden. Er nutzte die Situation, gab Frau Ina ein Zeichen, zog ein Papier aus der Tasche, breitete es vor ihr aus, wies mit dem Zeigefinger auf eine bestimmte Stelle und flüsterte:
„Bitte!“
Mit zitternder Hand griff sie zur Feder und setzte ihren Namen unter das Papier. Sie sah nicht, was sie unterschrieb, aber die Hand in dem abgeschabten roten Glacé, die das Papier hielt, liess es sie fühlen.
Katz nahm hastig das Papier an sich und steckte es in die Tasche.
Der Graf war an Ina herangetreten, sie wagte nicht, ihn anzusehen.
„Also bis morgen“, sagte sie; ihre Stimme zitterte: „Wir reiten zusammen.“
Er nahm ihre Hand, die eben den Bordellvertrag gefertigt hatte, und küsste sie.
„Mit Vergnügen“, erwiderte er, verbeugte sich und ging. Und zu dem Rittmeister, der ihn hinausbegleiten wollte, sagte er in der Tür:
„Bitte, bleiben Sie!“
Als er draussen war, sank Frau Ina in den Sessel zurück und schloss die Augen.
„Ist dir etwas?“ fragte der Rittmeister besorgt.
Sie wies auf Katz und sagte schroff:
„Begleite den Herrn hinaus!“
Der war keineswegs gekränkt, überzeugte sich durch einen schnellen Griff in die Tasche, dass der Vertrag darin war, und ging.
Er war noch im Flur, da stürzte die Baronin auf ihre Tochter zu, riss sie aus dem Sessel, sperrte neugierig die Augen auf und fragte hastig:
„Nun, was ist? Was verlangt er? Zahlt er weiter oder weigert er sich? Was hast du da unterschrieben? Ich kann mir denken, es ist kein Glück, seine Geliebte zu sein. Aber, was willst du tun? Wir müssen leben! — Betrüg ihn! Schlag ihn! Bring ihn um! Aber handle vorsichtig und klug und mach mir keine Sorgen. — Wie ich ihm den Ring abgejagt habe! — Wer mir das gesagt hätte vor fünfzig Jahren, als ich in meiner Verliebtheit dem Herzog von Montfleury einen Korb gab, um deinen Vater zu heiraten.“
„Ach Mutter!“ seufzte Frau Ina.
„Was für ein Papier hast du da unterschrieben?“ drängte die Baronin.
„Ich weiss es nicht. Vermutlich einen Kontrakt.“
„Was für einen Kontrakt? — Um deinen Mann los und die Frau des Grafen Scheeler zu werden, musst du alles vermeiden, was dich nach aussen hin kompromittiert.“
Ina lachte spöttisch, sah die Baronin fest an und sagte:
„Ich werde ein Bordell übernehmen.“
„Ina!“ schrie die Baronin laut auf. „Hast du den Verstand verloren?“
„I Gott bewahre! Aber in dieser Form geht es nicht weiter. Statt zu Geld zu kommen, geraten wir nur immer tiefer in Schulden. Jetzt heisst es, endlich einmal Realpolitik treiben! Biegen oder brechen!“
Die Baronin sah entsetzt ihre Tochter an.
„Und ... auf ... die ... Art ... meinst ... du ...?“
„Ja, Mama!“ lautete die bestimmte Antwort. „Auf die Art; wenn in der Form auch etwas anders.“
„Und ... du ... glaubst ...?“
„Ich hoffe!“
Der Rittmeister kam wieder ins Zimmer.
„Ein sympathischer Mensch, dieser Katz“, sagte er. „Und auf dich, Ina, hält er grosse Stücke.“
Aus einem Nebenzimmer ertönte hell die Stimme Mathilde Brückners.
„Allmächtiger!“ rief Ina. „Wir haben ja Gäste!“
Sie trat an den Spiegel, legte Puder auf, befahl ihrem Manne, der Baronin den Arm zu reichen, und ging mit ihnen in den Salon zurück, der auf der andern Seite des Flurs lag.
Mathilde Brückner hatte ihr Lied gerade beendet, als die Drei den Salon wieder betraten.
„Ich habe versucht, Sie zu ersetzen,“ wandte sich Mathilde an die Baronin.
„Solchen Ersatz werden sich unsere Gäste gern gefallen lassen,“ erwiderte die, dankte Mathilde lebhaft und drückte ihr die Hand.
„Hoffentlich war die Abhaltung keine unangenehme,“ fragte Wolfgang v. Erdt.
„Ja und nein,“ erwiderte Frau Ina. „Es kommt, wie bei allem, darauf an, wie man es nimmt. Einer findet es katastrophal, der Andere sieht darin eine Wohltat.“
„Sehr richtig!“ stimmte der Professor zu. „Das gilt ganz allgemein und uneingeschränkt; nur merken es die Menschen in den seltensten Fällen. Alles ist letzten Endes auf Zerstörung gerichtet.“
„Jeder Aufbau trägt in sich schon den Keim späterer Vernichtung.“
„Dass wir ihn nicht erkennen,“ erwiderte Frau Ina, um dem Gespräch eine andere Richtung zu geben, „liegt daran, dass man uns schon als Kinder eine Brille auf die Nase stülpt, durch die wir dann zeitlebens alles wie durch einen Schleier sehen. Zu einer eigenen Wertung über Gut und Böse kommen wir dadurch überhaupt nicht. Das hat man uns schon vorweggenommen.“
„Und man sollte nicht imstande sein, sich diese Brille herunterzureissen und mit eigenen Augen zu sehen?“ fragte v. Erdt.
„Das Resultat wäre ein Mensch ohne Vorurteile,“ erwiderte der Professor. „Ich glaube nicht, dass es so etwas in unseren Kreisen gibt.“
„Und gäbe es das, was gewiss schon viel wäre,“ fuhr Frau Ina fort, „wem wäre damit gedient? Dieser Ausnahmemensch würde sich ja doch nur immer in seinen Kreisen bewegen. Das Leben da, wo es unverfälscht ist, würde er doch nicht kennen lernen.“
„Und wo, meinen Sie, lernt man das unverfälschte Leben am besten und am gründlichsten kennen?“ fragte Frau Mira.
„Unten im Volke natürlich,“ erwiderte der Professor, „wo die Instinkte frei und ohne gesellschaftliche Rücksichten zum Durchbruch kommen.“
Frau Olga führte ihr Spitzentuch vor den Mund und sagte:
Читать дальше