 Mauerwerksbauten– Zu den traditionellen Massivbauten gehören die aus Mauerwerk errichteten Häuser. Typisch für Mauerwerksbauten ist die Verwendung von einzelnen druckfesten Elementen, beispielsweise Mauerziegeln, Werksteinen und Betonformsteinen, die in einem bestimmten Mauerwerksverband miteinander verbunden sind. Mauerwerksbauten haben eine landschaftlich sehr unterschiedliche Ausprägung erfahren. In den werksteinarmen Regionen Norddeutschlands dominiert bis heute der Ziegelbau, während in Süddeutschland Mauerwerksbauten aus Werksteinen häufiger anzutreffen sind, wobei auch hier das verwendete Material – Sandstein, Porphyr, Kalkstein … – je nach den lokalen Angeboten schwankt.
Mauerwerksbauten– Zu den traditionellen Massivbauten gehören die aus Mauerwerk errichteten Häuser. Typisch für Mauerwerksbauten ist die Verwendung von einzelnen druckfesten Elementen, beispielsweise Mauerziegeln, Werksteinen und Betonformsteinen, die in einem bestimmten Mauerwerksverband miteinander verbunden sind. Mauerwerksbauten haben eine landschaftlich sehr unterschiedliche Ausprägung erfahren. In den werksteinarmen Regionen Norddeutschlands dominiert bis heute der Ziegelbau, während in Süddeutschland Mauerwerksbauten aus Werksteinen häufiger anzutreffen sind, wobei auch hier das verwendete Material – Sandstein, Porphyr, Kalkstein … – je nach den lokalen Angeboten schwankt.
 Stahlbetonbau– Beim Stahlbetonbau wird Beton als druckfestes Material verwendet. Da Beton zugschwach ist, wird Bewehrungsstahl zur Aufnahme der Zugkräfte eingesetzt; daher spricht man vom Stahlbetonbau. An Problembereichen (korrosionsgefährdete oder besonders stark beanspruchte Zonen) werden Bewehrungsstäbe aus Edelstahl oder – neuerdings – glasfaserverstärkten Kunststoffen eingesetzt. Durch Einbringen gespannter Stahleinlagen kann die Festigkeit des Stahlbetons erhöht und das Bauen mit größeren Stützweiten mittels Spannbeton erreicht werden. Risse sind beim Stahlbeton unvermeidlich und, sofern sie in der Norm bleiben, kein Mangel.
Stahlbetonbau– Beim Stahlbetonbau wird Beton als druckfestes Material verwendet. Da Beton zugschwach ist, wird Bewehrungsstahl zur Aufnahme der Zugkräfte eingesetzt; daher spricht man vom Stahlbetonbau. An Problembereichen (korrosionsgefährdete oder besonders stark beanspruchte Zonen) werden Bewehrungsstäbe aus Edelstahl oder – neuerdings – glasfaserverstärkten Kunststoffen eingesetzt. Durch Einbringen gespannter Stahleinlagen kann die Festigkeit des Stahlbetons erhöht und das Bauen mit größeren Stützweiten mittels Spannbeton erreicht werden. Risse sind beim Stahlbeton unvermeidlich und, sofern sie in der Norm bleiben, kein Mangel.
 Stahl und Glas– Reiner Stahlbau, das heißt die Montage der tragenden Bauteile aus Stahl, ist bei Wohnimmobilien selten anzutreffen, häufiger beim Industrie- und Brückenbau. Bei Wohn- und Bürohäusern findet man den Stahlskelettbau, der es erlaubt, Decken und Zwischenwände aus Fertigteilen einzufügen. Fassadenelemente bestehen häufig aus Glas – die gläserne Hochhausfassade wird nachgerade zu einem Symbol moderner, aber oft auch als unpersönlich empfundener Architektur angesehen.
Stahl und Glas– Reiner Stahlbau, das heißt die Montage der tragenden Bauteile aus Stahl, ist bei Wohnimmobilien selten anzutreffen, häufiger beim Industrie- und Brückenbau. Bei Wohn- und Bürohäusern findet man den Stahlskelettbau, der es erlaubt, Decken und Zwischenwände aus Fertigteilen einzufügen. Fassadenelemente bestehen häufig aus Glas – die gläserne Hochhausfassade wird nachgerade zu einem Symbol moderner, aber oft auch als unpersönlich empfundener Architektur angesehen.
 Mischkonstruktionen– Oft wird man die eine oder die andere Bauweise nicht in ihrer reinen Form antreffen. Landschaftlich typisch sind von alters her Mischformen wie das Lausitzer Umgebindehaus, das Elemente des Holzbaus und des Mauerwerkbaus als auch des Fachwerkbaus vereinigt.
Mischkonstruktionen– Oft wird man die eine oder die andere Bauweise nicht in ihrer reinen Form antreffen. Landschaftlich typisch sind von alters her Mischformen wie das Lausitzer Umgebindehaus, das Elemente des Holzbaus und des Mauerwerkbaus als auch des Fachwerkbaus vereinigt.

Mit geschultem Auge erkennt man schon von außen, aus welcher Bauepoche das Wohngebäude stammt. Von links nach rechts: Jugendstil, 1920er Jahre, …
Oft kann man verschiedenen Bauepochen bestimmte Bauweisen und die bevorzugte Verwendung bestimmter Materialien zuordnen. Auch hierbei gibt es beträchtliche regionale Unterschiede, da die natürlichen Vorkommen an Baumaterial in Nord- und Süddeutschland sehr ungleich verteilt waren.
 Mittelalter (500 – 1525)– Vorherrschend Mauerwerk (Ziegel oder Werkstein), teils in Verbindung mit Fachwerk; nur noch relativ wenige Zeugnisse im originalen Bauzustand erhalten.
Mittelalter (500 – 1525)– Vorherrschend Mauerwerk (Ziegel oder Werkstein), teils in Verbindung mit Fachwerk; nur noch relativ wenige Zeugnisse im originalen Bauzustand erhalten.
 Renaissance (1500 – 1600)– Bevorzugt klare geometrische Grundrisse, Aufnahme antiker Formelemente wie Säule, Pilaster, Kapitell und Dreiecksgiebel; klar gegliederte Fassaden, überwiegend Mauerwerksbau mit teilweise reichen Ornamentierungen. In der Innenarchitektur teils schlichte, teils aufwendig gestaltete Holzarbeiten wie Wandtäfelungen und Kassettendecken.
Renaissance (1500 – 1600)– Bevorzugt klare geometrische Grundrisse, Aufnahme antiker Formelemente wie Säule, Pilaster, Kapitell und Dreiecksgiebel; klar gegliederte Fassaden, überwiegend Mauerwerksbau mit teilweise reichen Ornamentierungen. In der Innenarchitektur teils schlichte, teils aufwendig gestaltete Holzarbeiten wie Wandtäfelungen und Kassettendecken.
 Barock (1600 – 1770)– Überwiegend Mauerwerksbauten, gelegentlich in Verbindung mit aufwendigen Stuckarbeiten; städteplanerisch oft planmäßige Stadterneuerung mit einheitlichen Traufhöhen und Fassadenordnungen.
Barock (1600 – 1770)– Überwiegend Mauerwerksbauten, gelegentlich in Verbindung mit aufwendigen Stuckarbeiten; städteplanerisch oft planmäßige Stadterneuerung mit einheitlichen Traufhöhen und Fassadenordnungen.
 Klassizismus und Historismus (1770 – 1900)– Wiederaufnahme klassischer Architekturformen, zum Beispiel durch Säulenordnungen und Dreiecksgiebel, beim Übergang zum Historismus oft scheinbar wahllose Vermischung unterschiedlicher historischer Stilelemente an ein und demselben Gebäude; palastartige Villenarchitektur; neogotische Industriebauten, neobarocke Fassadengestaltung an Wohn- und Geschäftshäusern.
Klassizismus und Historismus (1770 – 1900)– Wiederaufnahme klassischer Architekturformen, zum Beispiel durch Säulenordnungen und Dreiecksgiebel, beim Übergang zum Historismus oft scheinbar wahllose Vermischung unterschiedlicher historischer Stilelemente an ein und demselben Gebäude; palastartige Villenarchitektur; neogotische Industriebauten, neobarocke Fassadengestaltung an Wohn- und Geschäftshäusern.
 Gründerzeit und Jugendstil (1870 – 1915)– Bevorzugt Mauerwerk in Verbindung mit Holzkonstruktionen, Kellerwände oft aus Bruchsteinmauerwerk; stadtbildprägende Neubebauungen in großen und mittleren Städten; Villenarchitektur mit Rückgriffen auf den Formenvorrat des Historismus. Beim Übergang zum Jugendstil starker Gestaltungswille an reich ornamentierten Fassaden, aber auch in Treppenhäusern und bei Glasfenstern. Neben aufwendig gestalteten Villen und Stadtpalais trifft man aber auch viele einfache Gebäude an, wie Handwerker- und Bauernhäuser mit äußerst sparsamer Ausstattung. Als problematisch könnte sich bei Häusern aus dieser Zeit die oft mangelhafte Sensibilität für bauphysikalische Probleme darstellen: Wärmeisolation, Schallschutz und Kellerdichtung haben praktisch kaum Eingang in die Gebäude gefunden. Einfach verglaste Holzfenster sind allgemein verbreitet. Die Haustechnik genügt heutigen Anforderungen nicht oder besitzt (wie manche alte Aufzüge in mehrstöckigen Gebäuden) Wert als Antiquität oder technisches Denkmal.
Gründerzeit und Jugendstil (1870 – 1915)– Bevorzugt Mauerwerk in Verbindung mit Holzkonstruktionen, Kellerwände oft aus Bruchsteinmauerwerk; stadtbildprägende Neubebauungen in großen und mittleren Städten; Villenarchitektur mit Rückgriffen auf den Formenvorrat des Historismus. Beim Übergang zum Jugendstil starker Gestaltungswille an reich ornamentierten Fassaden, aber auch in Treppenhäusern und bei Glasfenstern. Neben aufwendig gestalteten Villen und Stadtpalais trifft man aber auch viele einfache Gebäude an, wie Handwerker- und Bauernhäuser mit äußerst sparsamer Ausstattung. Als problematisch könnte sich bei Häusern aus dieser Zeit die oft mangelhafte Sensibilität für bauphysikalische Probleme darstellen: Wärmeisolation, Schallschutz und Kellerdichtung haben praktisch kaum Eingang in die Gebäude gefunden. Einfach verglaste Holzfenster sind allgemein verbreitet. Die Haustechnik genügt heutigen Anforderungen nicht oder besitzt (wie manche alte Aufzüge in mehrstöckigen Gebäuden) Wert als Antiquität oder technisches Denkmal.

… 1960er Jahre, Neubau nach 2000. Daraus lassen sich auch erste Rückschlüsse auf die „inneren Werte“ der Bauqualität ziehen.
 20. Jahrhundert: Zwanziger- und Dreißigerjahre– Häufig Mischung von Ziegelmauerwerk mit Holzkonstruktion; wenige oder keine Schmuckelemente; Siedlungsbau; weite Verbreitung von Flachdächern, die manchmal Probleme bereiten. Im Zuge des sozialen Wohnungsbaus entstanden Wohneinheiten mit kleineren und niedrigeren Räumen. Werkbund und Bauhaus sorgten auf ihre Weise für handwerkliche Solidität bei gleichzeitiger Bezahlbarkeit für Mittelschichten. Betonfundamente und -kellerdecken sind hier anzutreffen.
20. Jahrhundert: Zwanziger- und Dreißigerjahre– Häufig Mischung von Ziegelmauerwerk mit Holzkonstruktion; wenige oder keine Schmuckelemente; Siedlungsbau; weite Verbreitung von Flachdächern, die manchmal Probleme bereiten. Im Zuge des sozialen Wohnungsbaus entstanden Wohneinheiten mit kleineren und niedrigeren Räumen. Werkbund und Bauhaus sorgten auf ihre Weise für handwerkliche Solidität bei gleichzeitiger Bezahlbarkeit für Mittelschichten. Betonfundamente und -kellerdecken sind hier anzutreffen.
 Fünfzigerjahre– Schlichte Bauweise mit typischen Stilelementen der Zeit; Konstruktionen aus Mauerwerk, Beton und Holz; Mauerwerk auch aus Bims und Ziegelsplitt; im Osten Deutschlands politisch motivierte Aufnahme historisierender Stilelemente (Berlin: Karl-Marx-Allee; Dresden: Altmarkt; Rostock: Lange Straße). In der Wiederaufbauzeit wurden oft minderwertige Materialien verbaut. Bauphysikalische Aspekte spielten erst ansatzweise eine Rolle. Gegen Ende der Fünfzigerjahre häufiger Beton. Standards beim Schallschutz und bei Heizungsanlagen verbessert.
Fünfzigerjahre– Schlichte Bauweise mit typischen Stilelementen der Zeit; Konstruktionen aus Mauerwerk, Beton und Holz; Mauerwerk auch aus Bims und Ziegelsplitt; im Osten Deutschlands politisch motivierte Aufnahme historisierender Stilelemente (Berlin: Karl-Marx-Allee; Dresden: Altmarkt; Rostock: Lange Straße). In der Wiederaufbauzeit wurden oft minderwertige Materialien verbaut. Bauphysikalische Aspekte spielten erst ansatzweise eine Rolle. Gegen Ende der Fünfzigerjahre häufiger Beton. Standards beim Schallschutz und bei Heizungsanlagen verbessert.
Читать дальше
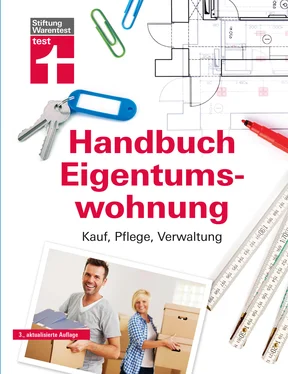
 Mauerwerksbauten– Zu den traditionellen Massivbauten gehören die aus Mauerwerk errichteten Häuser. Typisch für Mauerwerksbauten ist die Verwendung von einzelnen druckfesten Elementen, beispielsweise Mauerziegeln, Werksteinen und Betonformsteinen, die in einem bestimmten Mauerwerksverband miteinander verbunden sind. Mauerwerksbauten haben eine landschaftlich sehr unterschiedliche Ausprägung erfahren. In den werksteinarmen Regionen Norddeutschlands dominiert bis heute der Ziegelbau, während in Süddeutschland Mauerwerksbauten aus Werksteinen häufiger anzutreffen sind, wobei auch hier das verwendete Material – Sandstein, Porphyr, Kalkstein … – je nach den lokalen Angeboten schwankt.
Mauerwerksbauten– Zu den traditionellen Massivbauten gehören die aus Mauerwerk errichteten Häuser. Typisch für Mauerwerksbauten ist die Verwendung von einzelnen druckfesten Elementen, beispielsweise Mauerziegeln, Werksteinen und Betonformsteinen, die in einem bestimmten Mauerwerksverband miteinander verbunden sind. Mauerwerksbauten haben eine landschaftlich sehr unterschiedliche Ausprägung erfahren. In den werksteinarmen Regionen Norddeutschlands dominiert bis heute der Ziegelbau, während in Süddeutschland Mauerwerksbauten aus Werksteinen häufiger anzutreffen sind, wobei auch hier das verwendete Material – Sandstein, Porphyr, Kalkstein … – je nach den lokalen Angeboten schwankt.












