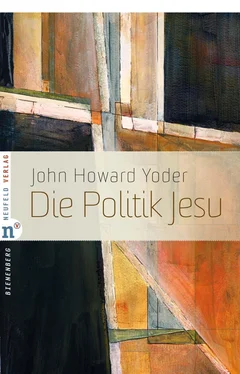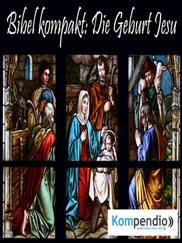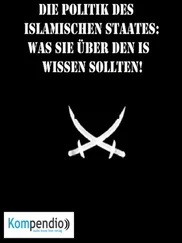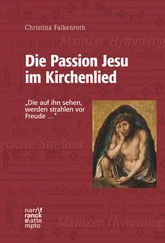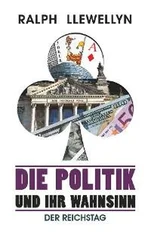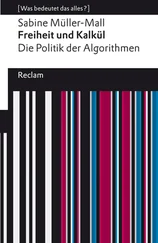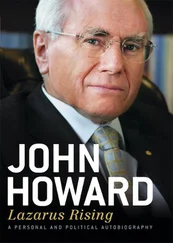Auf beiden Ebenen – der ethischen und der hermeneutischen – möchte dieses Werk Zeugnis davon ablegen, dass – über die Fragen theoretischer und formaler Natur hinaus – in Jesu Vision der göttlichen Ordnung genug konkretes und spezifisches Material enthalten ist, um die heutige Zeit anzusprechen. Und selten war eine Zeit so aufnahmebereit wie die unsere – vorausgesetzt, man befreit das Material von verfälschenden Vorurteilen.
In den zehn Jahren seit der Verfassung dieses Textes in der amerikanischen Urform hat manche Kritik, manches Forschungsergebnis das Bild im Kleinen geändert; doch bleibt die Hauptthese nach wie vor vertretbar. Nur an wenigen Stellen wurde versucht, Neueres hinzuzufügen. Etliche rein amerikanische Anspielungen wurden fallen gelassen, einige neuere Literaturhinweise ergänzt.
Die Vorbereitung des amerikanischen Textes wurde durch Unterstützung des Institute of Mennonite Studies und der Schowalter Foundation ermöglicht; viele Kollegen und Freunde haben durch ihren Rat und ihre Kritik mitgeholfen. Für die deutsche Fassung bin ich dem Übersetzer zu Dank verpflichtet. Für ihre Anregungen und ihre Kritik danke ich besonders Ruthild Foth, Julia Hildebrandt und Andrea Lange. Die Drucklegung wurde durch Unterstützung des Mennonite Central Committee (Peace Section) , des Deutschen Mennonitischen Friedenskomitees, der Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinden und durch die Hilfe vieler Freunde ermöglicht.
Vorwort des Autors zur zweiten Auflage
Jedes Kapitel der ersten Auflage von 1972 war damals eine Zusammenfassung der allseits bekannten Forschung jener Zeit. Es war keine eigene neutestamentliche Forschung, sondern die Popularisierung vorhandener Erkenntnisse. In der Vorbereitung des Buches beobachtete ich einige Jahre die damals aktuellen Veröffentlichungen, doch nie habe ich behauptet, selbst professioneller Neutestamentler zu sein.
Es liegt auf der Hand, dass ich das heute noch weniger bin als damals. Inzwischen gab es in jedem der angeschnittenen Themengebiete erhebliche neue Forschungen. Diese Themen erfuhren in den letzten Jahrzehnten weitere Aufmerksamkeit, nicht weil ich 1972 darüber geschrieben hatte, sondern weil mein Buch die damals lebendigen Fragestellungen der Forschung wiedergab.
Es wäre daher unangemessen, im Rahmen eines doch kurzen Buches, den Text als solches umzuschreiben, um ein Vierteljahrhundert Forschung aufzuholen. Das Buch sollte nie ein Kompendium neutestamentlicher Forschung sein, sondern nur an einigen Beispielen eine Hauptthese unterstützen.
Diese „Hauptthese“ gehört jedoch nicht ins Gebiet der Exegese, sondern der ethischen Methodenlehre. Sie hat noch nicht einmal mit dem Inhalt des ethischen Zeugnisses der neutestamentlichen Texte an sich zu tun, sondern mit der Frage, ob ihr Zeugnis „politisch“ ist.
Dennoch fragen Leserinnen und Leser zu Recht, inwieweit die damals in der Synthese von 1972 zusammengefassten Einsichten von der weiteren Forschung unterstützt oder hinter sich gelassen wurden. Im Großen und Ganzen wurden sie „bestätigt“, doch nur eine Detailuntersuchung kann diese generelle Feststellung belegen. Für die vorliegende Revision der Politik Jesu bedeutet das, dass der Text selbst nur minimale Veränderungen erfährt, auf die meisten Kapitel jedoch ein kurzer aktualisierender Kommentar folgt. Darin versuche ich die Linien der weiteren Forschung herauszuarbeiten. In der Vorbereitung dieser Kommentare und anderen aktualisierenden Detailarbeiten wurde ich unterstützt von Kim Pfaffenroth.
Zweierlei konnte und sollte ich in einer solchen Aktualisierung nicht tun: a) umfassend Rechenschaft geben, „wie sich mein Denken in einem Vierteljahrhundert verändert hat“, oder b) detailliert auf die Kritik an bestimmten Passagen eingehen. Es gibt natürlich zahlreiche Punkte, wo meine Position von 1972 korrigiert oder zurück genommen werden müsste. An anderen Stellen wäre es angebracht, sie gegen Fehlinterpretationen zu verteidigen oder sich mit Dialogpartnern auseinanderzusetzen, die sie zwar richtig verstehen, aber anderer Meinung sind. Eine solche Vorgehensweise würde jedoch viel mehr Raum erfordern und auch eine wesentlich diffizilere Argumentation, als der ursprüngliche Text beabsichtigte. Eine Überarbeitung des ganzen Buches hätte die Revision also unangemessen überlastet.
Etwas anderes sind stilistische Änderungen des Originaltextes, etwa um auf den heute sensibleren Umgang mit geschlechtsspezifischen Ausdrücken einzugehen. Die wichtigsten Beiträge zur Überarbeitung in dieser Hinsicht kamen von Augustus und Laurel Jordan.
In meinem ersten Vorwort bezeichnete ich meine Art der Exegese mit dem Begriff „biblischer Realismus“. Unter Fachwissenschaftlern war das ein in den 1960ern gängiger Ausdruck. Wie die wesentlichen Inhalte meiner Darstellung war es kein eigenes von mir geschaffenes Konzept. Der Begriff wurde jedoch nie sehr bekannt, noch versuchten die Forscher, die er damals bezeichnete, jemals konzertiert als Team oder „Schule“ zusammen zu arbeiten. Es bezeichnete einen Ansatz, der sich aller Werkzeuge der literarischen und historischen Kritik bediente, ohne sich von der traditionellen Schulwissenschaft fesseln zu lassen oder zuzulassen, dass der Kirche die Schrift weggenommen wird.
Gegen meine Intention wurde dieses Buch von manchen als eigenständiger Ansatz wahrgenommen, Bibel und Kirche oder Bibel und Ethik aufeinander zu beziehen. 1Andere missverstanden es als „fundamentalistisch“.
Hätte ich gewusst, dass das Buch als Prototyp einer ambitionierten oder fundierten Methodik auf den Prüfstand gestellt würde, hätte ich mich womöglich stärker auf eine Erörterung der theoretischen Prolegomena eingelassen – oder gerade das verweigert, denn in der abstrakten Methodendiskussion gerät man leicht an einen Punkt, wo solche Diskussion sich dem biblischen Text in den Weg stellt und ihm seine zentrale Rolle in der Identität der Kirche streitig macht.
1Etwa von Birch und Larry Rasmussen, die mich in zwei Auflagen von Birch & Rasmussen (1976) auf verschiedene Weise und in verschiedenen Belegen so zitierten. Ähnlich bei Curran (1981).
KAPITEL 1
Die Möglichkeit einer messianischen Ethik
Das Problem
Unsere Zeit erhebt einerseits den Anspruch, das Christentum hinter sich gelassen zu haben. Man spricht von der nachchristlichen Gesellschaft. Andererseits scheint Jesus, je mehr die traditionelle, kirchlich sanktionierte Auslegung seiner Worte und Werke verblasst, auf viele und besonders auf junge, kritische Menschen eine verstärkte Faszination auszuüben. Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass seit Ende der 1960er Jahre viele junge Männer dem Jesus der Sonntagsschulplakate sehr ähnlich sehen. Auch die Rebellen der Studentenrevolte trugen Bart und langes Haar. Ihre Behauptung, Jesus sei ebenfalls ein Sozialkritiker, ein Agitator, 2ein sozialer Drop-Out und der Sprecher einer Gegenkultur gewesen, ist sicher nicht zufällig.
Unter den Theologiestudenten der westlichen Welt fiel die „Theologie der Befreiung“ auf fruchtbaren Boden, weil sie eben diese Behauptung aufstellt. Kann die christliche Ethik diese These genauso schlagfertig (bzw. leichtfertig) zurückweisen, wie sie oft aufgestellt wird? Könnte der Vorwurf mangelnder Ehrfurcht oder der Vereinnahmung für eigene Ziele nicht leicht auf sie zurückfallen? Oder steckt hinter dieser vielleicht übertriebenen Aussage eine biblische Wahrheit, die nun erst, da Revolution zum Schlagwort unserer Zeit geworden ist, in die allgemeine Wahrnehmung einbricht? Hat die ehrfurchtsvolle und „verantwortliche“ christliche Ethik in dieser Beziehung versagt?
Das behauptet diese Arbeit. Sie behauptet nicht nur, dass Jesus dem biblischen Zeugnis nach ein Modell radikalen politischen Handelns darstellt, sondern dass dieser Sachverhalt jetzt in der neutestamentlichen Forschung allgemein sichtbar wird, auch wenn die Neutestamentler ihn bisher nicht so entschieden vertreten haben, dass die Ethiker am anderen Wegrand ihn zur Kenntnis nehmen mussten. 3
Читать дальше