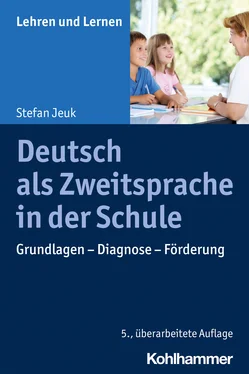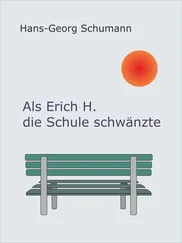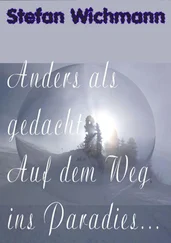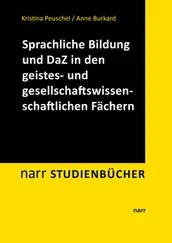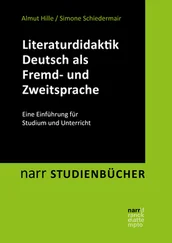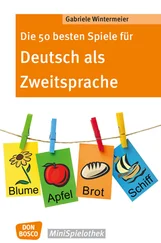Gomolla & Radke (2009) sehen einen wichtigen Faktor in der »Institutionellen Diskriminierung«, indem das Schulsystem nicht auf Schüler*innen mit Migrationshintergrund eingestellt ist ( 
Kap. 5.1
). Bonefeld & Dickhäuser (2018) zeigen in einer Studie mit Lehramtsstudierenden, dass bei der Bewertung von Diktaten Schüler*innen mit türkischem Namen signifikant schlechter bewertet werden, als Schüler*innen mit einem deutschen Namen. Es könnte also sein, dass Vorannahmen von Lehrkräften nicht unbeteiligt an der Schlechterbewertung von Schüler*innen mit Migrationshintergrund sind.
Statistische Darstellungen zur Bildungsbenachteiligung bergen die Gefahr einseitiger Zuschreibungen. Die Schlechterstellung der Schüler*innen mit Migrationshintergrund darf nicht als »Fehlleistung« einer Gruppe aufgefasst werden, sondern verweist darauf, dass die deutsche Gesellschaft derzeit »nicht in der Lage ist, eine Schule anzubieten, die allen Kindern und Jugendlichen die von ihr selbst erwarteten Kompetenzen vermittelt (Chlosta & Ostermann 2017, S. 38).
1.3 Deutsch als Zweitsprache als Bildungsaufgabe in der Schule
Deutsch als Zweitsprache als Bildungsaufgabe
In allen Bundesländern gibt es Bemühungen, sprachliche Kompetenzen mehrsprachiger Kinder und Jugendlicher zu fördern. Dies beginnt lange vor der Einschulung, häufig werden bereits 4-jährige Kinder im Hinblick auf Schwierigkeiten beim (Zweit-)Spracherwerb untersucht (Neugebauer & Becker-Mrotzek, 2013). Durch eine Reihe von Maßnahmen soll die sprachliche Kompetenz bereits im Vorschulalter umfangreich gefördert werden. Doch diese Maßnahmen reichen offenbar nicht aus; in der Grundschule haben noch viele Kinder Sprachförderbedarf und auch in der Sekundarstufe sind sprachliche Schwierigkeiten mehrsprachiger Jugendlicher ein drängendes Problem (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2020, S. 153ff).
Schwierigkeiten bei der Aneignung in der Zweitsprache im Vorschulalter lassen sich folgendermaßen erklären:
1. Die Aneignung einer zweiten Sprache im Vorschulalter kann dann gelingen, wenn die Lernbedingungen optimal sind ( 
Kap. 2.3
). Wenn die Zahl der mehrsprachigen Kinder in der Einrichtung sehr hoch ist, sind allerdings die Gelegenheiten begrenzt die deutsche Sprache zu gebrauchen. Die Kommunikation unter Kindern (Peer-Kommunikation, vgl. Viernickel, 2010) in der Zweitsprache Deutsch, die für die Sprachaneignung ein wichtiger Faktor ist, ist deutlich eingeschränkt.
2. In diesen Kontexten wird die Erzieherin nahezu zum alleinigen Sprachvorbild. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass die Zeit, in der es einer Erzieherin in Gruppen mit 20 bis 25 Kindern tatsächlich möglich ist, so zu kommunizieren, dass die Sprachaneignung des Kindes optimal unterstützt wird, sehr begrenzt ist (vgl. Röhner et al., 2007).
3. Viele mehrsprachige Kinder leben in sozialen Kontexten, die zumindest zum Teil von prekären Verhältnissen geprägt sind (vgl. auch Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2020, S. 26ff). So gibt es bei einigen Kindern auch in der Lebenswelt außerhalb der Kindertageseinrichtung wenige Gelegenheiten, die Zweitsprache Deutsch zu hören, zu verarbeiten und zu erproben.
Setzt man diese Sachverhalte in Beziehung zu den Bedingungen, von denen wir wissen, dass sie für einen erfolgreichen (Zweit-)Spracherwerb notwendig sind ( 
Kap. 2.3
), dann müssen wir feststellen, dass viele mehrsprachige Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung einen Sprachstand in der Zweitsprache Deutsch erreicht haben, der, gemessen an den Rahmenbedingungen, gut ist ( 
Kap. 3
). Er reicht aber nicht bei allen Kindern aus, um am Unterricht sinnvoll partizipieren zu können. Dies verweist darauf, dass auch in der Schule die Aneignung in der Zweitsprache Deutsch weiterhin unterstützt werden muss. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Es gibt, in jüngerer Zeit zunehmend, sogenannte »Seiteneinsteiger«, die im Laufe der Schulzeit nach Deutschland einwandern. Auch sie benötigen umfassende Unterstützung beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch.
Bei vielen Kindern fallen Schwierigkeiten in der mündlichen Kommunikation nicht immer auf und Probleme werden erst evident, wenn in der Schule im Zusammenhang mit dem schriftlichen Ausdruck weitergehende Fähigkeiten verlangt werden. Knapp (1999) spricht von »verdeckten Sprachschwierigkeiten«. Die Kinder haben gelernt, im Alltag in der Zweitsprache zu kommunizieren. In der Schule sind jedoch darüber hinausgehende sprachliche Kompetenzen gefordert ( 
Kap. 3.1
). Da der gesamte Unterricht mit der Zeit schriftlich wird, wirken sich bereits geringfügige Sprachschwierigkeiten aus, die im Alltag nicht oder nur wenig ins Gewicht fallen ( 
Kap. 3.2
). Ein Schwerpunkt sprachlicher Schwierigkeiten liegt, wie wir noch sehen werden, darin, dass die Kinder über einen eingeschränkten Wortschatz verfügen bzw. nicht immer die Bedeutungen der Wörter in allen Verwendungskontexten kennen. In der Alltagskommunikation kann dieses Problem durch Mimik, Gestik und Kontextinformationen gut kompensiert werden, in der schriftlichen Kommunikation ist dies bedeutend schwieriger. Da der Kindergarten und die Schule die wichtigsten Orte des Erwerbs eines umfangreichen und elaborierten Wortschatzes sind, folgt daraus, dass nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern die spezifischen Lernbedingungen mehrsprachiger Kinder berücksichtigt werden müssen. Wenn es stimmt, dass die sprachlichen Schwierigkeiten vor allem auf mangelnder Spracherfahrung beruhen, ist jede Situation, in der in der deutschen Sprache kommuniziert wird, eine potenzielle Spracherwerbssituation. Insbesondere die Sachfächer sind somit zentrale Orte der Sprachaneignung. Im Laufe der Schulzeit verschiebt sich natürlich die Gewichtung erheblich ( 
Kap. 5
). Darüber hinaus besteht in der nationalen und internationalen Forschung Einigkeit darüber, dass mehrsprachige Jugendliche eine zusätzliche Unterstützung über die gesamte Schulzeit hinweg benötigen (Chlosta & Ostermann, 2017). Dass Förderunterricht in der Sekundarstufe zu nachhaltigen Erfolgen führen kann, zeigt beispielsweise der Erfolg des Projekts der Stiftung Mercator (vgl. Barzl & Salek, 2007; 
Kap. 5.2
).
Bildungspolitisch ist nach wie vor die Tendenz zu beobachten, dass sprachliche Schwierigkeiten von mehrsprachigen Schüler*innen als individuelles Problem gesehen werden und es nur wenige Überlegungen gibt, konzeptionell oder curricular darauf einzugehen. Dies hat sich mit den neuen Bildungsplänen zwar zum Teil geändert, indem häufig davon die Rede ist, dass Deutschunterricht auch Unterricht für Kinder und Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache sein müsse. In der Formulierung der Bildungsstandards wird jedoch auf spezifische Bedürfnisse mehrsprachiger Schüler*innen kaum eingegangen. So ist z. B. eines der größten Lernfelder für mehrsprachige Kinder in der Zweitsprache Deutsch die Genus- und Kasusmarkierung der Nomen. Diese Bereiche werden in den Lehrplänen nicht genannt und in den Lehrbüchern werden sie nicht thematisiert. Denn es wird davon ausgegangen, dass einsprachig deutsche Schüler*innen dies ja können, und einsprachig deutsche Schüler*innen sind das Maß und der Standard, an dem sich mehrsprachige Lernende unhinterfragt zu orientieren haben. Genus und Kasus sind zwar Begriffe, die im Rahmen des Grammatikunterrichts ab Klasse 5 erwähnt werden, hier geht es jedoch nicht um die Vermittlung der Gebrauchsbedingungen, sondern um das Lernen grammatischer Termini im Rahmen eines »muttersprachlichen« Deutschunterrichts. So gibt es auch in der didaktischen Fachliteratur nur wenige Veröffentlichungen darüber, wie man Kinder bei der Aneignung der Genera (grammatisches Geschlecht der Nomen) unterstützen kann (vgl. Jeuk, 2018a). Die Mängel der Bildungsstandards im Hinblick auf (Zweit-)Spracherwerbsprozesse zeigen sich im Allgemeinen darin, dass die Vermittlung von Kompetenzen in der gesprochenen Sprache, unter anderem als eine wesentliche Grundlage zum Erwerb konzeptioneller Schriftlichkeit, insgesamt kaum erwähnt wird. Implizit wird davon ausgegangen, dass die Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung die wesentlichen Grundlagen der deutschen Sprache erworben haben. Es gibt allerdings in nahezu allen Bundesländern Bildungspläne oder Handreichungen für den DaZ-Unterricht. Hier werden Lernziele in den Bereichen Wortschatz, Sprachhandlungen, Kommunikation, Grammatik usw. genannt, die auch für alle Fächer gelten (vgl. Aschenbrenner et al., 2016). Diese Handreichungen werden jedoch bisher vor allem in Klassen für neu eingewanderte Kinder und Jugendliche umgesetzt.
Читать дальше