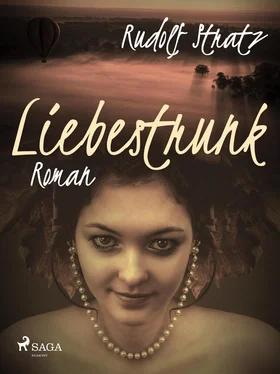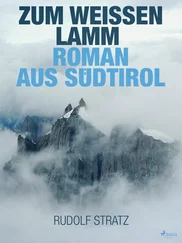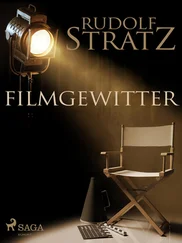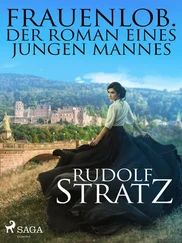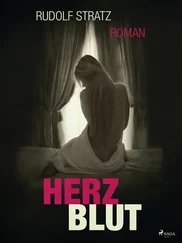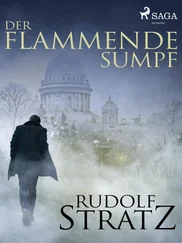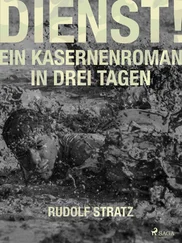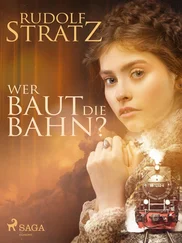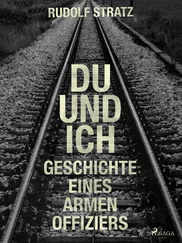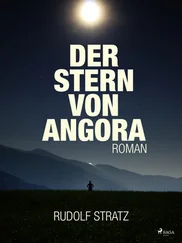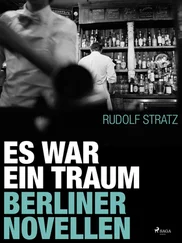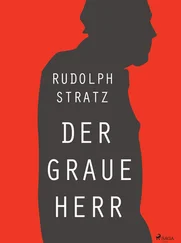„Das weiss ich nicht! . . . Davon kann ich jetzt meine Entschlüsse nicht abhängig machen! . . . Ich kann nur so Handeln, wie ich in dieser Stunde bin und mich fühle! Und da kann ich nur immer wieder sagen: Ich habe zu Tiefes erlebt! . . . Ich kann es nicht eintauschen gegen das, was viele andere auch erleben! . . . Damit gebe ich mich selbst preis! Und ich halte etwas von mir, Herr von Wingerow!“
Ihr Besucher hatte Helm und Handschuhe in die Rechte genommen. Mit der Linken hielt er den Säbel, so dass er Gabriele nicht die Hand zu geben vermochte.
„Ich bin mit anderen Hoffnungen gekommen, gnädige Frau!“ sagte er. „Aber das alles steht ja freilich bei Ihnen! Ich danke Ihnen ehrerbietig für Ihr Vertrauen! Und nun gestatten Sie mir, mich aus Ihrem Hause zu beurlauben!“
„Sie wollen wirklich nicht wiederkommen?“
„Dann, gnädige Frau, wenn ich ein Zeichen von Ihnen erhalte, das mich Besseres hoffen lässt als heute! . . . Dann bin ich sofort zur Stelle! . . . Ich werde warten!“
Sie schüttelte stumm den Kopf.
„Doch, gnädige Frau — ich werde warten! . . . Und trotz Ihrer Worte sagt mir meine Ahnung: ,nicht umsonst!‘“
,,Lassen Sie nur inzwischen das Glück nicht an sich vorübergehen, lieber Herr von Wingerow!“
„Ich kenne nur eines . . .“
Der Major von Wingerow verbeugte sich auf der Schwelle und wandte sich um. Die Türe schloss sich hinter ihm.
Einige Zeit nach dem Major von Wingerow verliess auch Gabriele Lünhardt ihr Haus. Sie machte regelmässig in den ersten Nachmittagsstunden einen einsamen Spaziergang in den letzten, zwischen Spreekanal und Neuen See gelegenen Teilen des Tiergartens. Dies Bedürfnis des zeitweiligen Alleinseins mit sich hatte sie immer gehabt, auch während ihrer Ehe. Sie war eigentlich nicht gern in Berlin. Aus dem Gesellschaftstreiben und Nerbengehetze der Weltstadt machte sie sich, in ihrer ruhigen, gleichmütigen Art, nichts. Sie schätzte daran nur die Opern, die Konzerte, die Musikabende daheim, diese künstlerischen Genüsse, die man anderswo nicht haben konnte. Sonst hätte sie lieber auf dem Lande gelebt, in der freien Natur, in die man sich hineindenken, aus der man sich herausnehmen konnte, was gerade der augenblicklichen Seelenstimmung entsprach. Dann war zwischen ihr und der Welt ein Zusammenhang, wie zwischen Bild und Rahmen, so auch jetzt, hier an der Grenze von Häusermeer und Waldstille, im kühlen Hauch des Herbstes.
Sie war gar nicht gedrückt oder erregt. Sie schritt frei und leicht, schlank aufgerichtet ihres Wegs, auf dem sie schon längst jedes Brückchen und jede Bank kannte. Sie liebte dies Gewohnheitsmässige in ihrem Tun. Es war das etwas Philiströses in ihr, über das sie selbst lächelte. Ihr Gesicht war gleichmütig, trotz der ernsten
Aussprache von vorhin. Sie atmete ruhig im raschen Gehen die frische, herbe Luft ein. Sie lebte eigentlich sehr gern, auch nach dem bitteren Verlust, der ihr Dasein geknickt hatte. In diesem war nun wenigstens die Ruhe. Man hatte das Schwerste überstanden. Die Sorgen, Nöte, Kümmernisse, die andere Menschen quälten, lagen endgültig hinter einem, die konnten nicht wiederkehren. Der Tod hatte einen Riegel davor geschoben.
Freilich dachte sie sich auch jetzt wieder ein paarmal: ,Heute bin ich siebenundzwanzig geworden. Für viele fängt da das Leben erst an!‘ Dann schien es ihr selber unwahrscheinlich und unbegreiflich, dass das immer so weitergehen könne. Es musste einmal etwas dazwischen treten. Die Zeit, die noch vor ihr lag, war noch viel zu lang. Aber sie vermochte sich nicht vorzustellen, wie das kommen könnte. Es war nichtig, über Möglichkeiten des Schicksals zu grübeln. Sie gestand sich schliesslich auch ehrlich: ,Ich bin feige geworden! Das Schicksal hat mir zu weh getan! Ich will keine weiteren Berührungen. Ich zittere davor. Ich möchte bleiben, wie ich bin. Schmerzlosigkeit ist auch mir gut.‘
Sie dehnte heute ihren Spaziergang weiter als sonst aus. Es war schon nach vier Uhr, als sie jugendlich frisch, mit geröteten Wangen, von der Luft belebt, in den Vorgarten ihrer Villa trat. Im Hause war zur Rechten der Halle ein Garderobenraum. Da hing zu ihrem Erstaunen ein dickwattierter, dunkler Herrenpaletot, wie man ihn wohl im strengen Winter, aber nicht jetzt im Frühherbst trug. Darüber ein starkes, weissseidenes Cachenez. Ein Paar schwere Gummigaloschen standen am Boden. Welchem Nordpolfahrer gehörte denn das? Es waren doch nur Damen im Hause. Sie frug den Diener, und der erwiderte, verwirrt durch ihren strengen Blick: „Jawohl, gnädige Frau! . . . Der Herr sitzt im blauen Salon!“
„Welcher Herr?“
Der Diener wusste nicht Bescheid. Das Mädchen hatte die Karte angenommen. Sie erschien aus dem Souterrain herauf.
„Der Herr hat bestimmt erklärt, er wäre zur Teezeit bestellt!“ sagte sie verlegen. „Da glaubte ich . . .“
„Durch wen denn bestellt, um Gottes willen?“
„Durch den Herrn Hauptmann Bankholtz. Der habe es ihm heute mittag im Auftrag der gnädigen Frau ausgerichtet . . .“
Die junge Witwe nahm die Karte, die auf dem silbernen Tablett lag. Sie las:
„Werner Freiherr von Ostönne
Plantagendirektor
Deutsch-Ostafrika.“
„Mein Gott . . . hat der Eile!“ sagte sie unwillkürlich vor sich hin. Er musste sich gleich nach dem Frühstück mit ihrem künftigen Schwager umgezogen haben und hierhergefahren sein.
„Richtig! Ich hatte ganz vergessen!“ sagte sie zu dem Diener. „Es stimmt schon! Bitten Sie den Herrn, noch einen Augenblick zu warten!“
Als sie fünf Minuten später mit leichten, auf dem dicken Teppich kaum hörbaren Schritten in den Salon trat, entdeckten ihre schönen, grauen, etwas kurzsichtigen Augen erst nach ein paar Sekunden den Besucher. Er sass, auf ein Taburett geduckt, fröstelnd vor dem Kaminfeuer und rieb sich über der schwachen, eigentlich nur für das Auge bestimmten Kohlenglut die Hände. Wie sie dicht hinter ihm war und er sie im Spiegel sah, sprang er rasch empor und verbeugte sich. Er trug schwarzen Besuchsrock und scharf in die Falte gebügelte taubengraue Beinkleider. Es war alles, wie es sich gehörte. Und doch machte er einen exotischen Eindruck. Sein Gesicht war sonnenbraun, finster, mit einem dunklen Schnurrbart. Von ebensolcher Farbe sein Haar. Gabriele wusste, dass er ungefähr dasselbe Geburtsjahr wie ihr verstorbener Mann haben musste. Aber er sah älter aus. Er war hager gewachsen, mittelgross, mit sehr breiten Schultern und starkem Brustkasten.
„Verzeihung, gnädige Frau!“ sagte er. „Ich fror hier ein wenig. Ich friere immer, seitdem ich in Deutschland bin! . . . Wenn man so lange unter dem Äquator war . . .“
Daher die Wintersachen im Flur! . . . Der Fremde machte nicht viel Umstände. Es schien ihr, als habe er einen beinahe brutalen Zug der Rücksichtslosigkeit um die Lippen. Er gefiel ihr nicht. Aber sie lächelte höflich-kühl und sagte: „Kommen Sie, Herr von Ostönne . . . wir wollen uns recht nahe an das Feuer setzen, damit Sie die Sonne Afrikas nicht zu sehr entbehren! . . . So . . . Sie bekommen auch gleich Tee . . .“
Gabriele Lünhardt hatte, liebenswürdig wie sie von Natur war, leicht etwas in Sprache und Gesichtsausdruck, was wie vertraulich aussah — auch weniger nahen Bekannten gegenüber. Es klang dann, als redete sie mit einem guten Freund, und wurde so aufgefasst, auch wenn sie es gar nicht so meinte. Aber Herr von Ostönne zeigte keine Spur von Verbindlichkeit. Er räusperte sich nur — er war offenbar stark erkältet und vielleicht klang seine Stimme deswegen so rauh, als er kurz sagte: „Danke sehr!“
Dann schwieg er und sah sie unverwandt, sonderbar prüfend an. Sie dachte sich: „Komischer Kauz! . . . Wenn er auch ein früherer Offizier und Freiherr ist — man merkt doch, dass er lange draussen im Urwald war!‘ Sie begann, konventionell, wie eine Dame die Unterhaltung mit einem Besucher einleitet: „Sie sind schon länger zurück, Herr von Ostönne?“
Читать дальше