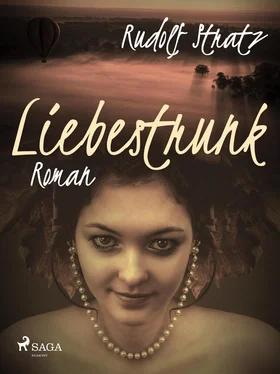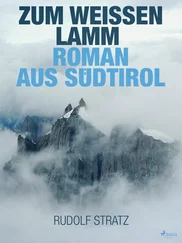„Wenn er will — gewiss!“
Es klang zurückhaltend. Sie setzte hinzu: „Es ist übrigens komisch: Ich erinnere mich genau . . . ich habe ihm vor drei Jahren ausführlich alles über den Tod meines Mannes nach Ostafrika geschrieben — ich hielt es für meine Pflicht, da ich wusste, wie befreundet die beiden zusammen waren — aber ich habe nie eine Zeile Antwort bekommen . . .“
„Wahrscheinlich ist der Brief verloren gegangen. Denn wenn ich ihn recht verstanden habe, wollte er jetzt gerade über Pauls letzte Zeit näheres von Ihnen hören . . . Wann darf er denn antreten?“
„Irgend einmal des Nachmittags zur Teezeit!“
„Schön! Ich esse jetzt mit ihm! Da werde ich es ihm gleich bestellen! . . . Empfehle mich gehorsamst! . . . Adieu, Maus!“
Der Schutztruppler zog sich sporenklirrend zurück, von seiner Braut in die Vorhalle begleitet. Ihre Schwester sah den beiden gedankenvoll nach. Was waren das für sonderbare Reden hinter ihrem Rücken gewesen? Sie, Gabriele Lünhardt, die immer nachgab, die nie heftig wurde, eine Tyrannin? Sie sollte den anderen das Zusammenleben mit ihr so schwer machen, ihnen ihre Persönlichkeit verkümmern? Sie schüttelte den Kopf. Nicht im Traum war ihr je so etwas eingefallen. Sie war sich wirklich keiner Schuld bewusst. Sie sorgte sich doch kaum um andere, und wenn ja, dann doch nur, um ihnen zu helfen. Sie hatte, als sie bald nachher alle drei bei Tisch sassen, eigentlich Lust, die glückliche Braut zur Rede zu stellen, Aber dann liess sie es.
Es war ihr schliesslich gleichgültig, dies Geschwätz. Es lag zu weit von ihr ab. Am besten, man vergass es.
Sie hörte mit halbem Ohr auf die eifrigen Ausstattungs- und Hochzeitsreisepläne der blonden Kleinen an ihrer Seite. Schwermut lastete auf ihr, die für ihr Teil das alles längst hinter sich und begraben wusste. Sie dachte sich: ,Nun geht Gisela weg. Ich bin mit Mama allein. Einmal wird auch die abgerufen. Dann habe ich niemanden mehr auf der Welt . . .‘
Die Vorstellung dieser kommenden Einsamkeit zog ihr das Herz zusammen. Wenn das doch zuviel für sie würde — wenn sie sich in schwachen Stunden nach einer Menschenseele sehnte und es zu spät war? — Dann lieber gleich den Entschluss . . . heute noch . . . und zugleich wusste sie auch wieder: Nein! Es war unmöglich . . .
Das Frühstück ging zu Ende. Sie erhob sich und sagte zu dem Diener: „Johann . . . ich bin nicht zu Hause! Nur wenn Herr von Wingerow kommen sollte . . .“
„Herr Major sind eben in den Vorgarten getreten!“
Draussen brummte der tiefe Klang eines kupfernen Gongs im Flur. Ein Hausmädchen kam und brachte die Karte des Besuchs. Die Züge der jungen Witwe wurden sehr ernst. Sie kümmerte sich nicht darum, dass Mutter und Schwester sie von der Seite gespannt ansahen. Sie sagte kurz: „In den blauen Salon! Ich komme gleich!“
Die Mitte dieses Raumes nahm eine Staffelei mit einer lebensgrossen Ölskizze Gabrieles ein. Das Werk war von Lenbachs Hand. Darum hatte es diesen Ehrenplatz gefunden. Aber eigentlich liebte sie das Bild nicht. Das war nicht sie, ein seltsamer, fremder Zug um den Mund, ein ihr unbekannter Ausdruck in den Augen. Vor diesem flüchtig und genialisch mit raschen Farbenstrichen hingewischten Profil stand, als sie eintrat, der Major von Wingerow, auf seinen Säbel gestützt, und musterte es mit tiefem Interesse.
Er war ein schöner Mann, in altpreussischer Art, den dunkelbraunen Vollbart zu beiden Seiten des Kinns ausrasiert, wie es einst Kaiser Wilhelm der Erste getragen und es jetzt in der Armee wenig mehr üblich war. Das war ein Anklang an Potsdam — an die Garde, in der er einst seine Dienstzeit begonnen. Der Johanniterstern funkelte an seinem Hals. Er war jung für seine Charge, erst zu Ende der Dreissig. In Blick und Sprache hatte er etwas Bestimmtes, in sich Zusammengefasstes, dessen Härte durch die Ritterlichkeit seiner Formen gemildert wurde. Er zog Gabrieles Hand, sich tief verbeugend, an die Lippen. „Nochmals herzlichsten Glückwunsch, meine verehrte gnädige Frau!“ sagte er lebhaft und überreichte ihr ein paar Blumen. Es war ein kleines Veilchensträusschen, wie man es an den Strassenecken in Berlin kaufte, ein alltägliches Ding. Er wollte bloss nicht ganz mit leeren Händen kommen. Er lachte selbst dazu. Das war bei ihm selten. Er war verwitwet wie Gabriele. Vor fünf Jahren hatte er seine Frau begraben. Sie schüttelte ihm stumm die Rechte und tat den Strauss in das Glas mit den roten und weissen Rosen, die drüben in der Fensterecke dufteten.
Sein Auge folgte ihr. „Ist denn das Ihr ganzer Geburtstagstisch, gnädige Frau?“ frug er. „So wenig Blumen?“
„Es waren eine Masse da. Ich hab’ sie weggetan!“
„Und meine armseligen paar Rosen von vorhin?“
„Die hab’ ich gelassen! Um die wäre es mịr schade gewesen!“
Eine jähe Röte überflog das männliche, nervöser als bei Frontoffizieren durchgearbeitete Antlitz ihres Besuchers. Er trat auf Gabriele zu. Es schwebte ihm etwas auf den Lippen, es war, als wollte er den Augenblick benutzen. Aber sie liess ihn nicht dazu kommen. Sie setzte sich, bat ihn mit einer flüchtigen Handbewegung, ihr gegenüber Platz zu nehmen, und meinte, so freundlich-höflich, wie sie es gegen jeden anderen auch gewesen wäre: ,,Bitte — machen Sie es sich doch bequem, Herr von Wingerow!“
Er stellte seinen Helm auf ein Taburett, warf die weissen Handschuhe daneben, presste unwillkürlich die Hände auf den Knien ineinander, um seine Aufregung niederzukämpfen, und begann: „Gnädige Frau . . . ist die Frage zu unbescheiden . . . aber ich habe jetzt den Mut dazu . . . darf ich hoffen, dass wir in der nächsten Viertelstunde nicht gestört werden . . .?“
„Es wird niemand kommen! Ich habe ausdrücklich Befehl gegeben!“
Er nickte hastig, beistimmend. Er wurde abwechselnd rot und blass. Es machte sich seltsam bei dem grossen, stattlichen Mann, dem Energie und Selbstbewusstsein aus dem Gesicht sprachen. Die junge Witwe vor ihm blieb ruhig. Ihre schönen grauen Augen musterten ihn gelassen. Sie hatte noch Zeit, sich dabei zu denken: ,Wie er es nur fertig bringt, immer noch tadelloser angezogen zu sein, als andere Offiziere, vom Scheitel bis zu den Lacktiefelspitzen . . .‘
,,Gnädige Frau . . .“ sagte der Major von Wingerow entschlossen. „Heute ist kein Tag wie andere . . . ich meine, für Sie . . . Sie feiern Ihr Wiegenfest . . . Sie haben sich, wie ich mit Freuden sehe, dazu überwunden, endlich die Trauer abzulegen . . .“
„Ich weiss nicht, auf wie lange!“ sagte sie düster.
„Immerhin . . . ich darf in dieser Äusserlichkeit doch wohl nicht nur einen Zufall sehen — sondern ein Zeichen — ein Sinnbild gewissermassen, dass nun manches hinter Ihnen liegt . . .“
Sie hob kühl den Kopf. Ihre Haltung verwirrte ihn. Er sammelte sich.
„Verstehen Sie mich nicht falsch, meine liebe, verehrte gnädige Frau! . . . Es gibt unvergessliche Dinge . . . heilige Schmerzen . . . Das weiss niemand besser als ich . . . ich hab’ es ja selber durchgemacht! Ihnen brauch’ ich nichts zu sagen . . . Uns beiden hat Gott seinen Finger gezeigt . . .“
Es war still zwischen ihnen. Draussen hielt ein Coupé vor der Villa. Die Kommerzienrätin und Gisela stiegen ein und fuhren nach der Stadt zu davon. Der Major von Wingerow beugte sich in seinem Stuhl vor, den Säbel zwischen den Beinen, die Hände auf den Knauf gestützt, einen gespannten Ausdruck in den glänzenden, klugen hellbraunen Augen.
„Nun seh’ ich meine Blumen da auf dem Tisch . . . meine allein . . . das scheint mir ein Geheiss, endlich einmal das Unausgesprochene in Worte zu fassen . . .“
„. . . Sie sind mein Freund, Herr von Wingerow!“ sagte die junge Witwe. „. . . Das wollte ich damit zeigen . . .“
„Ihr Freund?“
Es klang unschlüssig. Er wusste nicht recht, was er daraus machen sollte. Er wollte wieder anfangen, aber sie unterbrach ihn.
Читать дальше