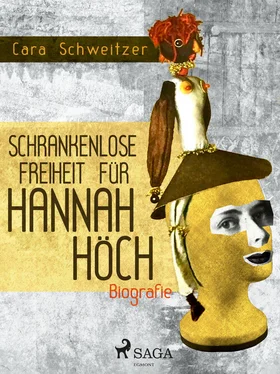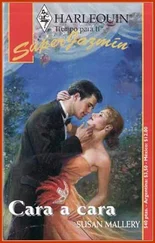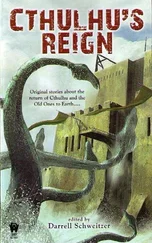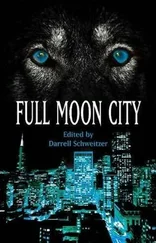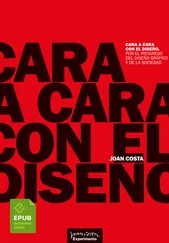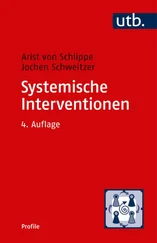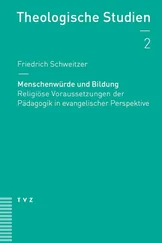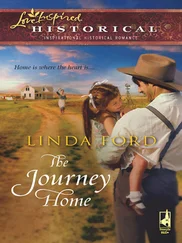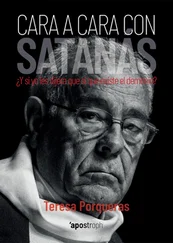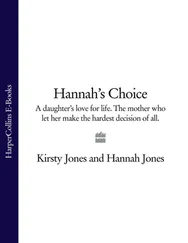Die Ressentiments gegenüber Künstlerinnen demonstrieren aber auch, wie entschieden man das kreative Potential des Kunstgewerbes unterschätzte. Neben diesen angeblich von der Natur vorgegebenen Beschränkungen der Frau wurde vor allem das für die künstlerische Ausbildung notwendige Studium des nackten menschlichen Körpers als Argument gegen Studentinnen an den Kunstakademien angeführt. Moralisch anstößig war für viele Professoren die Vorstellung, dass junge Studenten und Studentinnen gemeinsam vor dem Akt zeichneten. Im späten 19. Jahrhundert galt das Zeichnen des entblößten weiblichen Körpers allerdings generell als Gefährdung der Sittlichkeit. Der preußische Staatskünstler und kunstpolitisch äußerst einflussreiche Historienmaler Anton von Werner lehnte 1874 aus diesem Grund einen Antrag seiner männlichen Studenten ab, weibliche Modelle einzustellen. 21Die Vorbehalte und Verbote waren Ausdruck des tabuisierenden und unterdrückenden Umgangs mit dem weiblichen Körper um 1900 in Deutschland. An Koedukation vor dem unbekleideten Modell war auch noch lange nach der Jahrhundertwende nicht zu denken. Das gilt übrigens auch und vor allem für die Medizin. Anatomie lernten Frauen hier in von ihren männlichen Kollegen getrennten Kursen.
Hannah Höchs Entscheidung gegen eine Bewerbung an einer Kunstakademie entsprach dem Ausbildungsweg der meisten künstlerisch begabten und interessierten jungen Frauen ihres Alters. Als Kompromiss bot sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Wahl einer privaten Kunst- oder Kunstgewerbeschule an. 22
Der Eintritt des deutschen Kaiserreichs in den Ersten Weltkrieg am 1. August 1914 und die damit verbundene Schließung ihrer Schule zwang Hannah Höch, noch einmal zu ihren Eltern zurückzukehren, um in Gotha einige Monate für das Rote Kreuz zu arbeiten. Hannah Höch erlebt den Kriegsausbruch in Köln. Die Kunstgewerbeschule hatte ihr, gemeinsam mit drei Kommilitonen, ein Reisestipendium zur Werkbund-Ausstellung verliehen, die 1914 auf dem am rechten Rheinufer gelegenen Messegelände gezeigt wird. Der Werkbund war 1907 von zehn führenden Künstlern, Formgestaltern und Architekten ins Leben gerufen worden. Dazu zählten unter anderem Peter Behrens, Theodor Fischer, Joseph Hoffmann, aber auch Paul Schultze-Naumburg. Ziel der Gründung war es, deutsches Kunstgewerbe mit hohem künstlerischem Anspruch auf Weltmarktniveau zu bringen und der verbreiteten Devise »German goods are cheap and nasty« (deutsche Waren sind billig und scheußlich) entgegenzutreten. 23Seine Gründer legten die Ziele in ihrem Programm fest. Die Veredelung gewerblicher Arbeit und Steigerung der Qualität wurden festgeschrieben. Die Werkbundschau, die Hannah Höch besuchte, sollte maßgeblich Einfluss auf zukünftige künstlerische und architektonische Entwicklungen in Deutschland nehmen. Hannah Höch konnte in Köln unter anderem Bruno Tauts Glaspalast besichtigen, das utopische Sinnbild kristalliner Architektur.
In ihrem Lebensüberblick von 1958 schrieb Hannah Höch, sie sei vom Ersten Weltkrieg »überrascht« worden. Lange vor dem 1. August 1914 prägten Vorzeichen der Mobilmachung in Deutschland das Straßenbild. Hannah Höchs Blindheit für die Kriegseuphorie hing mit ihrer Einstellung zusammen. Anders als viele Altersgenossen, vor allem auch in Künstlerkreisen, verband sie mit der sich anbahnenden kriegerischen Auseinandersetzung keinerlei positive Vorstellungen: »Aus den schwerelosen Jugendjahren kommend und glühend mit meinem Studium beschäftigt, bedeutete diese Katastrophe den Einsturz meines damaligen Weltbildes. Ich übersah die Folgen für die Menschheit und für mich persönlich sofort und litt unter dem munteren Aufbruch meiner Umwelt in den Krieg sehr.« 24Ihr klares Bekenntnis zum Pazifismus wird Hannah Höchs persönlichen und künstlerischen Werdegang maßgeblich beeinflussen.
Zu Beginn des Jahres 1915, als die Kunstschulen trotz des Krieges ihren Unterricht wieder aufnehmen, kommt sie nach Berlin zurück und schreibt sich neu in die Klasse für Graphik und Buchkunst von Emil Orlik ein, diesmal an der staatlichen Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums. 25Der Krieg ist auch in dieser Institution täglich präsent. Teile des Gebäudes werden als Lazarett genutzt. Unter anderem befindet sich eine Nervenstation im Reservelazarett Kunstgewerbemuseum, wie die Notunterkunft militär-bürokratisch genannt wird. 26Geleitet wird sie von Richard Cassirer, dem Bruder des Galeristen Paul Cassirer.
Anders als ihre erste Ausbildungsstätte genießt die staatliche Unterrichtsanstalt einen progressiven Ruf. Die Schule bietet ihren Studenten künstlerischen Freiraum. 27Der Unterricht bei Orlik, der während eines Aufenthaltes in Japan vom asiatischen Farbholzschnitt beeinflusst wurde und diese Technik mit nach Europa brachte, bot ihr auf künstlerischem Niveau höchste Anforderungen. Schon bald nach ihrem Eintritt in seine Klasse stellte Orlik sie als Assistentin ein. Hannah Höch schnitt nach seinen Vorgaben Holzstöcke. Ihre Schule lag zwischen Potsdamer Platz und Anhalter Bahnhof in der Prinz-Albrecht-Straße 7. Das Architektenteam Martin Gropius und Heiko Schmieden errichtete Ende der 1870er Jahre das monumentale kubische Gebäude. Das Besondere an dieser Einrichtung war die enge Nachbarschaft zwischen der Sammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums, die zu den königlichen Museen zählte, und der Schule. Museum und Unterrichtsanstalt waren unter einem Dach untergebracht, wobei die Ausbildungseinrichtung im Nordflügel des Hauses lag. Die Studierenden lernten auf diese Weise problemlos hochwertige historische Zeugnisse handwerklich oder industriell hergestellter Produkte und Gebrauchsgegenstände kennen. Auch heute wird das Gebäude wieder für Ausstellungen genutzt. Es ist nach einem seiner Architekten Martin-Gro-pius-Bau benannt. Lehrer und Studenten der Schule standen in engem Austausch mit Kreisen der künstlerischen Avantgarde im Berlin der 1910er Jahre. Über Hannah Höchs Jugendfreundin und Studienkollegin Maria Uhden, die ebenfalls aus Gotha stammte und die bereits ein Jahr vor Höch in Berlin an der Kunstgewerbeschule zu studieren begonnen hatte, nahm sie erste Kontakte zum expressionistischen Künstlerkreis »Der Sturm« auf. Gründer und Namensvater der Vereinigung war der mit all seinen physischen und finanziellen Kräften für die Kunst kämpfende Schriftsteller, Musiker, Galerist und Verleger Herwarth Waiden. Ebenfalls Schüler in Orliks Klasse war George Grosz, mit dem Hannah Höch später, nach dem Ersten Weltkrieg, gemeinsam auf der »Ersten Internationalen DADA-Messe« in der Kunsthandlung Dr. Otto Burchard ausstellen wird. Allerdings hatte sie während ihres Studiums nur wenig Kontakt zu Grosz.
Hannah Höch hat ihre kunstgewerbliche Ausbildung auch später, als sie sich als freischaffende Künstlerin definiert, nie verleugnet. Vielmehr wird sie ihr technisches und handwerkliches Wissen in ihren Arbeitprozess integrieren. Und wie viele Künstlerkolleginnen ihrer Zeit interessiert sie sich weiterhin für ornamentale Strukturen von Stoffen und Stickereien. Mehrfach wird sie sich zum Ziel setzen, neue Tendenzen in der Kunst in den Bereich der Formgestaltung zu übertragen.
Im April 1915 lernt sie in der Bibliothek des Kunstgewerbemuseums, die den Studierenden auch in den vorgeschrittenen Abendstunden offenstand, ihre erste große Liebe kennen, Raoul Hausmann. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Mit Hausmann wird sie eine siebenjährige Liebesbeziehung verbinden, die von tiefer Nähe, aber auch zermürbenden Auseinandersetzungen und vielen Zerwürfnissen geprägt ist. Über eigene freundschaftliche Beziehungen und vor allem durch Hausmanns Bekanntenkreis lernte Hannah Höch all jene Künstler kennen, die sich zum Ende des Ersten Weltkrieges in der Berliner DADA-Bewegung formierten.
»Damen ohne Herrengesellschaft ist das Rauchen hier nicht gestattet«
Читать дальше