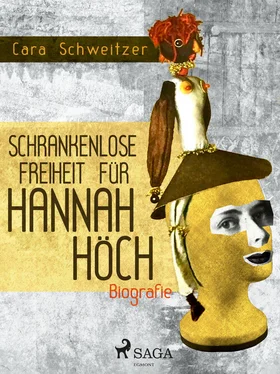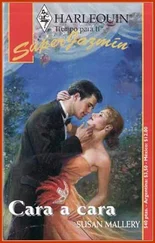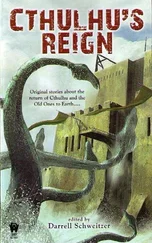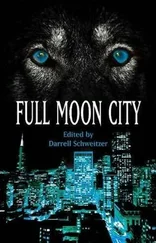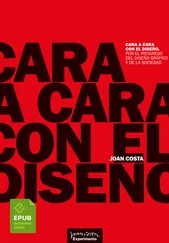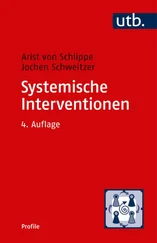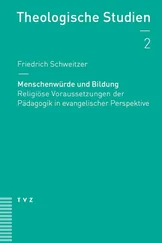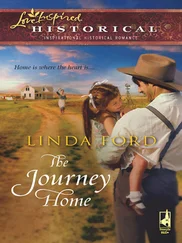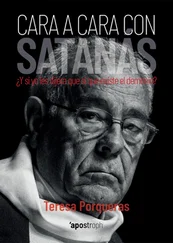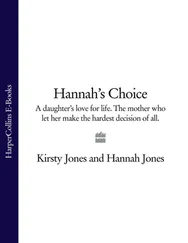Cara Schweitzer - Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch
Здесь есть возможность читать онлайн «Cara Schweitzer - Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Neben dem rein naturwissenschaftlichen Interesse – demonstrieren doch die verschiedensten Abstufungen von noch flüssigem Gestein hin zu schon gefestigten Auswürfen nichts weniger als die Entstehungsgeschichte der Erde – bietet der Berg einen brisanten zusätzlichen Kick. Ihre sportliche Aktivität und das Wissen um die potentielle Gefahr, jederzeit mit dem ganzen Haufen in die Luft fliegen zu können, erhöhen die Pulsfrequenz der beiden. Und ein Blick in die Zukunft bestätigt, dass schon dreieinhalb Jahre nachdem Hannah Höch und Kurt Heinz Matthies auf den Vesuv geklettert waren, die Katastrophe eintrat, die die meisten Vulkanbesucher, während sie zwischen Schwefelausdünstungen herumsteigen, nur als ein beklemmendes Gefühl erahnen, das ihnen die Begrenztheit des eigenen Seins vor Augen führt. Der Verlauf des Zweiten Weltkrieges traf die italienische Zivilbevölkerung in Neapel und Umgebung besonders hart. Zunächst bombardierten die Amerikaner das Gebiet und nach der Landung der Alliierten bei Salerno im September 1943 die Deutschen. Am 18. März 1944 kam es zum letzten Ausbruch des Berges, bei dem der kleine Krater im Inneren des Kegels vollständig zusammenbrach. Steine, Lava und Asche wurden in die Luft geschleudert. Nachfolgende Lavaströme zerstörten zwei Dörfer in der Umgebung. Vom Himmel fallende Gesteinsbrocken zertrümmerten eine Start- und Landebahn der Alliierten bei Terzigno und zahlreiche Flugzeuge. 8Den willkürlichen Eingriff des Berges in die Kämpfe des Zweiten Weltkriegs konnten Hannah Höch und Kurt Matthies nicht vorhersehen.
Quellen
Die vorliegende Lebensbeschreibung der Künstlerin stützt sich maßgeblich auf die mehrbändige Veröffentlichung ihres Nachlasses in der Berlinischen Galerie. Ausführlich ist darin das Leben Hannah Höchs dokumentiert und wissenschaftlich kommentiert. Zitate der Künstlerin und der Personen, denen sie begegnet ist, habe ich, soweit sie aus dem publizierten Nachlass der Berlinischen Galerie entnommen sind, in der entsprechenden Transkriptionsweise wiedergegeben. Nur an wenigen Stellen wurde die Orthographie der besseren Lesbarkeit halber korrigiert.
Neben zeitgenössischen Quellen und Selbstaussagen Hannah Höchs aus ihren Kalendern und Briefen an Freunde oder Kollegen benutzte ich ihre rückblickenden Kommentare, die sie etwa ihrem ersten Biographen Heinz Ohff gegenüber äußerte oder die in ihrem publizierten Lebensüberblick von 1958 nachzulesen sind. Diese retrospektiven Kommentare hat Hannah Höch autorisiert und nachträglich überarbeitet. In den Zitaten kommt die Künstlerin zu Wort. Ihre Selbstaussagen eröffnen einen Assoziationsraum, der Feinheiten ihrer zeitgenössischen und retrospektiven Sichtweisen erkennbar werden lässt.
Darüber hinaus dienten mir bisher unveröffentlichte Briefe von Til Brugman, der niederländischen Lebenspartnerin von Hannah Höch, als Quelle. Sie werden im Deutschen Kunstarchiv des Germanischen Nationalmuseums aufbewahrt.
Die Darstellung ihrer Beziehung zu Kurt Heinz Matthies stützt sich auf Autographen der Künstlerin aus den Gerichtsakten ihres späteren Ehemanns. Ich habe versucht, ihre Briefe in den Kontext der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der NS-Diktatur einzuordnen.
Ohne Hannah Höchs Vorgeschichte, ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen in dem gutbürgerlichen Elternhaus in Gotha, ihre erste Liebe zu Raoul Hausmann und ihre Teilhabe am Kreis der Berliner Dadaisten, ihre Partizipation an der Berliner Kunstszene der zwanziger Jahre sowie ihre Beziehung zu der holländischen Schriftstellerin Til Brugman ließe sich das Leben der Künstlerin unter der NS-Diktatur kaum beschreiben. Die einleitenden Kapitel enthalten jedoch nur wenige neue Forschungsergebnisse. Sie stützen sich auf die umfangreiche kunsthistorische Fachliteratur, die mittlerweile zu diesem Lebensabschnitt von Hannah Höch existiert.
1. Kapitel
»Kunstgewerblerin war immerhin nicht Künstlerin«
Kindheit und Ausbildung
(1889–1915)
Am 1. November 1889 wird Hannah Höch, deren vollständiger Geburtsname Anna Therese Johanne lautet, als ältestes von fünf Kindern in der thüringischen Residenzstadt Gotha geboren. Sie wächst in behüteten bürgerlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater, Friedrich Höch, ist Generalagent der Württembergischen Feuerversicherung und baut als Subdirektor die Niederlassung der Stuttgarter-Berliner Versicherungsanstalt für Thüringen aus. 1Ihre Mutter Rosa Höch, geborene Sachs, war vor ihrer Eheschließung in den Häusern adliger Damen als Haushaltsvorsteherin und Vorleserin tätig. 2Wie in vielen bürgerlichen Familien zählte künstlerische Bildung zum guten Ton bei den Höchs. Die Mutter fördert Hannah Höchs Freude am Zeichnen und Malen. Auch sie selbst ging »bescheidenen künstlerischen Ambitionen« nach und »malte nach Vorlagen« Ölbilder. 3Mit einer kurzen berufsbedingten Unterbrechung, die die Höchs nach der Geburt ihrer ersten Tochter nach Weimar führt, lebt die Familie in Gotha, in einem dreistöckigen Gründerzeithaus in der Kaiserstraße 28, die heute 18.-März-Straße heißt. 4Die Fassade des Höch’schen Wohnhauses erscheint wohlgeordnet, wenige schlichte Stuckelemente gliedern die Front. Das Gebäude wirkt großzügig, aber nicht protzig. Hinter dem Haus öffnet sich ein Garten, der an eine kleine Parkanlage angrenzt, die zum Gut des Barons von Leesen gehört. 5Für das Familienleben und die intensive Beziehung zwischen Hannah Höch und ihrem Vater ist der Garten von zentraler Bedeutung. Den grünen Daumen hat sie offenbar von Friedrich Höch geerbt: »Mittags, zwischen zwölf und zwei Uhr, wenn die Büros geschlossen waren, pflegte mein Vater seinen Rosengarten, und ich lernte dabei helfend, schon mit sechs oder sieben Jahren, Rosen veredeln. Ich musste den Bast aufbinden, für die richtige Feuchtigkeit sorgen, das Okuliermesser reichen.« 6Ihre Familie bedeutet Hannah Höch sehr viel. Hier findet sie Verständnis und Rückhalt auch in schwierigen Lebenssituationen. Die Geborgenheit erzeugt in ihr einen großen Schatz an Vertrauen. Dieses Lebensgefühl trägt sie in sich und es bietet ihr in Krisensituationen Halt. Dennoch hat sie für das harmonische Zusammenleben in der Familie auf ihr wichtige Anliegen und Ziele verzichten müssen. 1904 verlässt Hannah Höch auf Wunsch der Eltern vorzeitig als Fünfzehnjährige die Höhere Töchterschule. Eigentlich hatte ihr die Schule viel Spaß bereitet, und der Unterrichtsstoff in vielen Fächern, auch in den Naturwissenschaften, interessierte sie. Der Grund für ihr vorzeitiges Ausscheiden aus der Schule lag in der Geburt der jüngsten Schwester Marianne, genannt Anni oder Nitte (1904–1994) begründet. 7Hannah Höch sollte als älteste Schwester die Mutter bei der Betreuung und Erziehung unterstützen und Verantwortung in der Familie übernehmen. Als die Kleine drei Tage alt ist, übernimmt Hannah Höch die Säuglingspflege. Sie wird die Schwester bis zur Einschulung betreuen. 8»Ich liebte dieses Kind sehr, aber dadurch zögerte sich zu meinem großen Kummer mein Studium beträchtlich hinaus – sehr zur Befriedigung meines Vaters, der ein Mädchen verheiratet wissen, aber nicht Kunst studieren lassen wollte, was übrigens um 1900 noch der allgemeinen bürgerlichen Ansicht entsprach.« 9
Ein um 1905 entstandenes Foto zeigt die etwa sechzehnjährige Johanne Höch in einem weißen, mit Rosen und Blüten geschmückten Ballkleid. Aufrecht sitzend schaut sie stolz aus dem Bild (Abb. 1). Die junge Frau scheint den für sie vorbestimmten Weg anzunehmen, wenn da nur nicht dieser selbstbewusste Blick wäre.
Um die praktischen und kaufmännischen Fähigkeiten seiner Tochter weiter zu fördern, verlangt der Vater von Hannah Höch, dass sie ihn ein Jahr lang in seinem Versicherungsbüro unterstützt. 10Trotz der klaren Vorstellungen des Vaters über den weiteren Lebensweg seiner Tochter, der nicht ihren eigenen Wünschen entsprach, beschreibt Hannah Höch das Verhältnis zu ihm als liebevoll und positiv. Friedrich Höch stellt mit seiner Lebenshaltung und seinem pädagogischen Konzept keine Ausnahme unter den bürgerlichen Familien in Deutschland vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs dar. Hannah Höchs Biographie entspricht bis dahin dem typischen Bild einer behüteten Tochter aus bürgerlichem Hause. Doch all die Versuche der Eltern, ihre Tochter zu einem »bodenständigen« Beruf zu bewegen, scheitern an Hannah Höchs starkem Willen: »Lieber will ich mich in Berlin zu Tode schuften, als dass ich einen Tag länger in Gotha bliebe.« So jedenfalls schilderte sie retrospektiv ihren Entschluss, als junge Frau ihrer Heimatstadt den Rücken zu kehren, in dem 1977 von Hans Cürlis gedrehten Film »Hannah Höch – jung geblieben«. 11Erst acht Jahre nachdem sie von der Schule abging, fast zweiundzwanzigjährig, verlässt sie 1912 die wohlgeordneten Verhältnisse und zieht nach Berlin. Trotz vieler Vorbehalte der Eltern beginnt sie eine Ausbildung an der privaten Kunstgewerbeschule Charlottenburg, wo sie in die von Harold Bengen geleitete Klasse für Gestaltung aufgenommen wird. 12Bengen war selbst Maler und hatte 1910 unter anderem mit Max Pechstein gemeinsam die Neue Sezession in Berlin gegründet. Sein künstlerischer Ruf basierte auf Entwürfen für Mosaiken und Glasfenster. Er gestaltete Teile der ornamentalen Ausschmückung für das Museum in Magdeburg, das Friedenauer Rathaus und die Berliner Charité. Die Charlottenburger Kunstgewerbeschule war den Ausbildungstraditionen des 19. Jahrhunderts verpflicht. Das Entwerfen und Zeichnen von Ornamenten, Kalligraphie und Schriftgestaltung bestimmten das Curriculum, wobei das Kopieren historischer Vorlagen einen zentralen Stellenwert einnahm. 13Ursprünglich war es Hannah Höchs oberstes Ziel, an einer Akademie freie Kunst zu studieren. Doch die Erfüllung dieses Traumes wäre eine allzu provokative Entscheidung gegen die Pläne ihrer Eltern gewesen. »Kunstgewerblerin war immerhin nicht Künstlerin«. 14Kunstgewerbeschulen etablierten sich seit dem späten 19. Jahrhundert zusehends in Deutschland. Die Ausbildung setzte einen starken Akzent auf die praktische Anwendbarkeit des Gelernten und auf fundierte Kenntnisse handwerklicher Techniken. Das Angebot war breit gefächert. Entwerfen von Stoff- und Tapetenmustern, das Gestalten von Schnittmustern und das Erlernen druckgrafischer Verfahren zählte ebenso zum Curriculum wie Techniken der Glasmalerei. Vieles, was an diesen Schulen unterrichtet wurde, konnte sinnvoll in einem handwerklichen Beruf oder in der industriellen Warenproduktion eingesetzt werden. Es war ebenso in einem bürgerlichen Haushalt von Nutzen. Dieser Aspekt scheint, trotz der tendenziell eher liberalen und der Kunst durchaus zugeneigten Erziehung im Hause Höch, bei der Zustimmung der Eltern eine Rolle gespielt zu haben. An den Kunstakademien hingegen wurden die Studenten zu »freien« Künstlern in der sogenannten »hohen« oder »freien« Kunst ausgebildet, auch wenn aus heutiger Sicht der Lehrplan mit seinen verpflichtenden Kursen wie dem Zeichnen vor Originalen verschult wirkt. 15In der rückblickenden Äußerung Hannah Höchs klingt an, dass sie wohl nicht nur mit den im Großen und Ganzen ihr sehr wohlwollenden Eltern Schwierigkeiten bekommen hätte, wenn sie sich an einer Kunsthochschule oder Akademie für den Bereich »freie Malerei« beworben hätte. Ein Universitätsstudium war Frauen in Preußen offiziell erst seit wenigen Jahren, seit dem Wintersemester 1908/1909, gestattet. 16Als Hannah Höch ihre Ausbildung in Berlin beginnt, herrschen nach wie vor starke politische und gesellschaftliche Ressentiments gegen den gleichberechtigten Zugang von Frauen und Männern zu Bildungseinrichtungen. Die rückschrittliche Haltung in Deutschland demonstriert ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern, wie etwa der Schweiz, die bereits in den 1840er Jahren erste Gasthörerinnen akzeptierte und bald darauf auch die Vollimmatrikulation von Frauen erlaubte. Ähnliches gilt für Frankreich, Schweden, Dänemark und Belgien und die USA, in denen sich nach englischem Vorbild Frauen-Colleges etablierten. 17Nicht nur in den medizinischen, theologischen und juristischen Fakultäten sind starke Vorbehalte gegen das Frauenstudium verbreitet. Vor allem die Kunstakademien verweigerten ihnen den Zugang zur Ausbildung. Einzelne renommierte Kunsthochschulen wie etwa die Münchner Akademie setzten in ihren Statuten noch 1911 fest, dass sie ihren Bildungsauftrag ausschließlich in der Schulung von »jungen Männern« definierten, »welche die Kunst als Lebensberuf gewählt haben«. Ihnen seien »jene Kenntnisse zu vermitteln, deren sie zur selbstständigen erfolgreichen Ausübung des Künstlerberufes bedürfen«. 18Erst nach dem Ersten Weltkrieg konnte sich auch die Münchner Kunstakademie auf Grund des in der Weimarer Verfassung festgeschriebenen Gleichheitsprinzips nicht länger der Immatrikulation von Studentinnen verschließen. Die frauenfeindliche Haltung der Akademien spiegelt sich auch in der allgemein verbreiteten Abneigung wider, die die spätwilhelminische Gesellschaft Künstlerinnen entgegenbrachte. In Satirezeitschriften wie dem »Simplicissimus« oder auch in sonst so fortschrittlichen Kunstjournalen wie der »Jugend« wurden bartwüchsige Künstlerinnen in Männerkleidung und Herrenschnitt vor der Staffelei stehend als »Malweiber« diskreditiert, die, falls sie es je zu künstlerischen Leistungen bringen sollten und nicht im Dilettantismus verharrten, zu halben Männern mutieren würden. 19Die Vorstellung, dass eine ernstzunehmende Künstlerin notwendigerweise einen Verwandlungsprozess durchlaufen müsse, der einer Geschlechtsumwandlung gleichkommt, entsprang einer abwehrenden Einstellung gegenüber Frauen, die einem intellektuellen Beruf nachgingen. Kritiker sprachen Frauen auf Grund ihrer angeblichen psychischen und biologischen Konstitution die Fähigkeit ab, selbständig neue künstlerische Ideen zu entwickeln. 20Zu diesem Urteil trugen Theorien über die »Biologie« der Frau aus dem Bereich der Naturwissenschaften bei. Frauen dichtete man auf Grund ihres Geschlechts einen Mangel an Erfindergabe, an »inventio«, an, die jedoch als maßgebliches Zeichen künstlerischer Genialität galt. Eben diese Begabung bestimmte wenige Ausgewählte und selbstverständlich nur Männer zu Künstlern. Hierin unterschied sich der Künstler, der nach seiner freien Eingebung Neues schafft, von den Kunstgewerbetreibenden, die nach Vorgaben und Aufträgen angewandte oder gewerbliche Arbeiten ausführten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Schrankenlose Freiheit für Hannah Höch» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.