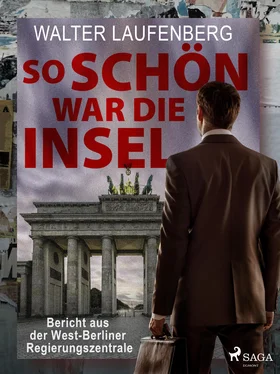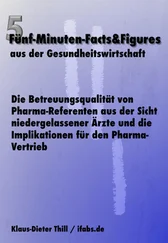Hilf Himmel, wie komme ich nur wieder vom Transitvisum los? Den Partner nicht mehr anschauen, überhaupt nicht mehr hinhören. Frechheit, denkt er, einem so ein mieses Zettelchen zu geben, ohne jeden Versuch einer künstlerischen Gestaltung, wo doch Briefmarken und Münzen und Porzellan von erstklassigen Künstlern entworfen werden. Ich will einfach nichts mehr davon hören. Erledigt, aus. – Doch ein passionierter Sammler läßt sich nicht so leicht abschütteln. Dafür ist seine Sache viel zu wichtig. Und deshalb auch er selbst. Ärgerlich. Jetzt hast du es wieder bestätigt gekriegt, sagt er sich: Die Leute, die man so trifft, sind nur solange interessant, wie man nicht weiß, was sie tun und sind. So grübelt und gründelt er langsam auf Potsdam zu, immer strenger werdend in seinen Überlegungen. Dann endlich hat er was:
„Aber“, sagt er unvermittelt, „ist das nicht Mißbrauch des Transitabkommens von 1971, genaugenommen, wenn Sie sich nicht ein Transitvisum ausstellen lassen, weil Sie die Transitstrecke benutzen wollen, sondern die Transitstrecke benutzen, nur um ein Transitvisum zu ergattern? Und das immer wieder. Sozusagen als ein Serientäter.“
Mit weitaufgerissenen Augen und Nasenlöchern und klaffendem Mund starrt der Sammler ihn an, einen Moment lang tonlos. Dann aber: „Nein, nein, um Gottes willen“, greift er sich ans Herz, „so kann man das doch nicht sehen. Sagen Sie, daß man das so nicht sehen kann. Ich habe immer eine Fahrkarte zum vollen Preis gekauft, und ich habe mich immer absolut korrekt verhalten, kein Wort gesagt bei den Paßkontrollen, da habe ich stets drauf geachtet, um ja keinen Anlaß für eine Verdachtskontrolle in der Baracke zu geben. Aber wenn Sie das so sagen –.“ Und schweigt atemlos, erst blaß, dann wie in die Farbvariable getaucht, mal mehr rot und mal mehr violett im Gesicht.
Es ist kurz nach zwanzig Uhr, als die Grenzposten wieder durch den Speisewagen kommen. Der Sammler plötzlich wieder leichenfarben. Die Männer aber streben mit schnellen Schritten und zufriedenen Ladenschlußgesichtem dem Zugende zu.
Die Vorortbahnhöfe Berlins werden ohne Halt und nur im Bummeltempo passiert: Wildpark – da steht noch eine verfallende Prachthalle abseits, einst für den Empfang des Kaisers geschmückt –, dann Babelsberg und schließlich Griebnitzsee, das andere Ende der Reuse. In Griebnitzsee steigen die Uniformierten aus, auf dem Bahnsteig von Kollegen und Schäferhunden erwartet. Daß es immer Schäferhunde sein müssen, überlegt er. Eigentlich ein gutes Zeichen: Wir Deutschen sind ein bukolisch empfindendes Völkchen. Mindestens fünfmal waren sie durch den Zug gezogen, die Uniformierten, im Gänsemarsch. So ein Schutz, denkt er. Sein Gegenüber ist verstummt. So hat er Muße, sich einmal die Mauer aus der Nähe zu betrachten: grau und übermannshoch und mit einer ebenfalls grauen Rolle obendrauf, an der wohl die Hände abgleiten sollen, wenn einer drüberzuklettern versucht. Was ohnedies ein schlimmes Ende nehmen würde, denn hier sieht er hinter der Mauer einen breiten Riegel von rostbraunen Eisenmatten liegen, mit hohen Stacheln dicht an dicht. Selbst einen gestandenen Fakir müßte dieser Teppich an der Welt verzweifeln lassen. Liegen die Matten nun vor oder hinter der Mauer? Das ist eine überflüssige Frage, weil die Öffnungen, durch die der Zug fährt, ja reusenartig gebaut sind. Aber daß wir aus der Reuse überhaupt wieder hinausdürfen, das ist schon grandios. Das verdanken wir fraglos dem Transitvisum – und den vielen Millionen harter D-Mark, die Bonn dafür zahlt.
Um 20 Uhr 30 in Berlin-Wannsee. Die letzten fünfzehn Kilometer bis zum Bahnhof Zoo unterscheiden sich deutlich von der gerade durchfahrenen Strecke: Die ganz andere Art von Autos auf den Straßen markiert den Bühnenwechsel. „Ich vermute, jetzt sind wir wieder auf deutschem Boden oder nicht?“ fragt er sein Gegenüber. Und ergänzt, als er dessen irritiertes Suchen nach einer passenden Antwort bemerkt: „Ich meine, wir sind in, wie soll ich sagen, na ja, Sie wissen schon.“ Klingt ja auch viel zu pathetisch, das mit der freien Welt, überlegt er.
„Tschuldigung“, springt der Mann plötzlich auf, wiederbelebt. „Dürfte ich Sie wohl um Ihr Transitvisum bitten? Sie brauchen es ja jetzt nicht mehr, und ich, ich sammle doch das Gebiet, und nun – nun war das meine letzte Reise. Zurück werde ich fliegen, vorsichtshalber.“ Und dann hurtig von Tisch zu Tisch mit seiner Bitte. Und ab in den nächsten Wagen: eine Sammlerpersönlichkeit, ungebrochen.
Pünktlich 20 Uhr 46 läuft der Zug in Bahnhof Zoo ein. In dem Menschengewirr dort kann er seinen Gesprächspartner leider nicht mehr ausmachen. Zu spät, um sich dafür zu entschuldigen, daß er ihm die Komplettierung seiner Sammlung vermasselt hat.
Auch ich in Berlin, sagt er sich. Und wenn schon nicht in Arkadien, so doch an der Sollbruchstelle der Welt. Und ich habe hier eine wichtige Funktion. Den Bruch zu verhindern? Nicht ganz das. Vielleicht eher: Darzustellen, daß er längst keiner mehr ist. Daß die Risse gut verheilt sind. Nur noch liebevoll gehätschelte Narben. Triumphierend vorgezeigt.
Ein Kapitol im Kopf, so ein amerikanisch-süßes Plastikwunder von Kapitol im Kopf, mit Monstersäulen, griechisch-putzigem Architraph und hoher Petersdomkuppel, in der schönsten Kodacolorsonne glänzend. Wie sich das für einen Regierungssitz gehört. Um dann, aus dem überfüllten Frühbus gequetscht, das da vor sich zu sehen: Ein Grautier, störrisch-steif, den kantigen Kopf hochgereckt, im Regen, Regen, Regen. An einem Aprilmorgen, so triefäugig, daß er sogar noch alles Grau zum Glänzen bringt. Laß alle Hoffnung fahren und nichts wie hinein, sagt er sich, hinein ins Rathaus Schöneberg, den provisorischen Regierungssitz der freien Stadt Berlin (West).
Da sieht er vor sich ein Schild mit der Aufschrift: Bitte Hausausweis vorzeigen!, kaum daß er durch die schwer aufzuwuchtende Bronzetür ist. Eine breite Treppe, und oben auf dem Treppenabsatz vor ihrer Portiersloge stehen sie. Schon wieder Uniformierte, diesmal in grau. Sie stoppen ihn mit dröhnendstummen Hoheitsblicken. Er sagt: „Guten Morgen“, stellt sich vor mit: „Mein Name ist Schmitt, Doktor Orpheus Schmitt mit Doppeltee“ und erklärt auch gleich: „Ich bin der neue Referatsleiter in der Senatskanzlei.“
„Ihr Hausausweis!“
„Habe ich noch nicht, werde ich mich aber sofort drum kümmern. Ich muß nur erst einmal mein Büro gefunden haben.“
„Da kann ja jeda kommen“, berlinert es ihn so wenig subaltern an, daß er prompt einen ersten Anfall von Unernsthaftigkeit am falschen Ort kriegt und lacht, lacht, während er das letzte amtliche Schreiben mit der Angabe seines Dienstbeginns rauskramt und überreicht. Lacht, bis die Grauen endlich mitlachen und ihn durchlassen: „Bitte, Herr Doktor.“
Jetzt weiß ich also, wofür ich mich dazu durchgerungen habe, den freien Autor und Gelegenheitstexter aus- und den Bürokraten anzuziehen, meine heimische Klause gegen das hier, den Sitz der Landesregierung und des Parlaments von Berlin, einzutauschen: Nicht nur wegen Beate, nicht weil sie mich dazu gezwungen hat, nein, auch um denen hier zu zeigen, denen allen, bei den untersten Rängen der Machtelite angefangen, daß ich nicht „jeda“ bin. Wenn mir auch die Werbeaufträge ausgegangen sind – die wirtschaftliche Rezession halt – und ich all meine Ersparnisse aufgebraucht habe und meine Schriftstellerei noch so gut wie nichts einbringt, „jeda“ bin ich deshalb doch nicht.
Aber wie hat der eine Graue zuletzt gesagt? „Bitte, Herr Doktor.“ Eigentlich auch ganz schön, plötzlich wer zu sein, wo alle was sind, so förmlich mit Titel angeredet zu werden, macht er sich Mut, als er die Treppe zur Beletage hinaufsteigt. Und ein Direktorgehalt zu beziehen. Ich werde aufpassen müssen, daß ich hier nicht hängenbleibe. Aber, aber, – erst mal an die Arbeit!
Читать дальше