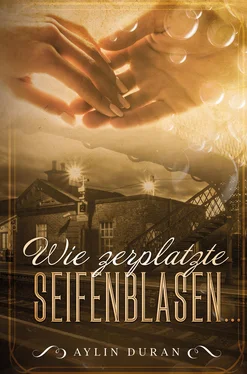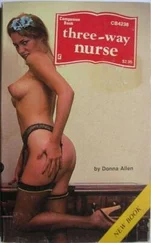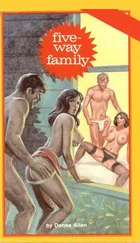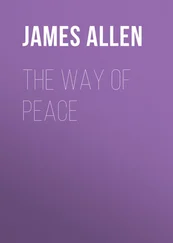Aylin Duran - Wie zerplatzte Seifenblasen ...
Здесь есть возможность читать онлайн «Aylin Duran - Wie zerplatzte Seifenblasen ...» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Wie zerplatzte Seifenblasen ...
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Wie zerplatzte Seifenblasen ...: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Wie zerplatzte Seifenblasen ...»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Wie zerplatzte Seifenblasen ... — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Wie zerplatzte Seifenblasen ...», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Cagney nahm ihm die Flasche ab. „Du?“, lachte er ungläubig.
Auch ich konnte mir Ben nicht in einer Prügelei vorstellen. Bei näherer Betrachtung vermittelte einem sein Körperbau nämlich eher, dass er das Weite suchte, sobald er sich in eine gefährliche Situation manövriert hatte. Ben schienen unsere Zweifel nicht im Geringsten zu interessieren. „Natürlich ich!“ Er nahm einen weiteren Schluck. Cagney und ich wechselten einen zweifelnden Blick. „Ihr glaubt mir nicht!“, bemerkte Ben beleidigt.
Ich zuckte mit den Schultern und passte, als Cagney die Flasche an mich weitergeben wollte, nachdem auch er einen kräftigen Schluck genommen hatte.
„Ich musste meinen Bruder verteidigen. Das war Ehrensache“, erläuterte Ben, obwohl niemand ihn danach gefragt hatte.
Die Flasche stand jetzt in der Mitte des Kreises, den wir gebildet hatten, und es war still im Raum geworden. Gespannt wartete ich darauf, dass Ben noch mehr erzählte. Ich stellte mir vor, wie er zu seinem Bruder hielt, wie er ihn beschützen wollte. Und plötzlich gefiel er mir noch besser. Erst als Cagney sich laut und vernehmlich räusperte, merkte ich, dass ich Ben anstarrte und sich ein bescheuertes Grinsen in meinem Gesicht ausgebreitet hatte. Ich schluckte unbehaglich und konzentrierte mich darauf, die Fusseln auf dem Teppich zu zählen, um mich nicht in weitere peinliche Situationen zu manövrieren. „Du bist dran, Cagney“, sagte ich.
Er nickte, machte aber keine Anstalten, mit dem Spiel fortzufahren. Stattdessen saß er stumm und im Schneidersitz in unserem Kreis auf dem Teppich und schaute von Ben zu mir. Dann wieder zu Ben. Zurück zu mir. Dabei sah er irgendwie fassungslos aus. Zwar wollte ich mir das nicht eingestehen, aber es kränkte mich. Es kränkte mich sehr.
Meine Mutter rief täglich an und versuchte, mich zu überreden, nach Hause zu kommen. Irgendwann begann ich, sie zu ignorieren. Ich rief sie nicht zurück und ich hörte auch die verzweifelten Nachrichten nicht ab, die sie mir auf meiner Mailbox hinterließ. Ben rief niemand an – oder ich bekam es nicht mit. Ich wusste nicht wirklich, wo ich war oder was ich eigentlich machte – aber ich fühlte mich, als wäre ich an der richtigen Stelle. Für den Moment fühlte sich dieser Zustand zu gut an, um an etwas anderes zu denken.
Als ich mit Ben darüber geredet hatte, konnte er es mit seinen Worten auf den Punkt bringen: „Was zählt, ist der Moment.“
Und wir taten Tag für Tag nichts anderes, als diesen Moment zu leben, zu lieben und zu ehren. Die Zeit, die ich mit Ben verbrachte, erschien mir kostbar. Ich versuchte, mir jede dieser wertvollen, gemeinsamen Minuten einzuprägen. Es entwickelte sich eine untypische Freundschaft zwischen uns, eine Freundschaft, die weder Worte noch große Taten brauchte. Eine Freundschaft, die daraus bestand, gemeinsam zu schweigen. Gemeinsam die wärmenden Strahlen der Sonne zu genießen, sich die Pizza zu teilen, dem Rauschen des Wassers zuzuhören und über unwichtige Dinge zu quatschen. Niemand konnte uns unsere Leichtigkeit nehmen, wir achteten schließlich selbst darauf, dass die Unbeschwertheit nie gefährdet wurde.
„Cagney und ich haben etwas verdammt Cooles gefunden“, erzählte mir Ben aufgeregt, als die zweite Woche angebrochen war.
Ich hatte Cagney seit den Trinkspielen in Bens Zimmer nicht mehr gesehen. Es interessierte mich nicht, was die beiden Tolles gefunden hatten, und ich beschränkte mich darauf, lustlos in meinem Müsli herumzurühren. „Keinen Hunger mehr?“, fragte Ben, der mich aufmerksam beobachtet hatte.
„Nicht wirklich“, gab ich zurück.
Er streckte die Hand nach der Müslischale aus und ich reichte sie ihm über den Tisch. Er hielt die Schüssel schief. Kleine Milchtropfen sprenkelten über den Holztisch. Mit vollem Mund begann er dann zu erzählen: „Wir haben versucht, ein bisschen rauszukommen aus der Stadt. Wir sind ein Stückchen gelaufen und dann ... “ Er hob die Schüssel an, um die übrig gebliebene Milch auszuschlürfen.
Stirnrunzelnd sah ich ihm dabei zu. „Und dann?“, hakte ich nach, als er nicht weitersprach.
„Das kann man nicht beschreiben“, behauptete er. „Das muss man gesehen haben. Es würde sich blöd anhören, wenn ich es dir nur erzählen würde.“
Ich lächelte. „Also?“
„Na ja … Ich denke, ich sollte dir das nach dem Frühstück zeigen.“
Wir verließen das Hostel, direkt nachdem Ben in den Gemeinschaftsräumen seinen Milchbart abgewaschen hatte. Obwohl ich am Himmel zahlreiche Schleierwolken sehen konnte, war es warm, als wir das Foyer verließen und nebeneinander auf der Straße vor unserem Hostel standen.
„Da lang“, wies Ben mich an und deutete auf einen schmalen Weg, der scheinbar ins Nirgendwo zu führen schien. Rechts und links entlang des Weges blühten Gänseblümchen und riesiger Löwenzahn, die den Anschein erweckten, dass sich niemand um die Grünflächen und das Unkraut kümmerte.
„Wohin soll das führen, wenn ich fragen darf?“
Ben schob mich einfach vorwärts, als hätte er meinen skeptischen Tonfall und meine Frage einfach überhört. Seine Hände berührten meinen Rücken, als wäre ich blind und er müsste mich führen. Die Berührungen seiner Hände an meinen Schulterblättern genoss ich, das konnte ich nicht leugnen. Komisch, wie schön solche riesigen, schwieligen Hände sein können.
„Es ist nicht weit, vielleicht zehn Minuten“, informierte mich Ben.
Im Laufen drehte ich mich zu ihm um. „Hoffentlich ist es das wert“, erwiderte ich, obwohl ich ihm vermutlich auch gefolgt wäre, wenn wir zwei Stunden hätten laufen müssen. Oder noch länger.
„Glaub mir, ich weiß, es ist das wert“, sagte Ben bestimmt.
Und ich glaubte ihm. Er führte mich den Weg entlang, bis die Rasenflächen an den Seiten endeten und ich plötzlich Lärm vernahm. Geräusche, die Autos bei schneller Geschwindigkeit machten. Fernes Rauschen.
„Pass auf!“, sagte er gespannt. Dann sah ich, wo er mich hingeführt hatte: Wir standen auf einer Autobahnbrücke. „Es fühlt sich an, als würde alles vorbeifliegen, nicht?“, fragte Ben und deutete nach unten auf die Autos und Lkw. Mit den Fingern umklammerte ich die kühlen, grün bepinselten Eisenstäbe, die uns davon abhielten, in die Tiefe zu stürzen. Unter uns rauschten die Autos auf der Straße entlang, eines nach dem anderen, in jedem Auto eine Person, ein Leben, eine Geschichte. Doch kaum hatte ich mich auf eines konzentriert, verschwand das Auto wieder.
„Wahr“, sagte ich fasziniert. Es war komisch, hier oben zu stehen, nach unten zu sehen und keinen Bezug zu den Menschen unter uns zu haben, obwohl wir nur Meter von ihnen entfernt waren und sie sehen konnten.
Ben zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich mit dem Oberkörper gegen die Eisenstäbe. Er beugte sich immer tiefer hinunter, sah den Autos entgegen und lachte leise. „Schon komisch“, sagte er und blies mir dabei den Zigarettenrauch ins Gesicht. „Schon komisch, wie schnell sie da sind – und wie schnell sie wieder verschwinden.“ Er klopfte mit dem Finger auf die Zigarette und ich beobachtete, wie sich Asche löste und langsam von der Brücke herabsegelte. Bald hatte ich die winzigen schwarz-weißen Pünktchen aus den Augen verloren. „Es ist ... gewissermaßen zu schnell“, sagte Ben.
Ich hatte keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. „Was meinst du?“ Mit meinem Rücken an den Stäben sank ich hinunter auf den Asphalt und streckte die Füße aus.
Er sah zu mir hinunter, blieb aber stehen und setzte sich nicht zu mir auf den Boden. „Ich meine: Es ist zu schnell, wie die Menschen sich bewegen. Sie verlieren das Wesentliche aus den Augen, sie kriegen nicht einmal mehr mit, was auf der Reise passiert, weil sie so auf das Ziel konzentriert sind. Aber hier oben ist es so, als würde die Zeit stillstehen. Aber nur für uns. Und da unten ...“ Ben deutete auf die Straße und die vorbeifliegenden Autos. „Da unten läuft sie weiter.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Wie zerplatzte Seifenblasen ...»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Wie zerplatzte Seifenblasen ...» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Wie zerplatzte Seifenblasen ...» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.