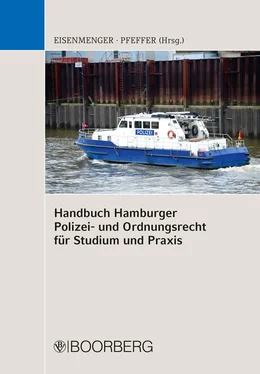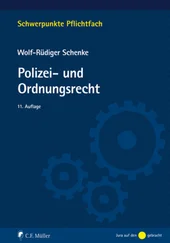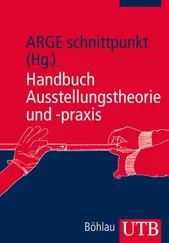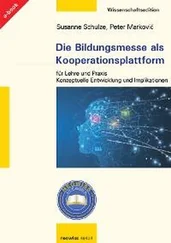Beispiel:
Nachbarn melden der Hamburger Polizei am Morgen „einen arabisch aussehenden Mann“, der einen schwarzen „Sprengstoffgürtel“ trägt und an der Ampel in Hamburg-Hamm „herumtänzelte“, bevor er in die gegenüberliegende Filiale der Agentur für Arbeit lief. 30 Streifenwagen mit 60 Einsatzkräften der Hamburger Polizei riegelten daraufhin das Gebäude ab. Schwerbewaffnete Spezialeinheiten stürmen die Filiale. Sie treffen auf den vermeintlichen Attentäter, einen Zahnarzt mit arabischen Wurzeln, der beim Joggen einen Gewichtsgürtel trug und seine Zahnarztpraxis in dem Gebäude hat. 279Die erhebliche Gefahr für Leib und Leben rechtfertigt dennoch die Annahme einer Gefahr. Die Maßnahmen waren danach rechtmäßig.
145
Des Weiteren muss ein Schaden an einem geschützten Rechtsgutdrohen oder eingetreten sein. Nach h. M. ist hierbei auf den durchschnittlich empfindenden Normalbürger abzustellen 280und die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) zu berücksichtigen. Die außergewöhnliche Empfindsamkeit Einzelner ist hingegen kein Maßstab. 281
Insbesondere genügen bloße Belästigungen, Nachteile, Geschmacklosigkeiten oder Unbequemlichkeit noch nicht. 282Ort und Zeit spielen bei der Bewertung aber eine Rolle. 283Anzahl und Dauer von Belästigungen können zudem ein solches Maß erreichen, dass sie die Schwelle zum „Schaden“ und damit zur „Gefahr“ überschreiten (anhaltendes Hundegebell zur Nachtzeit, übermäßiges Glockengeläut, Gestank einer Schweinemästerei). 284Einige Tatbestände „der Belästigung“ sind von § 118 OWiG bzw. § 119 OWiG erfasst und bußgeldbewert („grob ungehörige“ bzw. „sexuell anstößige“ Handlungen). Liegen diese vor, handelt es sich um eine Störung der öffentlichen Sicherheit.
146
Die Anscheinsgefahrbezeichnet eine Situation, in der der sorgfältige und durchschnittliche Beamte aus der Sicht ex ante aufgrund hinreichender Anhaltspunkte eine Gefahr annehmen musste, sich aber später herausstellt, dass gar kein Schaden drohte, also aus der Sicht ex post keine Gefahr vorlag. 285Weil es beim Gefahrenbegriff auf die Prognose eines verständigen Beobachters ex ante ankommt (dazu oben), wobei bei diesem nach h. M. die Kenntnis eines sorgfältigen Durchschnittsbeamten zu unterstellen ist (dazu oben), handelt es sich bei der Anscheinsgefahr um eine „echte“ konkrete Gefahrim polizeirechtlichen Sinne, die zum Einschreiten berechtigt. Die zu ihrer Abwehr getroffenen Maßnahmen gelten daher als rechtmäßig. 286
Beispiel:
Die Stürmung einer von außen nicht einsehbaren Wohnung nach lautstarken Schreien, wenn sich nachher herausstellt, dass der Fernseher („Tatort“) eines Schwerhörigen die Ursache war.
147
Selbstständige Bedeutung erlangt die „Anscheinsgefahr“ immer dann, wenn es später darum geht, ob der „Anscheinsstörer“ die Kosten der ordnungsbehördlichen bzw. polizeilichen Maßnahme zu tragen hat (dazu unter B. V.).
148
Die Scheingefahr, auch Putativgefahrgenannt, bezeichnet hingegen eine Situation, bei der der Beamte aufgrund eines vorwerfbaren Irrtumseine Gefahr angenommen hat, obwohl bereits aus der Sicht eines verständigen Betrachters, also auch aus der Sicht eines sorgfältigen Durchschnittsbeamten, ex ante keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Gefahr vorlagen und die Situation sich auch ex post als ungefährlich darstellt. 287Daher ist die Scheingefahr keine „echte“ konkrete Gefahr. 288Ein polizeiliches Einschreiten aufgrund einer bloßen Scheingefahr ist rechtswidrig. 289Dies wirkt sich auch auf die Frage aus, ob der Adressat einer solchen rechtswidrigen Maßnahme die Kosten zu tragen hat (dazu unter B. V.).
Beispiel:
Die Polizei stürmt eine leicht einsehbare Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, nachdem sie aus der Wohnung laute Hilfeschreie wahrgenommen hat. Es stellt sich heraus, dass der 95-jährige schwerhörige Rentner, wie jeden Tag, einfach nur sehr laut seinen Fernseher eingeschaltet hat („Tatort“). Die Nachbarn wissen von der Schwerhörigkeit und dem lautem Fernseher schon seit langem.
149
Der Gefahrenverdachtbezeichnet eine Situation, in der erste Anhaltspunkte eine Gefahr für möglich erscheinen lassen, es aus der Sicht eines verständigen Betrachters ex ante ohne weitere Ermittlungen aber noch nicht rechtfertigen, bereits eine endgültige Gefahrenprognose zu treffen. 290In Abgrenzung zur Anscheinsgefahr muss es sich um eine Situation handeln, die noch weitere Ermittlungenzu einer begründeteren Gefahrenprognose zulässt. 291
Beispiel:
Ein Hamburgischer Polizeibeamter, zuständig für Jugendschutz, beobachtet mehrere Jugendliche zu später Stunde auf den Alsterterrassen an der Binnenalster beim Alkoholkonsum, wobei die Jugendlichen noch sehr jung aussehen. Es könnte ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz vorliegen. Der Beamte hat das Alter der Jugendlichen noch nicht überprüft.
150
Ist dagegen der drohende Schaden hoch und somit ein weiteres Zuwarten „zu riskant“, können auch schon wenige erste Anhaltspunkte ausreichen, um nach der „je-desto-Formel“(s. oben B. I.2.) eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und damit eine „vollgültige Gefahr“ zu begründen. 292Inwieweit der bloße Gefahrenverdacht, ohne bereits eine „vollgültige“ Gefahr zu sein, bereits polizeiliche Maßnahmen rechtfertigt, ist im Einzelnen umstritten. Nach ganz h. M. sind grundsätzlich vorläufige Maßnahmen („Gefahrerforschungsmaßnahmen“)zur weiteren Aufklärung gerechtfertigt. 293
Zum Teil werden im besonderen Ordnungsrecht spezielle Eingriffsermächtigungen bereits explizit für einem bloßen Gefahrenverdacht geregelt: § 13 Abs. 1 BBodSchG zu Sanierungsuntersuchungen und in § 15 Abs. 2, Abs. 3 BBodSchG die Verpflichtung zu Eigenkontrollmaßnahmen bei Altlasten durch den Pflichtigen (Umweltrecht). § 16 Abs. 2 Satz 1 Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt Maßnahmen zur Ermittlung von Tatsachen, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können (Infektionsschutzrecht).
151
Unter Berufung auf die Entscheidung des BVerfG zu Überwachungsmaßnahmen nach dem BKA-Gesetz 294hat der bayrische Gesetzgeber die Rechtsfigur der „drohenden Gefahr“in das Landespolizeigesetz (BayPAG) eingeführt, 295um auch im Vorfeld von „konkreten Gefahren“ polizeiliche Maßnahmen ergreifen zu können. Die sog. „drohende Gefahr“ als Eingriffsgrundlage stellt im polizeirechtlichen Regelungsgefüge in zweifacher Hinsicht eine Neuerung dar. Zum einen modifiziert bzw. erweitert sie den polizeirechtlichen Gefahrenbegriff. Zum anderen führt dies zu einem erweiterten Anwendungsbereich der polizeirechtlichen Generalklausel. Diese Vorverlagerung der Eingriffsbefugnisse wird unter Berufung auf den Bestimmtheitsgrundsatzund den Grundsatz der Verhältnismäßigkeitvielfach als verfassungswidrig kritisiert. 296
In Nordrhein-Westfalen war die Einführung des Begriffs „drohende Gefahr“ in das dortige Polizeigesetz ebenfalls vorgesehen. Nach eingehender Debatte und vielfacher Kritik wurde auf die Einführung verzichtet. 297
152
Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen der Generalklausel des § 3 Abs. 1 SOG vor, so haben Polizei und Ordnungsbehörden zum einen Ermessen, ob sie überhaupt tätig werden (Entschließungsermessen). Zum anderen besteht Ermessen bei der Frage, wie sie tätig werden (Auswahlermessen). Dies betrifft die Wahl der einzusetzenden Mittel und Maßnahmen, und bei verschiedenen Verantwortlichen die Auswahl des Adressatender Maßnahme (zur Störerauswahl näher B. I.3.; zum Ermessen im Allgemeinen s. B. I.4.).
Читать дальше