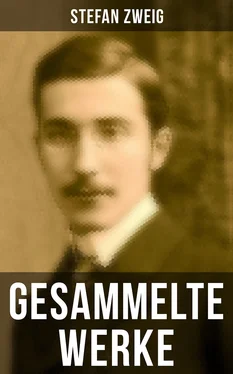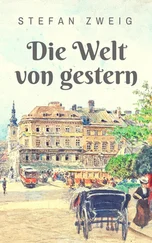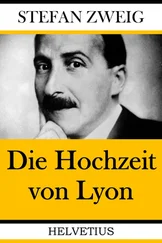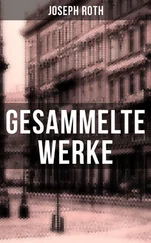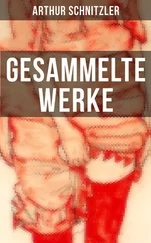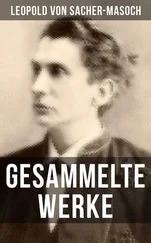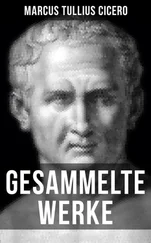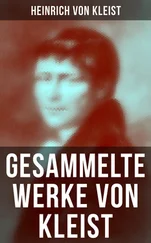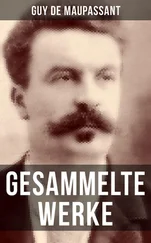So bleibt nur eines: klug sein, geschmeidig, geistig-anziehend, interessant, die Aufmerksamkeit vom Gesicht ablenken nach innen, blenden und verführen durch Überraschung und Rede! »Les talents peuvent consoler de l’absence de la beauté«, Geschicklichkeit kann allenfalls die Schönheit ersetzen. Vom Geiste her muß man bei solch unglücklicher Physiognomie die Frauen packen, da man ihre Sinne ästhetisch nicht anzuwärmen vermag. Also melancholisch tun bei den Sentimentalen, zynisch bei den Frivolen und manchmal umgekehrt, immer wachsam sein und immer geistreich. »Amusez une femme et vous l’aurez.« Klug jede Schwäche fassen, Hitze vortäuschen, wenn man selbst kalt ist, und Kälte, wenn man glüht, durch den Wechsel verblüffen, durch Tricks verwirren, immer zeigen, daß man anders ist als die andern. Und vor allem keine Chance vergeuden, kein Fiasko scheuen, denn manchmal vergessen die Frauen eines Mannes Gesicht, küßte doch in sonderbarer Sommernacht selbst Titania einstmals einen Eselskopf.
Stendhal setzt den modischen Hut auf, nimmt die gelben Handschuhe und probiert ein kaltes, mokantes Lächeln in den Spiegel hinein. Ja, so muß er heute abend bei Madame de T. auftreten, ironisch, zynisch, frivol und steinkalt: es gilt zu frappieren, zu interessieren, zu blenden; das Wort wie eine blitzende Maske über diese ärgerliche Physiognomie zu stülpen. Nur stark verblüffen, gleich mit dem ersten Ruck die Aufmerksamkeit an sich reißen, das ist das beste, die innere Mutlosigkeit verbergen hinter lauten Gascognaden. Wie er die Treppe hinabsteigt, hat er sich schon ein knallendes Entrée ersonnen: er wird sich heute im Salon vom Diener anmelden lassen als Herr Kaufmann Cäsar Bombet und dann erst selbst eintreten, einen geschwätzig lautrednerischen Wollhändler mimen, niemanden zu Wort kommen lassen und von seinen imaginären Geschäften so lange brillant und frech erzählen, bis die lachende Neugier ihm restlos gehört und die Frauen sich an sein Gesicht gewöhnen. Dann noch ein Feuerwerk von Anekdoten, starken und lustigen, die ihnen die Sinne auflockern, eine dunkle Ecke, die hilfreich seine Leiblichkeit verschattet, ein paar Gläser Punsch: und vielleicht, vielleicht finden ihn um Mitternacht dann die Frauen doch charmant.
Inhaltsverzeichnis
1799. Die Postkutsche von Grenoble nach Paris hält zum Pferdewechsel in Némours. Aufgeregte Gruppen, Plakate, Gazetten: der junge General Bonaparte hat gestern in Paris der Republik den Genickfang, dem Konvent den Fußtritt gegeben und sich zum Konsul gemacht. Alle Reisenden debattieren ereifert, nur ein sechzehnjähriger Bursche, breitschultrig, rotbackig, bezeigt wenig Aufmerksamkeit. Was schert ihn die Republik oder Konsulate, er fährt nach Paris, angeblich, um in der École Polytechnique zu studieren, aber in Wahrheit, um der Provinz zu entrinnen, Paris zu erleben, Paris, Paris! Und sofort füllt sich die ungeheure Schale dieses Namens mit buntem Geström von Träumen. Paris, das heißt Luxus, Eleganz, Beschwingtheit, Antiprovinz, Freiheit, und vor allem Frauen, viele Frauen. Irgendeine junge, schöne, zarte, elegante (vielleicht jener Victorine Cably ähnlich, jener Schauspielerin in Grenoble, die er schüchtern von ferne geliebt) wird er plötzlich auf eine romantische Weise kennenlernen, er wird sie retten aus dem zerschmetterten Kabriolett, indem er sich den durchbrennenden Pferden entgegenwirft, irgend etwas Großes, so träumt er, wird er für sie tun, und sie wird seine Geliebte sein.
Die Postkutsche holpert weiter und zerrädert unbarmherzig diese vorzeitigen Träumereien. Kaum wirft der Knabe einen Blick auf die Landschaft, kaum spricht er zu seinen Begleitern ein Wort. Endlich hält der Postillion am Schlagbaum. Dröhnend rollen die Räder über die buckligen Straßen, in die engen, schmutzigen, überhohen Häuserschluchten hinein, dumpfig vom Geruch ranziger Speisen und schweißiger Armut. Erschreckt sieht der Enttäuschte sein Traumland an. Das also ist Paris, »ce n’est donc que cela?« Nichts als das ist Paris? Immer wieder wird er dies Wort später wiederholen: nach dem ersten Gefecht, beim Übergang der Armee über den St. Bernhard, in der ersten Liebesnacht. Immer wird diesem unmäßigen romantischen Verlangen die Wirklichkeit schal und flau erscheinen nach so überschwenglichen Träumen.
Sie laden ihn ab vor einem gleichgültigen Hotel in der Rue Saint-Dominique. Dort in einer Mansarde des fünften Stockes, eine Luke statt des Fensters, rechte Brutstätte zorniger Melancholie, haust der kleine Henri Beyle nun ein paar Wochen, ohne einen Blick in seine Mathematikbücher zu tun. Stundenlang trottet er auf den Straßen, sieht den Frauen nach: wie sind sie doch verführerisch in der neurömischen Mode der Nacktheit, wie entgegenkommend scherzen sie mit ihren Verehrern, wie wissen sie zu lachen, anlockend und leicht; aber er wagt sich an keine heran, der linkische dumme Junge im grünen Provinzüberrock, sehr wenig elegant und noch weniger verwegen. Nicht einmal zu den geldgefälligen Mädchen, die um die Öllaternen billig streichen, traut er sich hin und beneidet verbissen die kühneren Kameraden. Er hat keinen Freund, keine Gesellschaft, keine Arbeit: mürrisch träumt er in Erwartung romantischer Abenteuer durch die schmutzigen Straßen, so ganz in sich verloren, daß er manchmal in Gefahr gerät, von einem Wagen überrannt zu werden.
Endlich, niedergemürbt, ausgehungert nach Rede, Wärme und Vertraulichkeit, macht er Besuch bei seinen Verwandten, den reichen Darus. Sie sind nett zu ihm, laden ihn ein, ziehen ihn in ihr schönes Haus, aber – Erbsünde für Henri Beyle! – sie stammen aus der Provinz, und das verzeiht er ihnen nicht; sie leben bürgerlich, reich und behäbig, indes seine Börse fadenscheinig schlottert, und das erbittert ihn. Verdrossen, schweigsam, linkisch, ihr geheimer Feind, sitzt er mit ihnen bei Tisch, sein brennendes Verlangen nach Zärtlichkeit versteckend hinter muffiger und ironischer Bockigkeit: ein unangenehmer, undankbarer Patron, wie wahrscheinlich die alten Darus heimlich konstatieren. Spät abends kommt dann, abgehetzt, müde und verschlossen, aus dem Kriegsministerium der Heros der Familie, Pierre (später Graf) Daru, die rechte Hand des allmächtigen Bonaparte. Seiner innersten Neigung nach wäre der Kriegsmann lieber Kollege dieses kleinen Dichters (den er, weil er sich so schweigsam vermauert, für einen linkischen Dummkopf hält, und vor allem ungebildet wie einen Karpfen); denn er übersetzt in seinen Mußestunden Horaz, schreibt philosophische Abhandlungen und wird späterhin, wenn er einmal die Uniform ablegt, eine Geschichte Venedigs verfassen, jetzt aber lebt er wichtigeren Aufgaben im Schatten Bonapartes. Ein nimmermüdes Arbeitstier, verfaßt er Tag und Nacht im Geheimkabinett des Generalstabs Pläne, Berechnungen und Briefe, niemand weiß, zu welchem Zweck. Der kleine Henri haßt ihn gerade darum, weil er ihm nach vorwärts helfen will, denn er will nicht nach vorwärts, er will zu sich selbst.
Aber eines Tages ruft Pierre Daru den Faulenzer; er solle sofort mit in das Kriegsministerium, er habe eine Stelle für ihn. Unter der Karbatsche Darus muß nun der kleine feiste Henri Briefe, Briefe, Briefe, Referate und Berichte schreiben von zehn Uhr morgens bis ein Uhr nachts, daß ihm die Finger krachen. Noch weiß er nicht, wozu all diese wütige Schreiberei dient, aber bald wird die Welt es wissen. Ahnungslos schafft er mit an dem italienischen Feldzuge, der mit Marengo beginnt und mit einem Kaiserreich schließt; endlich erzählt der »Moniteur« das Geheimnis: der Krieg ist erklärt. Der kleine Henri Beyle atmet auf, gottlob! jetzt muß dieser Quälgeist Daru abrücken ins Hauptquartier, vorbei die öde Brieffuchserei. Er atmet auf; lieber Krieg als noch weiterhin dies Schrecklichste auf der Welt, als die beiden Dinge, die er am meisten haßt: Arbeit und Langeweile.
Читать дальше