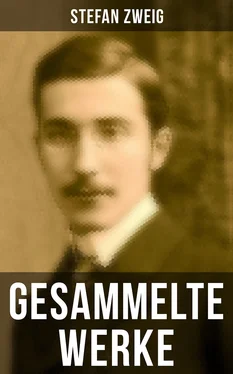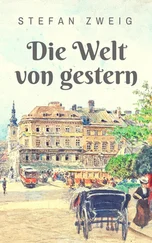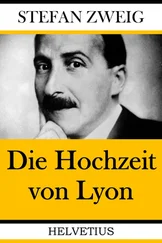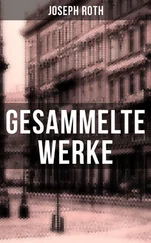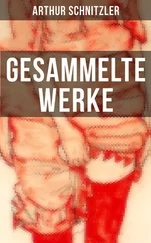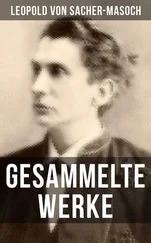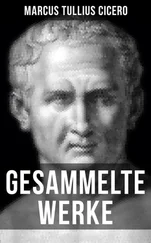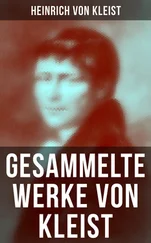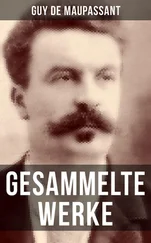Vor der Tür stehen die Dienertölpel und grinsen sich an: »Mit wem lacht er da drinnen, der alte welsche Narr?« Feixend deuten sie, seine Verschrobenheiten zu verspotten, mit dem Finger an die Stirn, poltern die Treppe hinunter zum Wein und lassen den Alten in seinem Dachzimmer allein. Niemand weiß von ihm mehr in der Welt, die Nächsten nicht und nicht die Fernsten. Er haust, der alte zornige Habicht, da droben in seinem Turm von Dux wie auf der Spitze eines Eisberges, ungeahnt und ungekannt; und als endlich Ende Juni 1798 das alte zermürbte Herz kracht und man den elenden, von tausend Frauen einst glühend umarmten Leib einscharrt in die Erde, weiß das Kirchenbuch nicht einmal mehr seinen rechten Namen. »Casaneus, ein Venezianer« schreiben sie ein, einen falschen Namen, und »Vierundachtzig Jahre alt«, eine falsche Lebenszahl, so unbekannt ist er den Nächsten geworden. Niemand kümmert sich um sein Grabmal, niemand um seine Schriften, vergessen modert der Leib, vergessen modern die Briefe, vergessen wandern irgendwo die Bände seines Werkes in diebischen und doch gleichgültigen Händen herum; und von 1798 bis 1822, ein Vierteljahrhundert, scheint niemand so tot wie dieser Lebendigste aller Lebendigen.
Genie der Selbstdarstellung
Inhaltsverzeichnis
Es kommt nur darauf an, Mut zu haben.
Vorrede
Abenteuerlich sein Leben, abenteuerlich auch seine Auferstehung. Am 13. Dezember 1820 – wer weiß von Casanova noch? – erhält der renommierte Verlagsbuchhändler Brockhaus den Brief eines höchst unbekannten Herrn Gentzel, ob er die »Geschichte meines Lebens bis zum Jahre 1797«, verfaßt von einem ebenso unbekannten Signor Casanova, veröffentlichen wolle. Der Buchhändler läßt sich jedenfalls die Folianten kommen, sie werden von Fachleuten durchgelesen: man kann sich denken, wie sie begeistert sind. Daraufhin wird das Manuskript sofort erworben, übersetzt, wahrscheinlich gröblich entstellt, mit Feigenblättern überklebt und für den Gebrauch adjustiert. Beim vierten Bändchen skandaliert der Erfolg schon dermaßen laut, daß ein findiger Pariser Pirat das deutsch übersetzte französische Werk abermals ins Französische rückübersetzt – also doppelt verballhornt –; nun wird Brockhaus seinerseits ehrgeizig, schießt der französischen Übersetzung eine eigene französische Rückübersetzung in den Rücken – kurz, Giacomo, der Verjüngte, lebt wieder so lebendig als nur je in allen seinen Ländern und Städten, nur sein Manuskript wird feierlich begraben im Eisenschrank der Herren Brockhaus, und Gott und Brockhaus wissen vielleicht allein, auf welchen Schleichwegen und Diebswegen sich die Bände in den dreiundzwanzig Jahren umgetrieben, wieviel davon verloren, verstümmelt, kastriert, gefälscht, verändert wurde; als rechtes Casanova-Erbe riecht die ganze Affäre penetrierend nach Geheimnis, Abenteuer, Unredlichkeit und Schiebung, aber welch erfreuliches Wunder schon dies, daß wir diesen frechsten und vollblütigsten Abenteuerroman aller Zeiten überhaupt besitzen!
Er selbst, Casanova, hat nie ernstlich an das Erscheinen dieses Monstrums geglaubt. »Seit sieben Jahren tue ich nichts anderes als meine Erinnerungen schreiben«, beichtet einmal. der rheumatische Eremit, »und es ist für mich allmählich ein Bedürfnis geworden, die Sache zu Ende zu bringen, obwohl ich sehr bereue, sie angefangen zu haben. Aber ich schreibe in der Hoffnung, daß meine Geschichte niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken werde, denn abgesehen davon, daß die niederträchtige Zensur, dieses Löschhorn des Geistes, den Druck niemals erlauben würde, so hoffe ich in meiner letzten Krankheit so vernünftig zu sein und alle meine Hefte vor meinen Augen verbrennen zu lassen.« Glücklicherweise ist er sich treu geblieben, Casanova, und niemals vernünftig geworden, und sein »sekundäres Erröten«, wie er einmal sagt, nämlich das Erröten darüber, daß er nicht erröte, hat ihn nicht gehindert, kräftig in die Palette zu greifen und Tag für Tag zwölf Stunden mit seiner schönen, runden Schrift immer neue Foliobogen voll zu fabulieren. Waren diese Erinnerungen doch »das einzige Heilmittel, um nicht wahnsinnig zu werden oder vor Ärger zu sterben – vor Ärger über die Unannehmlichkeiten und täglichen Scherereien von Seiten der neidischen Halunken, die sich zusammen mit mir auf dem Schlosse des Grafen Waldstein befinden«.
Als Fliegenklappe gegen die Langeweile, als Heilmittel gegen intellektuelle Verkalkung, ein bescheidenes Motiv, beim Zeus, um Memoiren zu verfassen; aber mißachten wir die Langeweile nicht als Impuls und Impetus der Gestaltung. Den Don Quichotte verdanken wir den öden Kerkerjahren des Cervantes, die schönsten Blätter Stendhals den Jahren seines Exils in den Sümpfen von Civitavecchia; nur in der Camera obscura, dem künstlich verdunkelten Raum, entstehen die farbigsten Bilder des Lebens. Hätte Graf Waldstein den guten Giacomo nach Paris oder Wien mitgenommen, wacker gefüttert und ihn Frauenfleisch riechen lassen, hätte man ihm die Honneurs d’esprit in den Salons erwiesen, so wären diese ergötzlichen Erzählungen bei Schokolade und Sorbett verplaudert worden und niemals in Tinte geronnen. Aber der alte Dachs sitzt und friert allein im böhmischen Pontus, und so erzählt er gleichsam schon rückgewendet aus dem Totenreich. Seine Freunde sind gestorben, seine Abenteuer vergessen, niemand erweist ihm mehr Achtung und Ehre, niemand hört ihm zu, so übt der alte Zauberer, einzig um sich selbst zu beweisen, daß er lebt oder wenigstens gelebt hat – »vixi, ergo sum« –, noch einmal die Kabbalistenkunst, vergangene Gestalten zu beschwören. Hungrige nähren sich vom Bratenduft, Invalide des Krieges und des Eros vom Erzählen der eigenen Abenteuer. »Ich erneuere das Vergnügen, indem ich mich daran erinnere. Und ich verlache vergangene Not, denn ich fühle sie nicht mehr.« Nur sich selbst rückt Casanova den bunten Guckkasten Vergangenheit, dies Kinderspielzeug des Greises, zurecht, er will eine elende Gegenwart vergessen durch farbige Erinnerung. Mehr will er nicht, und gerade diese vollkommene Gleichgültigkeit gegen alles und alle gibt seinem Werke einzig psychologischen Wert als Selbstdarstellung. Denn wer sonst sein Leben erzählt, tut es fast immer zweckhaft und gewissermaßen amphitheatralisch; er stellt sich auf eine Bühne, der Zuschauer gewiß, übt sich unbewußt eine besondere Haltung, einen interessanten Charakter ein. Berühmte Männer sind niemals bedenkenfrei in ihrer Selbstdarstellung, denn ihr Lebensbild ist von vorneweg schon konfrontiert mit einem bereits in der Phantasie oder dem Erlebnis zahlloser Menschen vorhandenen; so sind sie wider ihren Willen gezwungen, ihre eigene Darstellung heranzustilisieren an die schon ausgeformte Legende. Sie müssen, die Berühmten, um ihres Ruhmes willen Rücksicht nehmen auf ihr Land, ihre Kinder, auf die Moral, Ehrfurcht und Ehre – immer ist darum, wer vielen schon angehört, vielfach gebunden. Casanova aber darf sich den Luxus radikalster Hemmungslosigkeit leisten, ihn besorgen keine familiären, keine ethischen, keine sachlichen Bedenken. Seine Kinder hat er als Kuckuckseier in fremde Nester gesteckt, die Frauen, mit denen er schlief, faulen längst unter italienischer, spanischer, englischer, deutscher Erde, ihn selbst beengt kein Vaterland, keine Heimat, keine Religion – zum Teufel, wen sollte er da schonen: am wenigsten sich selbst! Was er erzählt, kann ihm nichts mehr nützen, kann ihm nichts mehr schaden. »Warum«, fragt er sich darum, »sollte ich nicht wahr sein? Sich selbst täuscht man niemals, und ich schreibe nur für mich selber.«
Wahr sein, das heißt aber für Casanova nicht etwa tiefwühlend und selbstgrüblerisch sich gebärden, sondern ganz einfach: hemmungslos, rücksichtslos, schamlos sein. Er zieht die Kleider aus, macht sich behaglich und nackt, taucht den abgestorbenen Leib noch einmal ins warme Geström der Sinnlichkeit, klatscht und platscht munter und frech in seinen Erinnerungen, höchst gleichgültig um vorhandene oder imaginäre Zuschauer. Nicht wie ein Literat, ein Feldherr, ein Dichter erzählt er seine Abenteuer sich selber zur Ehre, sondern wie ein Strolch seine Messerstechereien, eine wehmütig alternde Kokotte ihre Liebesstunden, also vollkommen ohne Schamhemmung und Bedenken. »Non erubesco evangelium«, ich erröte nicht über mein Bekenntnis, steht als Motto unter seinen »Précis de ma vie«, er bläst weder die Backen auf, noch schielt er reumütig in die Zukunft: er erzählt direkt und gerade aus dem Mund heraus. Kein Wunder darum, daß sein Buch eins der nacktesten und natürlichsten der Weltgeschichte wurde, von einer geradezu wahrhaft antikischen Offenheit im Amoralischen. Aber mag es grobsinnlich wirken und für zartsinnige Gemüter manchmal allzu sichtbar phallische Muskeln mit der Eitelkeit eines selbstzufriedenen Athleten spielen lassen – tausendmal besser doch dieses unverschämte Paradieren als ein feiges Weg-Eskamotieren oder eine lendenlahme Galanterie in eroticis. Man vergleiche doch einmal die andern erotischen Traktate seiner Zeit, die rosenfarbenen, moschussüßlichen Frivolitäten eines Grécourt, Crébillon oder den Faublas, wo der Eros ein bettelhaftes Schäferkleidchen trägt und Liebe als lüsternes Chassé-Croisé erscheint, ein galantes Spielchen, bei dem man weder Kinder noch die Syphilis kriegt, mit diesen geraden, exakten, von gesunder und üppiger Genußfreude überschwellenden Schilderungen, um ihre Menschlichkeit und elementare Natürlichkeit ganz einwerten zu können. Bei Casanova erscheint die männliche Liebe nicht als zartblaues Wässerchen, in dem Nymphen ihre Füße spielend kühlen, sondern als ungeheuer naturhafter Strom, der die Welt spiegelt auf seiner Fläche und gleichzeitig in seinem Grund allen Schlamm und Schmutz der Erde mitschleppt – wie kein anderer Selbstdarsteller zeigt er das Panische und Wildüberschwellende des männlichen Geschlechtstriebs. Hier kommt endlich einer, der den Mut hatte, die Vermengtheit von Fleisch und Geist in der männlichen Liebe aufzuzeigen, nicht nur die sentimentalischen Affären, die zimmerreinen Liebschaften zu erzählen, sondern auch die Abenteuer der Hurengassen, die nackten und bloß hauthaften Geschlechtlichkeiten, das ganze Labyrinth des Sexus, das jeder wirkliche Mann durchschreitet. Nicht daß die andern großen Autobiographen, daß Goethe oder Rousseau in ihren Selbstdarstellungen geradewegs unwahrhaftig wären, aber es gibt auch eine Unwahrhaftigkeit durch Halberzählen und Verschweigen, und die beiden schweigen mit bewußter oder wegschielender Vergeßlichkeit sorgfältig die minder appetitlichen, die rein sexuellen Episoden ihres Liebeslebens tot, um sich einzig über die seelisch durchfärbten, die sentimentalen oder leidenschaftlichen Liebeleien mit den Klärchen und Gretchen zu verbreiten. Damit sublimieren sie aber unbewußt das lebensechte Bildnis der männlichen Erotik: Goethe, Tolstoi, selbst der sonst nicht prüde Stendhal gleiten rasch und mit schlechtem Gewissen hinweg über unzählige bloße Bettabenteuer und die Begegnungen mit der venus vulgivaga, der irdischen, allzu irdischen Liebe, und hätte man nicht diesen frech-aufrichtigen, herrlich-schamlosen Kerl Casanova, der hier allerhand Vorhänge hebt, so fehlte der Weltliteratur ein vollkommen ehrliches und durchaus komplexes Bild der männlichen Geschlechtlichkeit. Bei ihm sieht man endlich einmal das ganze sexuelle Triebwerk der Sinnlichkeit in Funktion, die Welt im Fleische auch dort, wo sie schmierig, schlammig, sumpfig wird. Casanova sagt in sexualibus nicht nur die Wahrheit, sondern – unausmeßbarer Unterschied! die ganze Wahrheit seiner Liebeswelt allein ist wahr wie die Wirklichkeit.
Читать дальше