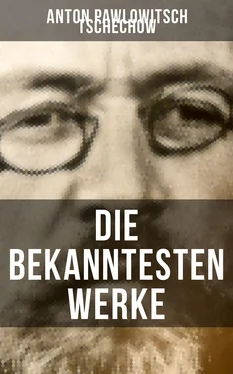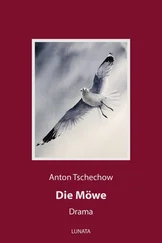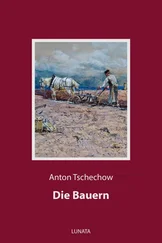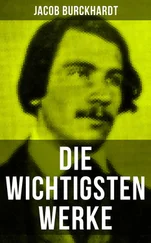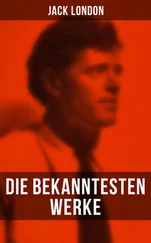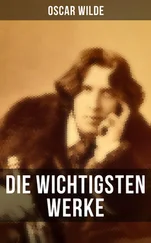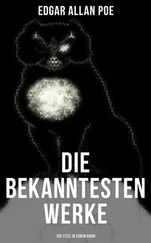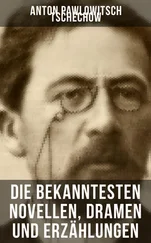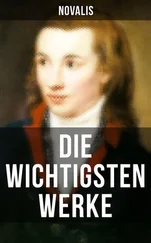Ich muß Sie sprechen.
Ihre J. T.«
Er las den Brief, überlegte sich eine Weile und sagte zu Pawa:
»Sag ihr, mein Bester, daß ich heute beschäftigt bin und nicht kommen kann. Sag, daß ich so in drei Tagen kommen werde.«
Es vergingen aber drei Tage, und acht Tage, und er ließ sich nicht blicken. Als er einmal am Hause der Turkins vorbeifuhr, fiel ihm ein, daß er doch eigentlich für ein paar Minuten hineinschauen sollte, – das dachte er sich und ging doch nicht hin.
Und er kam nie wieder zu den Turkins.
Es sind noch einige Jahre vergangen. Starzew ist noch dicker und fetter geworden, atmet schwer und wirft im Gehen den Kopf in den Nacken zurück. Wenn er, aufgedunsen und rot in seiner Troika mit dem Schellengeläute fährt und Pantelejmon, der ebenso dick und rot geworden ist und einen fleischigen Nacken hat, auf dem Bocke sitzt, die Arme so gerade, wie wenn sie aus Holz wären, vor sich ausgestreckt, und die Leute auf der Straße anschreit: »Rechts!«, – so ist das Bild so imposant, als ob kein Mensch, sondern ein Götze im Wagen säße. Er hat in der Stadt eine riesengroße Praxis, die ihm keinen Augenblick freie Zeit läßt, besitzt ein Gut und zwei Häuser in der Stadt und ist eben im Begriff, ein drittes Haus möglichst vorteilhaft zu kaufen. Wenn er in der »Gesellschaft für gegenseitigen Kredit« von einem Hause hört, das zum Verkaufe steht, so begibt er sich in dieses Haus, geht ungeniert durch alle Zimmer, ohne auf die nicht angekleideten Frauen und Kinder, die ihn mit Erstaunen und Angst angaffen, zu achten, tippt mit dem Spazierstock an alle Türen und fragt:
»Ist hier das Kabinett? Hier das Schlafzimmer? Und was ist hier?«
Dabei atmet er schwer und wischt sich den Schweiß aus der Stirn.
Er hat furchtbar viel zu tun, und doch gibt er die Landarztstelle nicht auf; so gierig ist er und will ja keinen Pfennig verlieren. In Djalisch und in der Stadt nennt man ihn jetzt ganz kurz »Ionytsch«. – »Wo fährt der Ionytsch hin?« oder: »Soll man nicht den Ionytsch zum Konsilium rufen?«
Seine Stimme hat sich verändert und ist hoch und schneidend geworden, wohl weil seine Kehle verfettet ist. Auch sein Charakter hat sich verändert: er ist unverträglich und reizbar. Wenn er seine Kranken empfängt, klopft er ungeduldig mit dem Stock gegen den Boden und schreit mit böser widerlicher Stimme:
»Wollen Sie nur meine Fragen beantworten! Keine überflüssigen Gespräche!«
Er ist einsam. Sein Leben ist langweilig, und er hat für nichts Interesse.
Wahrend der ganzen Zeit, seit er in Djalisch wohnt, war seine Liebe zum Kätzchen seine einzige und wohl auch seine letzte Freude gewesen. Abends spielt er im Klub Whist und ißt dann allein am großen Tisch zu Abend. Ihn bedient der älteste und geachtetste Kellner Iwan; er trinkt den Lafitte Nr. 17; die Vorsteher des Klubs, der Koch und der Kellner, alle wissen genau, was er liebt, und was er nicht liebt, und bemühen sich, ihn nach Möglichkeit zufriedenzustellen, damit er nicht auffährt und mit dem Stock gegen den Boden klopft.
Beim Abendessen wendet er sich manchmal um und mischt sich in ein fremdes Gespräch ein:
»Von wem sprachen Sie eben? Wie?«
Und wenn mal an einem der Nebentische die Rede auf die Turkins kommt, so fragt er:
»Was für Turkins meinen Sie? Die, wo die Tochter Klavier spielt?«
Das ist alles, was man über ihn berichten kann.
Und die Turkins? Iwan Petrowitsch ist gar nicht gealtert, hat sich nicht verändert und macht noch immer seine Witze; Wjera Iossifowna liest den Gästen nach wie vor in aller Herzenseinfalt ihre Romane vor. Und das Kätzchen spielt täglich an die vier Stunden Klavier. Sie ist sichtlich älter geworden, kränkelt und geht jeden Herbst mit der Mutter nach der Krim. Iwan Petrowitsch gibt ihnen das Geleite, und wenn der Zug sich in Bewegung setzt, wischt er sich die Tränen aus den Augen und ruft:
»Leben Sie sowohl, als auch!«
Und winkt mit dem Taschentuch.
Inhaltsverzeichnis
Ich stand am Ufer der Goltwa und wartete auf die Fähre. Zur gewöhnlichen Zeit stellt diese Goltwa ein mittelgroßes, schweigsames und versonnenes Flüßchen dar, das mild durch das dichte Schilf leuchtet; jetzt breitete sich aber vor mir ein ganzer See aus. Die unbändigen Frühlingsgewässer hatten die beiden Ufer überschritten und die Gemüsegärten, Wiesen und Sümpfe überschwemmt, so daß aus der Wasseroberfläche hie und da einsame Pappeln und Sträucher ragten, die im Finstern düsteren Felsen glichen.
Das Wetter erschien mir herrlich. Es war dunkel, aber ich unterschied dennoch die Bäume, das Wasser und die Menschen ... Die Welt wurde von den Sternen erleuchtet, von denen der Himmel dicht übersät war. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Sterne gesehen zu haben. Es war buchstäblich kein Fleck, wo man mit dem Finger hintippen könnte. Die einen waren so groß wie Gänseeier, die anderen winzig wie Hanfsamen... Der Feiertagsparade wegen waren sie alle von klein bis groß auf den Himmel getreten, gewaschen, erneut, freudig, und alle bewegten still ihre Strahlen. Der Himmel spiegelte sich im Wasser; die Sterne badeten in der dunklen Tiefe und zitterten mit dem leisen Gekräusel der Wasseroberfläche. Die Luft war warm und still ... Weit am anderen Ufer brannten in der schwarzen Finsternis vereinzelte grellrote Feuer...
Zwei Schritt vor mir ragte die dunkle Silhouette eines Bauern in hohem Hut, mit einem dicken Knotenstock in der Hand.
»So lange kommt die Fähre nicht!« sagte ich.
»Es wäre längst Zeit für sie,« antwortete die Silhouette.
»Wartest du auch auf die Fähre?«
»Nein, ich stehe nur so da,« antwortete der Bauer gähnend. »Ich warte auf die Illumination. Ich würde schon hinüberfahren, aber mir fehlen die fünf Kopeken für die Fähre.«
»Ich will dir die fünf Kopeken geben.«
»Nein, ich danke ergebenst... Für diese fünf Kopeken kannst du für mich dort im Kloster eine Kerze spenden... So wird es besser sein, ich will hier bleiben. Wo nur die Fähre bleibt! Es ist von ihr nichts zu sehen!«
Der Bauer trat dicht ans Wasser, ergriff mit der Hand das Seil und schrie:
»Jeronim! Jeron–i–im!«
Als Antwort auf seinen Ruf ertönte vom anderen Ufer der gedehnte Schlag einer großen Glocke. Der Ton war tief wie der der dicksten Saite einer Baßgeige: es klang, als ob er von der Dunkelheit selbst erzeugt wäre. Gleich darauf ertönte ein Kanonenschuß. Er rollte durch die Dunkelheit und erstarb irgendwo weit hinter meinem Rücken. Der Bauer zog den Hut und bekreuzigte sich.
»Christ ist erstanden!« sagte er.
Die Schwingungen des ersten Glockenschlages waren noch nicht erstorben, als schon ein zweiter, dann ein dritter ertönte und die Dunkelheit sich mit einem ununterbrochenen zitternden Dröhnen füllte. Neben den roten Feuern leuchteten andere Feuer auf, und alle gerieten in eine unruhige Bewegung.
»Jeron–i–im!« ertönte ein dumpfer, gedehnter Schrei.
»Da schreit wer vom anderen Ufer,« sagte der Bauer. »Also ist die Fähre auch nicht drüben. Unser Jeronim ist eingeschlafen.«
Die Feuer und das samtweiche Glockengeläute lockten hinüber. Ich fing schon an, die Geduld zu verlieren und unruhig zu werden, als in der dunklen Ferne etwas wie die Silhouette eines Galgens auftauchte. Es war die längst ersehnte Fähre. Sie bewegte sich so langsam, daß, wenn ihre Umrisse nicht immer deutlicher hervorträten, man annehmen könnte, sie stehe auf einem Feld oder fahre ans andre Ufer.
»Schneller! Jeronim!« schrie mein Bauer. »Der Herr wartet!«
Die Fähre kam langsam ans Ufer, schwankte und blieb knarrend stehen. Auf ihr stand, sich am Seil festhaltend, ein großgewachsener Mensch in einer Mönchskutte, mit einem konischen Käppchen auf dem Kopfe.
Читать дальше