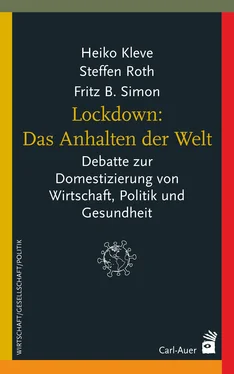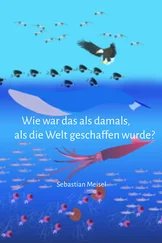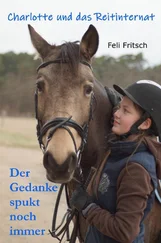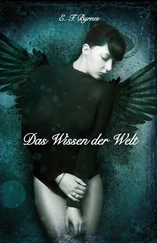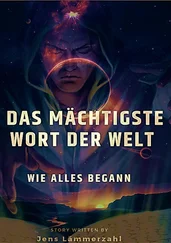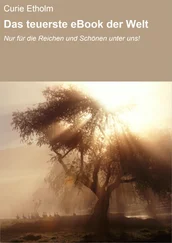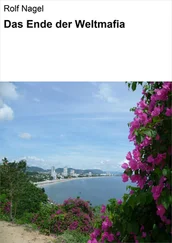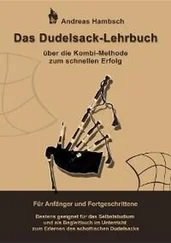Seiner Beschreibung des Status quo stimme ich weitestgehend zu, vor allem, wie er den aktuellen Bedeutungsverlust bestimmter Wertsphären – ein Konzept, das er in diesem Kontext an die Stelle der Funktionssysteme setzt – charakterisiert. Daher gibt es für mich in der Hinsicht wenig Diskussionsbedarf.
Was ich spannend finde, ist die (»eher theorieinterne«) Frage, ob Massenmedien, »Gesundheitssystem« (ein Begriff, den ich hier in Anführungsstriche setze) und der Bildungsbereich eigenständige Funktionssysteme sind. Meine Antworten dazu fallen – bei aller Vorsicht und Vorläufigkeit, d. h. sehr unsicher und wenig reflektiert – folgendermaßen aus:
•Die Massenmedien sind inzwischen in erster Linie zu ganz normalen Teilnehmern des Wirtschaftssystems geworden. Sie verkaufen Produkte, genannt: »News«, wobei zwischen echt und fake vom Konsumenten unterschieden werden muss. Sie dienen nur begrenzt der Information der Öffentlichkeit, dafür eher spezifischen wirtschaftlichen Interessen und Interessengruppen, da sie ihren Wahrheitsanspruch aufgegeben haben oder er ihnen abgesprochen wird. Der Unterschied zwischen Nachrichten und Werbung schwindet. Dies stützt meines Erachtens meine These von der Übermacht der Wirtschaft, denn sie hat die Massenmedien kolonialisiert.
•Das »Gesundheitssystem« scheint mir immer noch ein an der Unterscheidung krank/gesund orientiertes Funktionssystem zu sein. Es wird in seinen Handlungsmöglichkeiten vor allem durch Wirtschaft und Wissenschaften begrenzt. Im Rahmen der Corona-Krise haben die Wissenschaften (bzw. ein kleiner Teil davon) an Bedeutung (= Wert) gewonnen, was auf Kosten der Wirtschaft ging. Viele sogenannte Gesundheitsorganisationen leiden aktuell wirtschaftlich genauso stark wie andere Akteure des Wirtschaftssystems (z. B. keine lukrativen Operationen).
•Über die Frage, ob der Bildungsbereich noch als Funktionssystem zu verstehen ist, müsste ich erst noch einmal länger nachdenken, das heißt, dazu kann und will ich im Moment nichts sagen.
Nun zum letzten Beitrag von Steffen Roth. Auch dazu ist eigentlich mehr anzumerken, als hier jetzt möglich ist. Ich picke daher den letzten Vorschlag einer »Gesundheitswissenschaft« heraus, da er zumindest einen gewissen Bezug zur aktuellen Situation hat.
Zunächst meine volle Zustimmung zu der Forderung, unterschiedliche Organisationsformen des Staates zu vergleichen und zu prüfen, an welchen Codes welcher Funktionssysteme sie sich – de facto, würde ich hinzufügen – orientieren und an welchen sie sich orientieren sollten.
Was allerdings die Idee der Gesundheitsforschung angeht, so halte ich die für extrem gefährlich (wenn auch wahrscheinlich gut gemeint). Denn bei der Unterscheidung krank/gesund kann immer nur die »krank«-Seite markiert werden, nicht die andere Seite. »Gesundheit« ist ein Konzept, für dessen Beobachtung es kein Merkmal der Unterscheidung gibt (siehe die hilflose WHO-Definition). Man kann zwar die Definition von Krankheiten operationalisieren, aber nicht die der »Gesundheit«. Und das vermeintliche »Gesundheitssystem« ist daher immer nur ein System gewesen (und sollte es sein), in dem Krankheiten behandelt werden. Eine Therapie, die sich an »Gesundheit« orientiert, findet kein Ende (daher die »Kostenexplosion«). Ein gutes (wenn auch karikierendes) Beispiel dafür ist die Psychoanalyse, die als Ziel ihrer Kur »genitale Reife« angibt. Da es kein beobachtbares Merkmal der Unterscheidung dafür gibt, sind die Analysen seit Sigmund Freuds Zeiten von 20–30 Stunden auf mehr als 1500 bei orthodoxen Analytikern heute gestiegen.
Jedes Gesundheitskonzept wird zwangsläufig normativ und engt Möglichkeiten der Kreativität und Innovation ein. Die Orientierung – auch in Bezug auf psychische und soziale Systeme – muss daher an dem erfolgen, was nicht (!) funktioniert oder nicht sein soll. Es ist wie mit dem darwinistischen Selektionsprinzip: Nicht der Fitteste überlebt, sondern wer überlebt, ist fit. Wir können auch in Bezug auf psychische und soziale Organisationsformen keine längerfristig haltbaren Aussagen über ihre Gesundheit machen, aber wir können sehr wohl sagen, was nicht zum Erfolg, zu Leid und Kosten aller Art, ja, zur Bedrohung ihres Überlebens führt. Wer sich bei der Konstruktion sozialer Systeme (von der Organisation bis zum Staat) an Gesundheit orientiert, landet früher oder später bei totalitären Systemen. Wir sollten daher – auf der politischen Ebene – nicht diskutieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, sondern, in welcher wir auf keinen Fall leben wollen.
Diese Frage lässt sich dann auch kleinteiliger beantworten, wenn es um die Bedrohung durch ein Virus geht …
Negative Gesundheit, negative Freiheit
von Steffen Roth
In Sachen Gesundheit stimme ich mit Fritz Simon weitestgehend überein: Gesundheit ist ein negativ gepoltes Funktionssystem, und Umpolungen haben den genannten Preis der endlosen Therapie.
Mit Wohlfahrt verhält es sich ganz ähnlich, und just in diesem Sinne waren meine Ausführungen gemeint: Ein Staat, der von Gleichberechtigung auf Gleichstellung umpolt, verhält sich wie der oben beschriebene Psychoanalytiker. Er lebt davon, Glücksschmieden den Hammer aus der Hand zu nehmen und sie nach seinem Bild zu formen. Das funktionale Äquivalent zur »genitalen Reife« ist dann der »conceptual penis« und somit die Kultur der politischen Korrektheit, die er mit Blick auf mehr ideologische als logische Formen sogenannter Wissenschaft karikiert.
Den Preis einer politisch korrekten »Wissenschaft« bezahlt man spätestens dann, wenn man im Ernstfall nicht mehr weiß, ob man als politischer Entscheidungsträger Wahrheiten oder doch eher Gefälligkeiten in jener Hand hält, in die ein staatlich alimentierter Wissenschaftler schon lange nicht mehr ungefragt beißt.
Insofern sind wir doch gut beraten, uns an Isaiah Berlins Konzept der »negativen Freiheit« zu erinnern, die sich als Abwesenheit von Einmischung definiert und sich nicht mit dem verwechselt, was man in Freiheit anstreben sollte oder kann.
Nun ist Nicht-Einmischung aber genau das, was ein Wohlfahrtsstaat und seine Getreuen nicht können. Ganz im Sinne de Tocquevilles hat deshalb inzwischen fast jede Lebenslage mindestens ein Problem, das nach wohlfahrtsstaatlicher Intervention verlangt. So entsteht das bekannte Paradox, dass mit dem Wunsch zu helfen die Hilfsbedürftigkeit steigt. »Gut gemeint« war schon immer das Gegenteil von »gut gemacht«.
Zementiert wird diese Kultur der Abhängigkeit nicht zuletzt durch Erziehung, und somit durch ein Funktionssystem, das uns nur deshalb als zweitrangig und aktuell kaltgestellt erscheint, weil wir es mit Organisationen wie Schule oder Universität verwechseln. Mit Blick aufs eigentliche Funktionssystem zeigt sich aber, dass Erziehung seit Langem und jetzt erst recht en vogue ist, und das nicht selten in ihrer primitivsten paternalistischen Variante. Tatsächlich schickt einen »Mutti« wieder regelmäßig zum Händewaschen. Auch soll man falschen Umgang vermeiden, erklären, wo man wann mit wem war, sein Smartphone vorzeigen, überall in Reih’ und Glied stellen und sich – nicht nur ganz wortwörtlich von Masken – bevormunden lassen. Für die offizielle Mehrheit scheint sich all das warm anzufühlen – Freiheit dahingegen kalt. Mit der »genitalen Reife« dieser Mehrheit wäre es demnach nicht weit her.
Derartige Tours de Force – auch und gerade durch die bislang weniger prominenten Funktionssysteme wie Gesundheit, Wissenschaft und Erziehung – sind wichtig, nicht zuletzt, weil die relative Vernachlässigung dieser Systeme erheblich zu Entstehung und Verlauf der aktuellen Krise beigetragen hat. Gleichzeitig muss deren Aufwertung nicht mit den von Fritz Simon und Michael Hutter beobachteten oder gar ersehnten absoluten Wertverlusten der ehemaligen funktionalen Platzhirsche einhergehen.
Читать дальше