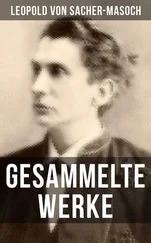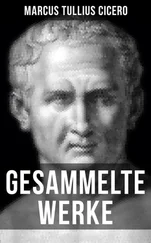»Sie sind immer noch da?« sagt Stasia und wird rot, denn sie hat sich verstellt, sie weiß ja wohl, daß ich nicht verreist bin.
»Sind Sie enttäuscht?«
»Sie vernachlässigen unsere Freundschaft!«
Ich vernachlässige nicht die Freundschaft. Dieser Vorwurf gebührt Stasia selbst.
Zwei Wochen liegen zwischen ihr und mir, zweihundert Jahre können nicht mehr verwüsten. Ich habe auf sie zitternd gewartet, vor dem Varieté, in den Schatten einer Mauer gedrückt. Wir haben Tee miteinander getrunken, und eine leise Wärme lag um uns beide. Sie war meine erste liebliche Begegnung im Hotel Savoy, und uns beiden war Alexanderl unsympathisch.
Ich habe durch das Schlüsselloch gesehn, wie sie in einem Bademantel hin und her ging und französische Vokabeln lernte. Sie will ja nach Paris.
Ich wäre gerne mit ihr nach Paris gereist. Ich wäre gerne mit ihr zusammengeblieben, ein Jahr oder zwei oder zehn.
Ein großer Haufen Einsamkeit hat sich in mir angesammelt, sechs Jahre großer Einsamkeit.
Ich suche nach Gründen, weshalb ich ihr so fern bin, und finde keine. Ich suche nach Vorwürfen – was konnte ich ihr vorwerfen? Sie nahm von Alexander Blumen an und schickte sie nicht zurück. Es ist dumm, Blumen zurückzuschicken. Ich bin vielleicht eifersüchtig. Wenn ich mich mit Alexander Böhlaug vergleiche, spricht freilich alles zu meinen Gunsten.
Dennoch bin ich eifersüchtig.
Ich bin kein Eroberer und kein Anbeter. Wenn sich mir etwas gibt, nehme ich es und bin dankbar dafür. Aber Stasia bot sich mir nicht. Sie wollte belagert werden.
Ich verstand damals nicht – ich war lange einsam gewesen und ohne Frauen –, weshalb die Mädchen so heimlich tun und soviel Geduld haben und so stolz sind. Stasia wußte ja nicht, daß ich sie nicht triumphierend angenommen hätte, sondern demütig und dankbar. Heute verstehe ich, daß es der Natur der Frauen ansteht zu zögern und daß ihre Lügen vergeben werden, noch ehe sie geschehn.
Ich kümmerte mich zuviel um das Hotel Savoy und um die Menschen, um fremde Schicksale und zuwenig um mein eigenes. Hier stand eine schöne Frau und wartete auf ein gutes Wort, und ich sagte es nicht, wie ein verstockter Schulknabe.
Ich war verstockt. Mir war, als ob Stasia schuld wäre an meiner langen Einsamkeit, und sie konnte es ja gar nicht wissen. Ich warf ihr vor, daß sie keine Seherin war.
Nun weiß ich, daß die Frauen alles ahnen, was in uns vorgeht, aber dennoch auf Worte warten.
Gott legte das Zagen in die Seele der Frau.
Ihre Gegenwart reizte mich. Weshalb kam sie nicht zu mir? Weshalb ließ sie sich von dem Polizeioffizier begleiten? Weshalb fragt sie, ob ich immer noch da wäre? Weshalb sagte sie nicht: Gott sei Dank, daß du da bist!
Aber man sagt vielleicht nicht, wenn man ein armes Mädchen ist, zu einem armen Mann: Gott sei Dank, daß du da bist! Es ist vielleicht nicht mehr an der Zeit, einen armen Gabriel Dan zu lieben, der nicht einmal einen Koffer hat, geschweige denn ein Haus. Es ist vielleicht jetzt die Zeit, in der die Mädchen den Alexander Böhlaug lieben.
Heute weiß ich, daß die Begleitung des Polizeioffiziers ein Zufall war, ihre Frage eigentlich ein Geständnis. Damals aber war ich einsam und verbittert und benahm mich so, als wäre ich das Mädchen und Stasia der Mann.
Sie wird noch stolzer und kühler, und ich fühle, wie sich der Abstand zwischen uns beiden vergrößert und wie wir immer mehr und mehr fremd werden.
»Ich fahre bestimmt in zehn Tagen«, sage ich.
»Wenn Sie nach Paris kommen, schreiben Sie mir eine Karte!«
»Bitte, gerne!«
Stasia hätte sagen können:
Ich möchte mit Ihnen nach Paris fahren!
Statt dessen bittet sie mich um eine Postkarte.
»Ich schicke Ihnen den Eiffelturm.«
»Wie Sie wollen!« sagte Stasia, und es bezieht sich gar nicht auf die Ansichtskarte, sondern auf uns selbst.
Das ist unser letztes Gespräch. Ich weiß, es ist unser letztes Gespräch. Gabriel Dan, du hast gar nichts von Mädchen zu erwarten. Arm bist du, Gabriel Dan!
Am nächsten Morgen sehe ich Stasia am Arm Alexanderls die Treppe hinuntergehn. Beide lächeln mir zu – ich esse Frühstück unten. Da weiß ich, daß Stasia eine große Dummheit gemacht hat.
Ich verstehe sie.
Die Frauen begehn ihre Dummheiten nicht wie wir aus Fahrlässigkeit und Leichtsinn, sondern wenn sie sehr unglücklich sind.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Den Hof liebe ich, in den das Fenster meines Zimmers hinausgeht.
Er erinnert mich an den ersten Tag im Hotel, den Tag meiner Ankunft. Ich sehe immer noch Kinder spielen, höre einen Hund bellen und freue mich, wie bunt und fahnenhaft die Wäsche flattert.
In meinem Zimmer ist die Unrast, seitdem ich die Besucher Bloomfields empfange. Unrast ist im ganzen Hotel, im Korridor und im Fünf-Uhr-Saal, und eine kohlenstaubüberwehte Unrast herrscht in der Stadt.
Wenn ich zum Fenster hinausblicke, sehe ich ein Stück glücklich geretteter Ruhe. Die Hühner schreien. Nur die Hühner.
Es gab im Hotel Savoy einen anderen, einen engen Lichthof, der aussah wie ein Schacht für Selbstmörder. Dort wurden Teppiche geklopft, dorthin schüttete man den Staub, die Zigarettenstummel und den Kehricht des polternden Lebens.
Mein Hof aber war so, als gehöre er gar nicht zum Hotel Savoy. Er barg sich hinter dem riesigen Gemäuer. Ich wüßte gerne, was mit dem Hof geschehn ist.
Auch mit Bloomfield geht es mir so. Wenn ich seiner denke, bin ich neugierig, ob er seine gelbe Hornbrille trägt. Auch wüßte ich gerne etwas von Christoph Kolumbus, dem Friseur. Welche offengelassene Lücke des Lebens füllt er jetzt aus?
Große Ereignisse nehmen manchmal ihren Anfang in Friseurstuben. In dem kleinen Salon des Friseurs Christoph Kolumbus im Hotel Savoy ereignete es sich, daß einer der streikenden Arbeiter Neuners Lärm schlug.
Das Geschäft ging gut. Man hörte in Kolumbus’ Stube am Vormittag allerlei Neues. Die angesehenen Männer der Stadt, sogar der Polizeioffizier, alle fremden und die meisten heimischen Gäste des Hotels ließen sich bei ihm barbieren. Und einmal trat ein Arbeiter, ein bißchen angetrunken, in den Friseurladen und begegnete allen widerwilligen Blicken mit aufreizender Gleichgültigkeit.
Er ließ sich rasieren und bezahlte nicht. Christoph Kolumbus hätte ihn – er war ein großzügiger Mensch – gehen lassen. Doch Ignatz drohte mit der Polizei. Da schlug der Arbeiter auf Ignatz ein. Die Polizei verhaftete den Arbeiter.
Am Nachmittag zogen seine Kameraden vor das Hotel Savoy und riefen: »Pfui!« Dann gingen sie vor das Gefängnis.
Und in der Nacht zogen sie, Lieder singend, durch die erschrockenen Straßen.
In der Zeitung stand fett gedruckt eine Nachricht, sie brannte in der Mitte des Blattes. Ein paar Meilen weiter waren die Arbeiter einer großen Textilfabrik in den Streik getreten. Die Zeitung rief nach Militär, Polizei, Behörde, Gott.
Der Schreiber erklärte, daß alles Unheil von den Heimkehrern stamme, die den »Bazillus der Revolution in das keimfreie Land« verschleppten. Der Schreiber war ein jämmerlicher Mensch, er spritzte Tinte gegen Lawinen, er baute Dämme aus Papier gegen Sturmfluten.
Inhaltsverzeichnis
Es regnet nun schon eine Woche in der Stadt. Die Abende sind klar und kühl, aber bei Tage regnet es.
Es paßt so zum Regen, daß in diesen Tagen die Flut der Heimkehrer sich mit frischer Gewalt heranwälzt.
Mitten durch den schrägen, dünnen Regen gehen sie, Rußland, das große, schüttet sie aus. Sie nehmen kein Ende. Sie kommen alle denselben Weg, in grauen Kleidern, den Staub zerwanderter Jahre auf Gesichtern und Füßen. Es ist, als hingen sie mit dem Regen zusammen. Grau wie er sind sie und beständig wie er.
Читать дальше