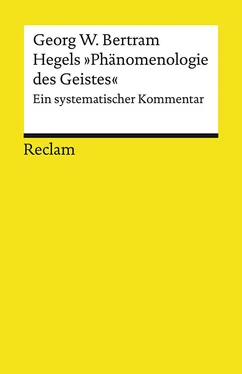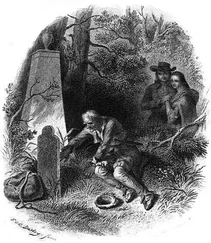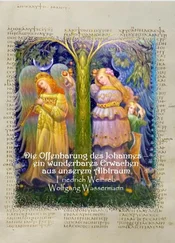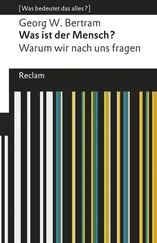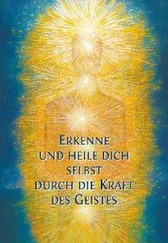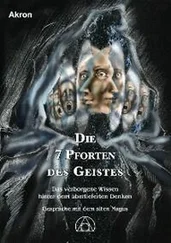Der sich auf den ganzen Umfang des erscheinenden Bewusstseins richtende Skeptizismus macht dagegen den Geist erst geschickt zu prüfen, was Wahrheit ist, indem er eine Verzweiflung an den sogenannten natürlichen Vorstellungen, Gedanken und Meinungen zustande bringt, welche es gleichgültig ist, eigene oder fremde zu nennen, und mit welchen das Bewusstsein, das geradezu ans Prüfen geht, noch erfüllt und behaftet, dadurch aber in der Tat dessen unfähig ist, was es unternehmen will. (76/73)
Die bislang nachvollzogenen Überlegungen machen auch verständlich, wie Hegel das Ziel des von ihm projektierten Weges versteht. Er sagt ja sehr deutlich: »Das Ziel aber ist dem Wissen ebenso notwendig als die Reihe des Fortganges gesteckt […].« (77/74) Das Ziel liegt dort, wo der Skeptizismus sich vollbringt, und das heißt: dort, wo Wissen gerade durch die Herausforderungen des Skeptizismus hindurch verständlich wird. Das Ziel liegt also für Hegel nicht dort, wo der Skeptizismus ausgeschaltet wurde, sondern dort, wo er sich gewissermaßen selbst verwirklicht hat.18 Das Ziel kann man in Hegels Sinn also mit folgender Frage auf den Punkt bringen: Wie kann man skeptisch sein, ohne zum Skeptiker zu werden? Die Antwort auf diese Frage kann vorläufig lauten: Man kann dies dadurch sein, dass man sich zu sich selbst immer und durchweg kritisch verhält, ohne sich und die eigenen Ansprüche dabei insgesamt aufzugeben. Wenn man sich in seinem Wissen durchsichtig geworden ist, dann weiß man, dass es einer ständigen kritischen Befragung des Wissens bedarf. Man identifiziert sich in diesem Fall auch mit der kritischen Selbstreflexion und nicht nur mit bestimmten Wissensinhalten, die man auf die ein oder andere Art und Weise erworben hat. Aus diesem Grund bleibt man auch in aller Kritik bei sich selbst. Hegel deutet in diese Richtung, das Ziel des von ihm anvisierten Weges zu verstehen, wenn er sagt:
Was auf ein natürliches Leben beschränkt ist, vermag durch sich selbst nicht über sein unmittelbares Dasein hinauszugehen; aber es wird durch ein anderes darüber hinausgetrieben, und dies Hinausgerissenwerden ist sein Tod. Das Bewusstsein aber ist für sich selbst sein Begriff , dadurch unmittelbar das Hinausgehen über das Beschränkte, und, da ihm dies Beschränkte angehört, über sich selbst; mit dem Einzelnen ist ihm zugleich das Jenseits gesetzt, wäre es auch nur, wie im räumlichen Anschauen, neben dem Beschränkten. Das Bewusstsein leidet also diese Gewalt, sich die beschränkte Befriedigung zu verderben, von ihm selbst. (77 f./74)
Mit diesen Ausführungen bezieht sich Hegel auf einen Unterschied, den unter anderem ein anderer der wichtigen Vorgänger Hegels, Johann Gottfried Herder (1744–1802), in seinen anthropologischen Überlegungen gemacht hat:19 Natürliche Lebewesen haben organische Anlagen, um in bestimmten Umgebungen lebensfähig zu sein. Sie sind in diesem Sinn unmittelbar an diese Umgebungen gebunden und auf diese beschränkt. Kommt es zu relevanten Änderungen dieser Umgebungen, zum Beispiel durch einen menschlichen Eingriff oder durch Naturkatastrophen, verändern sie sich oder gehen zugrunde. Bewusste beziehungsweise rationale Lebewesen hingegen können sich von ihren Umgebungen distanzieren. Sie können sich und ihre Umwelt befragen. Insofern ist für Menschen nichts einfach in ihrer bloßen Natur begründet, sondern immer erst dadurch, dass sie sich zu etwas verhalten. Sie können immer Fragen stellen wie: »Ist das richtig?«, oder: »Sollten wir das so machen?« Durch solche Fragen verderben sie sich, wie Hegel pointiert sagt, jede beschränkte Befriedigung. Alles, was ihnen einfach natürlich vorkommt, kann sich als unnatürlich, falsch oder anders erweisen.
Nun ist es allerdings Hegel zufolge nicht so, dass Menschen einfach von Natur aus kritikfähig sind. Sie müssen sich Kritikfähigkeit erarbeiten. In diesem Sinn spricht er davon, dass der Weg zum Wissen vom Wissen nur durch » Bildung « (76/73) zu erreichen ist (dieser Begriff wird entsprechend auch im Geistkapitel eine wichtige Rolle spielen). Er behauptet in der Einleitung damit, dass es sein Anspruch ist, das Wissen vom Wissen bis zu dem Punkt zu verfolgen, an dem wir uns in unserer – nichtnatürlichen – Konstitution als selbstkritische Wesen verständlich werden – als Wesen, die alles einer kritischen Prüfung zu unterziehen vermögen. Ist dieser Punkt erreicht, wird verständlich, dass ein Wesen bleiben kann, was es ist, auch und gerade dann, wenn es durch Selbstkritik Veränderungen anstößt. Genau diese Struktur will Hegel aufklären.
Damit lässt sich bereits ein erster Hinweis darauf gewinnen, warum die PhG immer wieder historische Entwicklungen einbezieht. Der Punkt, an dem wir uns als selbstkritische Wesen verständlich werden, ist aus Hegels Sicht als ein solcher zu verstehen, der historisch erreicht wurde – und zwar in der Moderne. Ich habe bereits in der Einführung dieses Kommentars betont, dass die Konstitutionsbedingungen eines angemessenen Wissens vom Wissen aus Hegels Sicht eine historische Dimension haben.20 Aus diesem Grund verfolgt er in dem Nachvollzug der Einseitigkeit unterschiedlicher Konzeptionen eines Wissens vom Wissen einen Weg, der zu einem modernen Standpunkt führt: zu einem sich vollbringenden Skeptizismus.21
Nachdem das Ziel des Hegelschen Projekts so weit umrissen ist, wendet sich Hegel der Frage der Methode zu und macht sich gewissermaßen selbst einen Einwand: Muss eine Untersuchung unterschiedlicher Arten und Weisen, Wissen zu verstehen, nicht auf eine Methode zurückgreifen? Wenn wir gesagt haben, dass es Hegel darum geht, die Wissensansprüche derer zu prüfen, die beanspruchen, etwas über Wissen zu wissen: Braucht eine solche Prüfung nicht bereits ein Wissen davon, wie Wissen richtig zu bestimmen ist, und in diesem Sinn einen Maßstab? In Hegels Worten klingt dieser Einwand folgendermaßen:
Diese Darstellung als ein Verhalten der Wissenschaft zu dem erscheinenden Wissen, und als Untersuchung und Prüfung der Realität des Erkennens vorgestellt, scheint nicht ohne irgendeine Voraussetzung, die als Maßstab zugrunde gelegt wird, stattfinden zu können. (78/75)
Hegel weiß, dass er aus der Perspektive von jemandem schreibt, der das Ziel bereits erreicht hat. Aus diesem Grund begreift er seine Darstellung als das » Verhalten der Wissenschaft zu dem erscheinenden Wissen«, und stellt sich vor die Frage, ob er nicht immer schon seine Erkenntnisse als Maßstab einbringen wird, wenn er irgendwelche Konzeptionen davon, was Wissen ist, in ihren Ansprüchen prüft. Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für das Verständnis des Vorgehens in dem Buch selbst. Hegel schenkt ihr im Rahmen der Einleitung auch fast die Hälfte des Platzes. Ich will sie in zwei Schritten resümieren:
Der erste Schritt besteht darin zu verstehen, was Hegel meint, wenn er sagt, das Bewusstsein gebe »seinen Maßstab an ihm selbst« (80/76). Diese wichtige Formulierung erfordert erst einmal eine terminologische Klärung: »Bewusstsein« bedeutet, wissend zu sein. Ein Bewusstsein ist eine bestimmte Art und Weise, etwas zu wissen. Es ist hilfreich, hier den Begriff der Bewusstseinsgestalt einzuführen, der sich bei Hegel erstmals am Ende der Einleitung findet (vgl. 83/80) und der – im Anschluss an Hegels Diktion – in der Sekundärliteratur vielfach verwendet wird, um Hegels Vorgehen in der PhG zu erklären. Hegel handelt in seinem Buch, so kann man mit diesem Begriff sagen, von unterschiedlichen Bewusstseinsgestalten. Wir wissen bereits, dass diese Bewusstseinsgestalten jeweils unterschiedliche Ideen davon haben, was Wissen ist und wie man es haben kann: Sie vertreten ein unterschiedliches Wissen vom Wissen. Ich will für solche Ideen einen knappen Begriff einführen, den ich den gesamten Kommentar über verwenden werde, nämlich den Begriff der Wissenskonzeption. Jede Bewusstseinsgestalt vertritt eine spezifische Wissenskonzeption.
Читать дальше