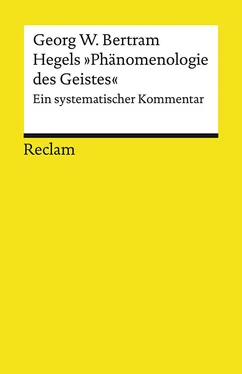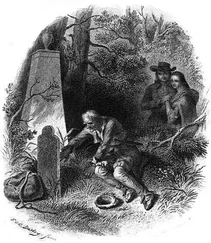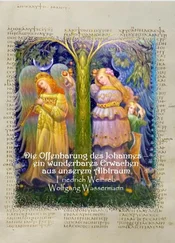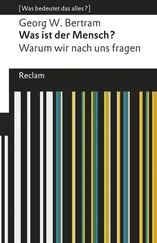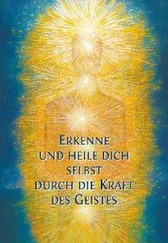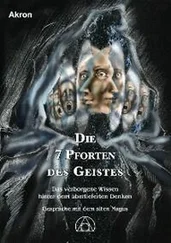1 Die ersten drei Absätze (71–73/68–70)13 artikulieren einen Ausgangspunkt, gegen den Hegel sich wendet, klären also indirekt, wie er nicht anfangen will.
2 Die Absätze vier bis acht (73–78/70–75) geben dann knapp an, wie er (stattdessen) vorgeht. Sie bieten in geraffter Form einen Ausblick auf die Entwicklung, die er in seinem Buch präsentieren will.
3 Die Absätze neun bis siebzehn (73–84/75–81) schließlich machen Angaben zur Methode der Entwicklung, die Hegel in der PhG präsentiert. Dabei behauptet er paradoxerweise, keine eigene Methode zu verfolgen.
In allen drei Teilen kann die Einleitung so gelesen werden, dass sie Hegels Selbstverständnis von Philosophie skizziert. Genau dies macht den Text reich und gleichermaßen dicht. Besonders wichtig aber ist, dass der Text klare Ankündigungen dazu macht, wie Hegel in dem Buch insgesamt vorgehen wird. Eine Lektüre der Einleitung sollte also dazu führen, dass Leserinnen und Leser ein erstes Verständnis dieses Vorgehens gewinnen.
Probleme der Interpretation
Die zentralen Fragen in der Interpretation der Einleitung lassen sich so fassen, dass jeder ihrer drei Abschnitte eine bestimmte Frage aufwirft.
(a) Gegen welche philosophischen Positionen und – sofern sich dies überhaupt sagen lässt – gegen wen richtet sich Hegel mit seinen Eingangsüberlegungen? Er kann leicht so verstanden werden, dass er hier bereits seine direkten Vorgänger Kant, Fichte und Schelling attackiert. Ist dies aber wirklich so und wenn ja: Was genau kritisiert Hegel an den Philosophien, von denen er sich abgrenzt?
Die zweite Frage betrifft die gerafften Angaben, die Hegel zu der in dem Buch präsentierten Entwicklung macht:
(b) Wie ist der Weg zu begreifen, den Hegel hier mit unterschiedlichen Formulierungen ankündigt? Er spricht zum Beispiel von einem »Weg der Seele«, dessen Ziel darin bestehe, »dass sie sich zum Geiste läutere« (75/72). Er spricht aber auch von einem »Weg der Verzweiflung« (75/72). Was besagen solche Formulierungen?
Die dritte Frage ist angestoßen von Hegels These, er benötige für sein Projekt keine eigene Methode und, damit zusammenhängend, von dem Begriff der Erfahrung, den Hegel ins Spiel bringt.
(c) Warum geht Hegel davon aus, dass Bewusstseinsgestalten sich immanent kritisieren, dass sie also in dem Sinne Erfahrungen machen, dass ihre Wissensansprüche sich in Bezug auf ihre Gegenstände als unzureichend erweisen, woraufhin sich, wie er sagt, sowohl das Wissen als auch sein Gegenstand ändert? Wie funktioniert eine solche immanente Kritik und insbesondere: Was kann es heißen, dass ein Gegenstand sich ändert? Wir gehen normalerweise davon aus, dass die Gegenstände, von denen wir Wissen zu erlangen suchen, sich nicht verändern, sondern dass sich zuweilen unsere Überzeugungen wandeln, während die Gegenstände bleiben, was sie sind. Revidiert Hegel dieses Verständnis von Erfahrung?
Hegel beginnt das große Buch damit, dass er von einer »natürlichen Vorstellung« spricht. Er erläutert sie folgendermaßen:
Es ist eine natürliche Vorstellung, dass, eh in der Philosophie an die Sache selbst, nämlich an das wirkliche Erkennen dessen, was in Wahrheit ist, gegangen wird, es notwendig sei, vorher über das Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, betrachtet wird. (71/68)
Es liegt nahe zu denken, dass Hegel erst einmal philosophische Positionen kritisiert, mit denen er sich auseinandersetzt, so zum Beispiel – wie bereits angeführt – die Positionen seiner Vorgänger Kant, Fichte und Schelling. Auch andere neuzeitliche Philosophen wie Descartes, Locke, Leibniz und Hume könnten als Positionen verstanden werden, mit denen Hegel gleich zu Beginn eine kritische Abrechnung vornimmt. So könnte er die These vertreten, dass manche oder alle dieser Philosophien einer natürlichen Vorstellung folgen, die es aber zu überwinden gelte (oder so ähnlich).
Genau das macht Hegel aber nicht. Er spricht nicht von unterschiedlichen philosophischen Positionen beziehungsweise einem bestimmten Typ von philosophischen Positionen. Vielmehr spricht er – im Sinne einer Reflexion darauf, was es heißt, mit einer philosophischen Reflexion anzufangen – von einem oftmals selbstverständlich gesetzten Ausgangspunkt. Viele Philosophien gehen demnach davon aus, dass die erste Aufgabe (der theoretischen Philosophie) in einer Analyse des Erkennens besteht. Dieser Ausgangspunkt lässt sich knapper fassen, wenn man sagt, dass Philosophie einer gängigen Auffassung zufolge Erkenntniskritik leisten soll. Demnach gibt es auf der einen Seite das Erkennen (die menschlichen Erkenntnisvermögen) sowie auf der anderen Seite das (von diesen Vermögen) Erkannte, und es muss zuerst geklärt werden, welche Mittel das Erkennen zur Verfügung hat, um Zugang zu dem zu bekommen, was erkannt werden soll. Das, was erkannt werden soll, ist die unabhängig von erkennenden Wesen bestehende Realität. Hegel spricht hier knapp von dem Absoluten. Absolut ist die Realität, weil sie losgelöst von uns als erkennenden Wesen Bestand hat. Das Erkennen – also die Kräfte in uns Subjekten, die uns erkenntnisfähig machen – wird, wie Hegel sagt, immer wieder als ein Werkzeug oder ein Mittel (beziehungsweise Medium) verstanden, das den Zugang zur Realität ermöglichen soll. Die natürliche Vorstellung besagt also, dass die Realität auf der einen Seite steht und das Subjekt mit seinen Erkenntniskräften auf der anderen und dass es zuerst zu klären gilt, in welcher Weise die Erkenntniskräfte uns Zugang zur Realität verschaffen.
Was kritisiert Hegel nun an dieser Vorstellung? Er sagt es deutlich im zweiten Absatz. Seine Kritik besteht erst einmal nicht darin, dass die Vorstellung falsch ist (auch wenn er am Ende zweifelsohne zu dieser Auffassung kommt). Vielmehr besagt sie in erster Linie, dass unbegründete Voraussetzungen im Spiel sind. Er formuliert folgendermaßen:
Sie [die Furcht zu irren, wenn man nicht zuerst die Möglichkeiten des Erkennens untersucht] setzt nämlich Vorstellungen von dem Erkennen als einem Werkzeuge und Medium , auch einen Unterschied unserer selbst von diesem Erkennen voraus; vorzüglich aber dies, dass das Absolute auf einer Seite stehe, und das Erkennen auf der andern Seite für sich und getrennt von dem Absoluten doch etwas Reelles, […]. (72 f./69 f.)
Wer denkt, dass die Philosophie mit Erkenntniskritik zu beginnen habe, macht also die Voraussetzung, dass es zwei Seiten gibt: die Seite des für sich bestehenden Objekts und die Seite des erkennenden Subjekts. Das Subjekt ist getrennt vom Objekt: Diese These wird von erkenntniskritischen Überlegungen vorausgesetzt. Aber wie ist diese These begründet? Woher weiß eine erkenntniskritische Philosophie, dass diese These gilt? Sie weiß es nicht – sie muss es unhinterfragt voraussetzen. Hegel spricht in diesem Sinn von einer »leere[n] Erscheinung des Wissens« (74/71). Die Erscheinung des Wissens ist deshalb leer, weil zentrale Begriffe wie die des Objekts oder des Subjekts nicht bestimmt worden sind, sondern einfach unbestimmt an den Anfang gesetzt werden. Damit führt sich das Projekt der Erkenntniskritik aber selbst ad absurdum . Es ist keine kritische Reflexion über die Möglichkeiten des Erkennens, sondern ein Sammelsurium unkritischer Behauptungen darüber, wie das Verhältnis von erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt beschaffen ist. Hegel beginnt damit in diesem Sinn seine Überlegungen mit einer Kritik des Projekts der Erkenntniskritik.
Es geht ihm also nicht primär darum, bestimmte Philosophien zu kritisieren. Seine Kritik richtet sich weder primär gegen Kant noch gegen Fichte oder – was man auch immer wieder vermutet hat – gegen Friedrich Heinrich Jacobi (1743–1819), einen Zeitgenossen, der eine spiritualistische philosophische Position in Anlehnung an Spinoza vertrat. Zwar ist es sicher richtig, dass alle diese Philosophen erkenntniskritische Ansätze verfolgen (und insofern auch von Hegels Kritik der Erkenntniskritik getroffen werden). Sie teilen dies mit nahezu allen anderen Philosophien, die in der Neuzeit und auch bereits in der Antike formuliert worden sind (und auch, nebenbei bemerkt, mit einer großen Zahl der Philosophien, deren Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wir sind). Hegel geht es jedoch um den erkenntniskritischen Ansatz als solchen, den er zu überwinden trachtet.
Читать дальше