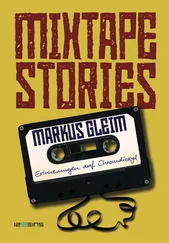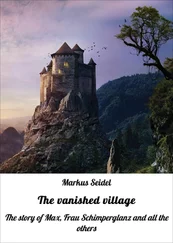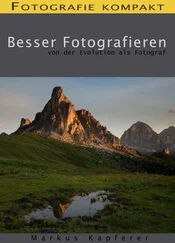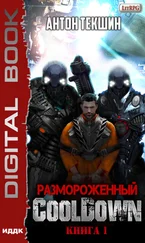Über mehrere Vergleichs- und Lernstufen hinweg kann das Gehirn dies auch mehr oder weniger zuverlässig leisten – sowohl kurzfristig in akuten Situationen als auch langfristig über ein ganzes Leben hinweg. Für die Verarbeitung von Außenreizen verbleibt nur ein Bruchteil der Hirnkapazität. Diese sollten wir klug nutzen und nicht mit beliebigem Informationskonsum »zumüllen«. Doch genau das tun wir im Alltag zu oft. Auch Information hat eine Qualität: für unsere gerade zu erledigende Aufgabe, für unser Wohlbefinden im Allgemeinen, unser Zusammenleben oder unsere Persönlichkeitsentwicklung.
Geht man von der Notwendigkeit des »Auswählens und Abwehrens« aus, müssen wir Dämme errichten, die uns erlauben, Informationen abzuwehren, zu filtern und zu kanalisieren. Das war für Menschen schon immer keine leichte Aufgabe. Der Drang zum Horten und Sammeln ist evolutionsgeschichtlich einfach sehr stark, prallt jedoch immer häufiger auf die Verheißungen und Möglichkeiten komplexer Technik, die wir noch nicht im Griff haben. Ein Beispiel: Was früher der Zettelkasten für Adressen war, also eine vielleicht chaotische, aber physisch überschaubare Angelegenheit, stellt sich heute als Adressverwaltung eines durchschnittlichen Arbeitnehmers mit den üblichen technischen Möglichkeiten als weitaus komplizierter dar.
Im Hintergrund ist das Gehirn ständig mit der Sortierung von Informationen und Eindrücken beschäftigt
Der Einzelne nutzt möglicherweise eine firmenweite Datenbank, auf die er über einen Server zugreift. Zusätzlich hat er vielleicht ein privates digitales Verzeichnis angelegt. Er ist vernetzt auf Plattformen wie XING oder Facebook. Und nicht zuletzt schlummern oft in E-Mails Adressdaten von Ansprechpartnern, die aus Zeitgründen nicht in die eigentliche Adressdatenbank übertragen wurden. In der Realität bedeutet Adressverwaltung daher meist einen Wust aus Daten unterschiedlicher Quellen und Qualität, auf die man nicht mehr mit dem kleinen schwarzen Notizbuch zugreift, sondern ausschließlich digital. Zwischen uns und einem Arbeitsergebnis steht also immer häufiger eine Technik, die wir zwar wollen und die uns fasziniert, mit der wir jedoch nicht ökonomisch umgehen können. Uns fehlen die entsprechenden Arbeitsabläufe – und die Disziplin zur Entscheidung.
Wo immer mehr Daten und Informationen auf uns einprasseln, müssen wir den Mut haben, abzublocken und auch mal eine E-Mail zu löschen (und sie nicht im Archiv oder in einem Unterordner der Inbox vergraben). So wie wir unser Gehirn zunehmend in Smartphones, Tablets oder die Cloud auslagern, müssen wir auch die wertvolle Eigenschaft des Vergessens mit auslagern. Sonst enden wir langfristig in Datenmüll und Resignation. Und bis wir diese Technik des Vergessens aktiv eingeübt haben, müssen wir uns mit der Lernvorstufe begnügen: der bewussten Entscheidung, Informationen zu filtern und abzuwehren.
Diese Entscheidung kann viele Gesichter haben: eine Zeitung abbestellen, die man sowieso nicht mehr liest, E-Mails eines bestimmten Absenders automatisch und konsequent sofort in den Papierkorb umleiten, den Fernseher ausmachen und stattdessen eine Runde um den Block spazieren gehen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Doch die Kernanforderung bleibt: Wir müssen Entscheidungen treffen und Informationen filtern.
Am Anfang steht eine Erkenntnis: Weniger ist mehr
Eines muss uns klar sein: Auch bei optimaler Informationsnutzung, den Mut zur Entscheidung und bewährten Filterprozessen werden wir nie mehr ohne Informationen sein – allenfalls in der Wüste Gobi oder den kanadischen Wäldern. Besonders im Arbeitsprozess wird der Informationsdruck nie mehr nachlassen. Viele Menschen wünschen sich eine aufgeräumte Inbox, keine Telefonate auf der To-do-Liste und das Gefühl der Erleichterung, endlich von der Last der Kommunikation befreit zu sein. Doch wir können nicht mehr ins Paradies zurück. Wir müssen vorwärtsschauen und das Beste aus der Situation machen.
Und wir sollten auch ehrlich anerkennen: Der Arbeitsdruck wird nicht mehr nachlassen. Wir können gar nicht so viel wegarbeiten, wie durch den »Arbeitstrichter« nachrutscht. Dieser Tatsache gelassen ins Auge zu sehen ist einer der wichtigsten Punkte für Arbeitsfähigkeit, Selbstmanagement und auch den Schutz vor Arbeitskrankheiten wie Burnout. Denn bei vielen Menschen fängt ja die Überforderung mit dem Gefühl an: Jetzt gehe ich heim, und es liegt noch so viel auf dem Schreibtisch. Und dieser Gedanke begleitet sie Tag für Tag, zermürbt sie und raubt ihnen die Perspektive (siehe auch das Kapitel Selbstmanagement). Und obwohl wir dagegen in Teilen angehen können – durch Informationsfilterung, Prozessoptimierung und angepasste Führung –, bleibt doch die Tatsache, dass wir in kommunikativen Zwängen stecken, unabweisbar.
Das zu akzeptieren fällt uns immer noch schwer. Wir suchen unser Heil nicht in einer veränderten Einstellung, in einer Art »gelassener Disziplin« bzw. »disziplinierter Gelassenheit«, die uns helfen würde, unser Informations- und Kommunikationsverhalten angemessen zu gestalten.
Vielmehr richten wir unser Augenmerk nach außen auf die Technik. Doch die Technik in Gestalt von Smartphones, Laptops, Sozialen Netzwerken etc. ist und bleibt nur ein Hilfsmittel, wenn es um die Organisation unserer eigenen Vernetzung geht. Eine Krücke wird auch nicht von selbst laufen. Sie ist dazu da, um uns zu stützen, wenn wir das brauchen. Nicht mehr und nicht weniger.
Mit Disziplin und Gelassenheit Übersicht und Lebensfreude erlangen
Nun benutzen manche Menschen Krücken, auch wenn sie sie nicht mehr brauchen; vielleicht haben sie sich an sie gewöhnt. Andere weigern sich, Krücken zu benutzen, weil sie davon ausgehen, dass ihr kaputter Fuß das Humpeln schon aushält. Beide Haltungen sind nicht sehr klug. Wir brauchen Augenmaß: weder sollten wir vor der Technik kapitulieren noch uns ihr unterwerfen. Ein kleiner Kreis boykottiert beispielsweise Smartphones aus ideologischen Gründen. Der Modezar Karl Lagerfeld hat das so formuliert: »Wer ständig und überall erreichbar ist, gehört zum Personal.« Die andere Fraktion glaubt, mit immer neuerer und ausgefeilterer Technik das Überlastungsproblem und die Informationsflut lösen zu können: mit E-Mail-Filtern, »intelligenten« To-do-Listen und Zeitplänen, angepasster Software etc. Diese Instrumente sind grundsätzlich sinnvoll. Aber sie sind und bleiben vor allem eins: Krücken. Kanäle, die zwischen mir und der Information stehen. Sinnvolles Informationsmanagement lässt sich nun mal nicht ausschließlich mit der »1 oder 0«-Entscheidung einer Software lösen. Ebenso wichtig sind Augenmaß und disziplinierte Gelassenheit. Eigenschaften, die der Mensch mitbringen muss und die ihm kein Smartphone abnehmen kann.
Im besten Fall kombinieren wir für uns sinnvolle Informationen mit kompetenter Techniknutzung und der persönlichen Fähigkeit zum Auswählen und Aussortieren. Gelingt uns das, können wir unseren eigenen Informations- und Kommunikationsstil entwickeln. Im Arbeitsleben zeigt sich eine derartige Reifung durch individuelle, automatisierte Arbeitsabläufe.
Wir wissen dann sofort, wie wir welche Informationen zu behandeln haben, schalten Informationsquellen bewusst an oder aus, sortieren und kategorisieren schnell und können ebenso schnell wieder zu unserer eigentlichen Aufgabe zurückkehren.
Durch routiniertes Handeln vermeiden wir Selbstüberforderung
So wie jeder Mensch einen individuellen Fingerabdruck hat oder einen ganz eigenen Gang, wird auch sein Informationsverhalten ganz individuell sein. Individuell nicht nur in einem natürlichen Sinn (das ist es ohnehin), sondern individuell in einem professionellen Sinn. Nicht mehr wie ein Amateurmusiker, der sich noch auf das Instrument in seiner Hand oder die Akkorde konzentrieren muss, sondern wie ein Profi, der bei jeder Note das ganze Stück im Kopf behält und weiß, welcher Sound entstehen soll. Wir brauchen Übung und Routine, die dafür sorgt, dass wir den Kopf frei haben für andere Dinge.
Читать дальше
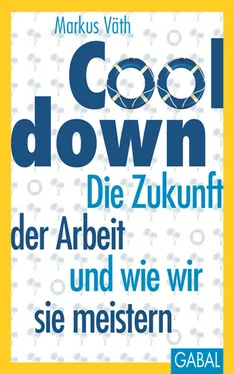

![Антон Текшин - Cooldown [СИ]](/books/416971/anton-tekshin-cooldown-si-thumb.webp)