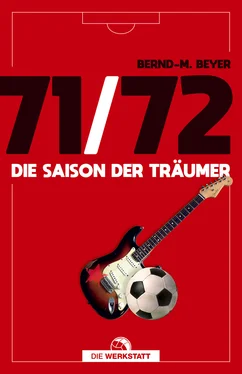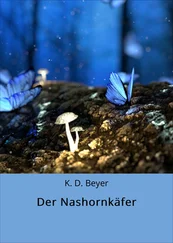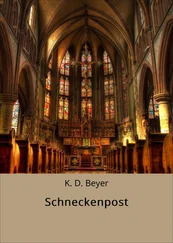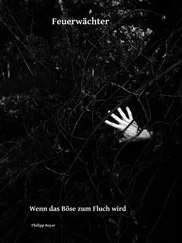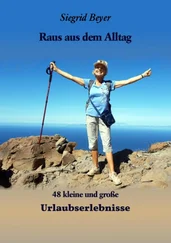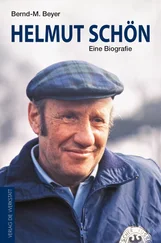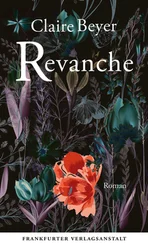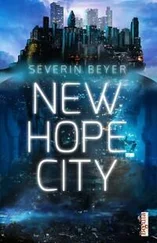Neben einer Demokratisierung der Gesellschaft ist die Ostpolitik das zweite zentrale Projekt von Bundeskanzler Willy Brandt und Außenminister Walter Scheel. Durch Gesten und Abkommen wollen sie die Narben des Weltkriegs und des Nazi-Terrors heilen, den aktuellen Kalten Krieg überwinden und zwischen dem realsozialistischen Osteuropa sowie dem kapitalistischen Westen eine Verständigung voranbringen. Auch der „Eiserne Vorhang“, der die DDR von der BRD abschottet, soll durch Entspannungspolitik und diplomatische Normalisierung durchlässiger werden. Unumstritten ist das keineswegs, CDU und CSU opponieren, die Vertriebenenverbände schäumen. Dem einstigen Exilanten Brandt wird Verrat der deutschen Interessen vorgeworfen, weil er mit der Oder-Neiße-Grenze, der Westgrenze Polens, eine Nachkriegsrealität anerkannt und vertraglich darauf verzichtet hat, die staatlichen Grenzen in Osteuropa gewaltsam zu verändern. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß sieht darin eine „freiwillige Kapitulation Deutschlands“. Auf einer Kundgebung der Vertriebenen wird skandiert: „Fegt ihn weg, den roten Dreck!“ Mitglieder der NPD schreien sogar: „Scheel und Brandt – an die Wand!“ Eine andere Mordphantasie zeigt ein Transparent des rechten Netzwerks „Aktion Widerstand“, das auch im Ausland große Beachtung findet. Es zeigt einen Galgen und trägt die Aufschrift: „Hängt die Verräter!“ Gemeint sind erneut Brandt und Scheel.
In den Augen rechtskonservativer wie auch brauner Geister ist Deutschland nicht zweigeteilt in BRD und DDR, sondern dreigeteilt: Einige Landstriche Polens sowie Ostpreußen warten seit Kriegsende darauf, wieder heim ins Reich geholt zu werden. Die DDR ist in dieser Sichtweise geografisch nicht Ost-, sondern Mitteldeutschland. An nicht wenigen Landstraßen stehen noch immer zerschrammte Schilder in den Kaiserreich- und Nazifarben Schwarz-Weiß-Rot. Auf ihnen ist ein zerspaltenes Deutsches Reich in den Staatsgrenzen von 1937 zu sehen, also aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Daneben steht ein zorniges: „Dreigeteilt? Niemals!“
Auch die ARD-Wetterfrösche zeigen die Vorhersage für Deutschland auf einer Karte von der Maas bis an die Memel. Bis 1970 sind darin noch die deutschen Staatsgrenzen verzeichnet, auch hier in der großdeutschen Version anno 1937. Sogar in den Schulkarten firmieren große Teile Polens noch unter „Deutsches Reich“ mit dem Vermerk: „Derzeit unter polnischer Verwaltung.“ Und die DDR wird dort noch immer „Sowjetisch besetzte Zone“ (SBZ) genannt. Ähnlich sieht man es in manchen Zeitungen. Konservative Blätter setzen ein „sog.“ vor die DDR oder flankieren sie mit Gänse füßchen. Erst im Juli 1971 hat die Bundesregierung – gegen den Protest aus CDU/CSU – festgelegt, dass die offizielle Bezeichnung weder SBZ noch die Anführungszeichen seien, sondern schlicht: DDR.
Es ist ein Konflikt, der auch Familien spaltet, vor allem, wenn sie aus ehemaligen deutschen Ostgebieten stammen. Wolfgang Weber, Kölns Nationalverteidiger, wurde in Hinterpommern geboren, früher Deutsches Reich, heute Polen, und seine Eltern hoffen noch immer, dorthin zurückkehren zu können. Doch Weber weiß: „Mir war schon als Jugendlichem völlig klar, dass dies nicht ohne einen neuen Krieg gehen könnte. Deshalb war Willy Brandt für mich ein Held, während er für meine Eltern der Verräter war.“
Im Fußball ist im Übrigen von einer innigen Verbundenheit mit dem verlorenen Rest des Deutschen Reiches nicht viel zu spüren. Die DDR-Oberliga stößt im Westen weitgehend auf Desinteresse; auf den Sportseiten der bundesdeutschen Tageszeitungen wird fast nichts berichtet und selbst in der Fachzeitung „Kicker“ ziemlich wenig. Immerhin ohne Gänsefüßchen.
***
Bei Fortuna Düsseldorf gewinnen die Schalker mit 2:0. Trotzdem sind sie sauer: auf Schiedsrichter Walter Eschweiler. Der hat nach einem Zweikampf zwischen Geye und Rüssmann in der 80. Minute auf Elfmeter entschieden. Wütend bedrängen ihn die Schalker Spieler, allen voran Rüssmann, der sich unschuldig fühlt und schreit: „Das können Sie doch nicht pfeifen, Sie Drecksau.“ Rote Karte (und vier Spiele Sperre), trotz der vornehmen Anrede „Sie“. Rüssmann setzt sich auf die Bank und vergräbt weinend sein Gesicht im Anorak. Sogar sein Gegenspieler Reiner Geye protestiert gegen die Entscheidung. Umsonst, aber dafür pariert Nigbur den Elfer. Später wird Rüssmann vermuten, Zuschauer, die auf den Platz gelaufen seien, hätten die Beleidigungen gerufen. Der Abwehrrecke mit den Bügeleisenfüßen gilt ansonsten nicht als Raubein. Gerd Müller schätzt ihn sogar als liebsten Gegenspieler, denn: „Der hat sich immer schon vor dem Foul entschuldigt.“
Nach dem Spiel in Düsseldorf gibt’s keine Entschuldigungen, vielmehr schimpft Schalkes Trainer Horvat auf der Pressekonferenz: „Wenn mir das passiert wäre, ich hätte den Schiedsrichter heute k. o. geschlagen. So einen Elfmeter habe ich noch nie erlebt.“ Den irritierten Journalisten trägt er auf, seine Worte genau so aufzuschreiben. Schließlich: „In Deutschland ist Demokratie. Da kann man alles sagen.“ Präsident Siebert legt nach: „Dieser Mann pfeift nie mehr ein Spiel von Schalke, dafür werde ich sorgen.“ Wie gesagt: Schalker Bosse und starke Sprüche … Horvat kostet die dicke Hose allerdings 2.000 Mark Strafe.
Libuda steht erneut nicht im Kader, laut Verein hat er sich krankgemeldet. Was ihm fehlt, wird nicht bekannt, Präsident Siebert meint ratlos: „Der Junge ist ein Rätsel geworden.“ Die Vereinsärzte kümmern sich intensiv um „die Mimose vom Schalker Markt“ („WAZ“). Um die üblichen Sportmaleschen geht es dabei nicht, denn sie beteuern: „Verletzungsanfällig ist er weniger.“ Doch was ist es dann? Auf der Suche nach einer schlüssigen Diagnose schickt man ihn zum Internisten, zum Zahnarzt und sogar ins Krankenhaus, doch auch die Untersuchung dort bleibt ergebnislos. Offiziell wird eine Muskelzerrung genannt, doch der Patient selbst durchkreuzt die Sprachregelung: Das sei längst ausgeheilt, weshalb er höchst verärgert sei über seine Nich t-nominierung. „Bild“ fragt vielsagend: „Ist Libuda verletzt oder hat er Sorgen mit seiner Familie?“ Darüber werde auf Schalke „hinter der vorgehaltenen Hand geflüstert“. Der Stan wehrt sich: „Das ist eine Unverschämtheit, wie sich die Leute darüber das Maul zerreißen. Mir hat man sogar auf den Kopf zugesagt: Meine Frau sei mit 30.000 Mark durchgegangen. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Meine Frau ist zu Hause. Sie sitzt neben mir.“
***
Im September feiert in Westberlin ein heiß diskutierter Film Premiere: „Paragraph 218 – Wir haben abgetrieben, Herr Staatsanwalt.“ Mit dem Paragrafen 218 wird „eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtötet oder die Abtötung durch einen anderen zulässt“, mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Das strikte Verbot veranlasst viele schwangere Frauen, die ihr Kind beispielsweise in einer sozialen Notlage nicht austragen wollen, zu einer illegalen Abtreibung. Auf fast eine halbe Million schätzt man deren Zahl für die Bundesrepublik, jährlich. Der heimliche Eingriff führt nicht selten zu schweren gesundheitlichen Schäden. Der Film thematisiert diese schattenhafte Abtreibungspraxis in Deutschland; laut Werbung zeigt er, „was Frauen heute noch verschweigen müssen“. Weil der Streifen auch ausgiebig dokumentiert, wie es zu einer Schwangerschaft kommt, werfen ihm Kritiker vor, er spekuliere „auf den Voyeurismus verklemmter Zuschauer“. Der Regisseur des Films hat im Juni 1971 schon den als „Aufklärungsfilm“ verbrämten Softporno „Hausfrauenreport“ gedreht und darin einige Schauspieler/innen eingesetzt, die auch in „218“ vor der Kamera liegen. Die pornografischen Anklänge nutzen nichts, nach zwei Wochen mageren Zuschauerzuspruchs wird der Streifen abgesetzt.
Читать дальше