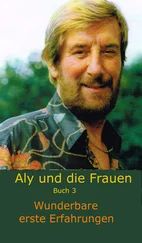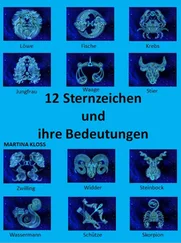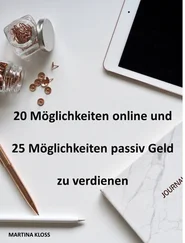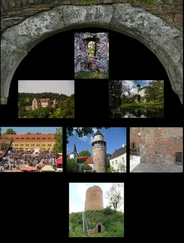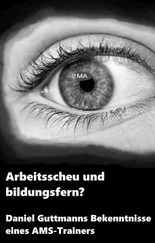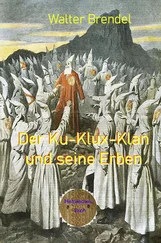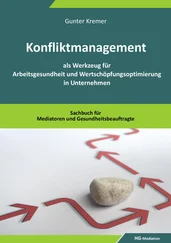Werte sind wiederum generalisierte ideologische Rechtfertigungen oder Ziel- und Wunschzustände (Katz & Kahn, 1966).
Rollen, Normen und Werte sind die Basis für integrierte soziale Systeme, denn die sich in sozialen Systemen befindenden Mitarbeiter/innen sind durch ihre funktionalen Rollen interdependent miteinander verbunden bzw. vernetzt. Die Normen fügen ein zusätzliches kohäsives Element hinzu, sodass sich alle Mitarbeiter/innen an gemeinsame Qualitätsstandards halten.
Soziale Systeme als musterartige interdependente Aktivitäten von Menschen zu verstehen, die durch Rollen charakterisiert sind, erfordert von Organisationen, sich mit den Besonderheiten der Übernahme von Rollen auseinanderzusetzen.
In der organisationalen Rolle finden sich nur Teile der Person eines/einer Mitarbeiter/in wieder. So erfordert die Übernahme einer Rolle, dass eine Person zumindest teilweise die eigene Persönlichkeit »aufgibt« (Kirchler et al., 2004). Nur der Teil der Person kann mit in die Rolle integriert werden, der mit der organisationalen Rolle übereinstimmt. Organisationen müssen sich deshalb bewusst sein, dass Mitarbeiter/innen als Mitglieder dieses sozialen Systems nur temporär diese Rolle übernehmen und sich entscheiden müssen, welche Konsequenzen diese temporäre Übernahme bzw. die temporäre Übereinstimmung von Person und Rolle für das eigene Verhalten hat (Kirchler et al., 2004).
Die organisationale Definition der einzelnen Rollen ist nicht notwendigerweise identisch mit dem Rollenverständnis des/der designierten Rollenträger/in. Obwohl die Organisation und die »Peers« durch Sozialisationsprozesse die Rollenerwartungen und die »Dos und Don‘ts« vermitteln, bleibt dem/der einzelnen Mitarbeiter/in Interpretationsspielraum, wobei auch individuelle Werte und Einstellungen sowie Ansprüche an die eigene Arbeit die Vorstellung der eigenen Rolle prägen (Kirchler et al., 2004).
Die Übernahme von Rollen kann zu komplexen Verhaltenserwartungen führen. Komplex werden die Erwartungen in dem Moment, wenn die Rolle mehrere Aktivitäten umfasst oder eine Tätigkeit mehrere Rollen oder eine Person mehrere Tätigkeiten innehat (Kirchler et al., 2004).
Im Falle von komplexen Rollen-Verhaltenserwartungen kann es zu Rollenkonflikten kommen. Rollenkonflikte entstehen z. B., wenn die Anforderungen aus der Rolle den persönlichen Werten widersprechen, wenn von mehreren Personen konfligierende Erwartungen an den/die Rollenträger/in gestellt werden (z. B. Vorgesetzte haben andere Erwartungen an eine Führungskraft als die Geführten), wenn aus verschiedenen Rollen widersprüchliche Anforderung an die eigene Person gestellt werden (z. B. als Vater wäre ich gerne bei meinem neugeborenen Kind, als Führungskraft muss ich aber 150 % vor Ort sein), und wenn die Anforderungen einer Rolle den/die Rolleninhaber/in in seinen/ihren Fähigkeiten überfordern (Kirchler et al., 2004).
Betrachtung aus heutiger Sicht
Der Rollenbegriff hat sich in der Arbeits- und Organisationspsychologie als fester Betrachtungsbestandteil etabliert. Auch die Stressforschung hat sich z. B. mit Rollenstress befasst, sodass der Rollenbegriff auch auf der Mikroebene (siehe vorne) Beachtung findet. Neben der Beschreibung von Organisationen als offene Systeme, die im Austausch mit ihrer Umwelt agieren, haben sich Katz und Kahn (1966) mit bis heute aktuellen Thematiken wie Motivation und Führung und der organisationalen Effizienz befasst. Auf diese Aspekte wird im Kapitel zu Determinanten der Arbeitsleistung (  Kap. 7) eingegangen.
Kap. 7) eingegangen.
Die Theorie der sozialen Systeme ist zeitlos und diejenige Theorie, die am unabhängigsten von technischen Entwicklungen und Produktions- und Informationstechnologien ist. Die Beschreibung einer Organisation als musterartige interdependente Aktivitäten von Menschen, die durch Rollen charakterisiert sind, ist wenig abhängig von technologischen Entwicklungen, da sie auf einem abstrakteren Niveau als viele der anderen Theorien formuliert wurde. Dennoch zeigen sich auch hier technologisch geprägte Varianten von Rollen. Rollen werden z. B. in den oben bereits eingeführten Enterprise Resource Planning-Systemen (ERP) sichtbar. Den an einem Prozess beteiligten Mitarbeiter/innen werden in diesen ERP-Systemen »Rollen« zugewiesen, d. h. Befugnisse eingeräumt. Ein/e Mitarbeiter/in kann zwar die Rolle haben, eine Bestellung für Büromaterial in das Bestellsystem einzugeben. Je nach Umfang der Bestellung muss ein/e Vorgesetzte/r in der Rolle »Budgetverantwortliche/r« diese Bestellung aber zunächst autorisieren, bevor sie zum Lieferanten gelangt. Wer welche Rolle in einer Organisation innehat, zeigt sich deshalb auch hier vor allem in Zugriffsrechten in Informationssystemen oder auch in Zutrittsrechten (also wo Sie mit Ihrem Firmenausweis Zutritt haben). So haben die meisten Mitarbeiter/innen keine Administratorenrechte, dürften nur bestimmte Bereiche des Servers nutzen und sehen daher auch nicht alles, was an Daten in einer Organisation prinzipiell vorhanden ist.
Nach der Einführung in die Organisationstheorien und deren Entwicklungsgeschichte, soll im Folgenden nun auf eine aktuelle neuere Organisationstheorie und auf zukünftige Entwicklungen eingegangen werden.
1.3 Die neuen Theorien: High Reliability-Organisationen und Cyber-physische Systeme
High Reliability Organization
Organisationstheorien befassen sich mit dem Wesen von Organisationen, den Kernprozessen und Routinen, der Struktur und Führungsprozessen, deren Veränderung und ihrer Leistung (  Kap. 1.2). In den 1980er Jahren rückten zunehmend Organisationen in den Fokus von Organisationsforscher/innen, denen bis dahin keine gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt wurde: die sog. High Reliability-Organisationen (HROs). Während die meisten Organisationen nicht davon ausgehen, dass sie in eine Krise geraten, planen die HROs diese Krisen in ihr tägliches organisationales Tun mit ein (Roberts, 1989). HROs sind hoch komplexe technische Systeme (Kluge, 2014; Kluge, Nazir & Manca, 2015) in denen tausende von Variablen miteinander interagieren und die eine hohe Vernetztheit aufweisen (Kluge et al., 2015).
Kap. 1.2). In den 1980er Jahren rückten zunehmend Organisationen in den Fokus von Organisationsforscher/innen, denen bis dahin keine gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt wurde: die sog. High Reliability-Organisationen (HROs). Während die meisten Organisationen nicht davon ausgehen, dass sie in eine Krise geraten, planen die HROs diese Krisen in ihr tägliches organisationales Tun mit ein (Roberts, 1989). HROs sind hoch komplexe technische Systeme (Kluge, 2014; Kluge, Nazir & Manca, 2015) in denen tausende von Variablen miteinander interagieren und die eine hohe Vernetztheit aufweisen (Kluge et al., 2015).
Bei HROs handelt es sich um Unternehmen aus Bereichen, in denen absolut fehlerfrei und damit hoch zuverlässig operiert werden muss, damit durch technische Fehlfunktionen, Fehlhandlungen oder andere technische und menschlichen Unfälle kein Schaden für Mensch und Umwelt entstehen kann, z. B. Kern- und Kohlekraft, Chemie- und Pharmaunternehmen, Organisationen aus der Luftfahrt wie Luftfahrtgesellschaften oder die Flugsicherung, militärische Organisationen oder Organisationen aus dem Gesundheitsbereich wie Krankenhäuser. HROs werden auch als »high risk«-Organisationen oder als »harzardous organizations« beschrieben.
Zuverlässigkeit umfasst drei Aspekte (Fahlbruch, Schöbel & Domeinski, 2008):
• Korrektheit (nach Vorgaben verlaufend)
• Robustheit (System kann auftretende Störungen ausgleichen)
• Ausfallsfreiheit (definierte Sicherheit gegen einen Ausfall)
Im Dezember 2014 veröffentlichte das Chemical Safety Board der US-amerikanischen Regierung eine Pressemitteilung zum 30. Jahrestag des Chemieunglücks in Bhopal, Indien, bei dem durch einen Unfall der Union Carbide-Anlage für Pestizide mehr als 3.800 Menschen unmittelbar ums Leben gekommen waren, sowie zehntausende durch die Spätfolgen ( www.csb.gov, vom 2. Dezember 2014). Bhopal ist nur ein sehr tragisches Beispiel für den Schaden, der entstehen kann, wenn »high risk«-Organisationen nicht fehlerfrei operieren. Das Seveso-Unglück von 1976, das Reaktorunglück von Tschernobyl 1986, die Explosion der BP-Raffinerie in Texas City 2005 oder die Explosion der Öl-Plattform Deep Water Horizon 2010 sind weitere Beispiele für die tragischen Konsequenzen für Menschen und Umwelt im Falle eines menschlichen Bedienfehlers, einer falschen Entscheidung oder von technischem Versagen.
Читать дальше
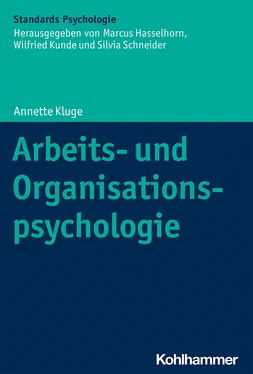
 Kap. 7) eingegangen.
Kap. 7) eingegangen.