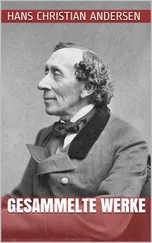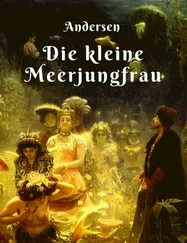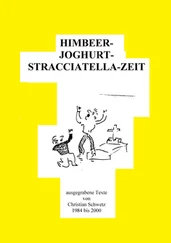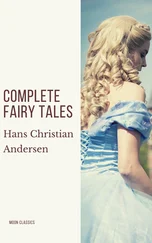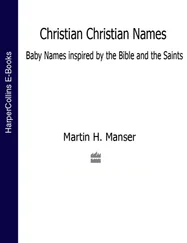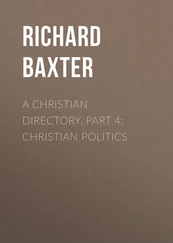Nachdem Sie nun einiges zur Datensicherheit erfahren haben, verraten wir Ihnen jetzt endlich, was es mit dem Datenschutz auf sich hat. Während die Datensicherheit in erster Linie den eigenen Sicherheitsinteressen des Datenverarbeiters dient, geht es beim Datenschutz um die Rechte anderer. Das sind die Rechte der Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Der Schutz dieser Daten ist nicht immer unbedingt auch zugleich im Interesse des Verarbeiters.
Der Datenschutz will das Recht jedes einzelnen schützen, Herr über seine ihn betreffenden Informationen zu sein. Im deutschen Recht bezeichnet man dies als das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 15. Dezember 1983). Es soll sicherstellen, dass alle Menschen möglichst selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten bestimmen können. In der Gesetzgebung der Europäischen Union ( EU ) gibt es dieses Recht so nicht. Hier gilt Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention ( EMRK ), wonach den Bürgern der EU ein Recht auf Privatheit zusteht. Durch die DSGVO wird dieses Recht präzisiert und im Einzelnen geregelt. Gegenstand des Schutzes sind personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1) im Gegensatz zu Unternehmens-, Behörden- oder technischen Daten. Erwägungsgrund 1 stellt in diesem Zusammenhang klar, dass der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein Grundrecht ist, und nimmt zusätzlich Bezug auf Art. 16 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ( AEUV ), wonach jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten hat. Doppelt und dreifach hält besser.
Schutzziele des Datenschutzes
Zu wissen, dass der Datenschutz personenbezogene Daten schützt, beantwortet aber noch nicht die Frage, weshalb der Datenschutz schützt, was er schützt. Wozu ist es gut, gerade personenbezogene Daten besonders zu schützen? Die DSGVO sagt in Art. 1 Abs. 2, dass durch die DSGVO der Schutz der Grundrechte und der Grundfreiheiten natürlicher Personen sichergestellt werden soll. Aber welche Grundrechte und Grundfreiheiten könnten denn gefährdet sein bei Datenschutzverletzungen? Die Datenschutzverletzung selbst ist für sich allein genommen noch keine Gefahr für unsere Grundrechte und Grundfreiheiten.
 Datenschutzverletzungenkönnen nach Art. 4 Nr. 12 bestehen in
Datenschutzverletzungenkönnen nach Art. 4 Nr. 12 bestehen in
unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger Vernichtung personenbezogener Daten,
unbeabsichtigtem oder unrechtmäßigem Verlust personenbezogener Daten,
unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger Veränderung von personenbezogenen Daten,
unbefugter Offenlegung personenbezogener Daten oder
unbefugtem Zugang zu Daten.
Aus Datenschutzverletzungen können sich aber sehr wohl konkrete Gefahren für die Grundrechte und Grundfreiheiten von Personen ergeben. Solche Gefahren können sein:
Diskriminierung
Identitätsdiebstahl
Finanzieller Verlust oder wirtschaftliche Nachteile
Gesellschaftliche Nachteile
Unbefugte Bewertung persönlicher Aspekte
Manipulation
Verlust der Vertraulichkeit
… und vieles andere mehr
Alle Menschen sollen vor dem Gesetz gleich sein und nicht willkürlich benachteiligt werden. So will es die EMRK, so wollen es auch die Verfassungen der Mitgliedstaaten.
 Grundsatz der Gleichheit: Gleiches soll nach dem Gleichheitsgrundsatz gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Bei der Gleichbehandlung von Ungleichem oder der Ungleichbehandlung von Gleichem liegt ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz vor. Erklärt für Hundefreunde: Stellen Sie sich vor, Sie besitzen zwei Hunde, einen Rhodesian Ridgeback und einen Dackel. Beide haben das gleiche Bedürfnis an Aufmerksamkeit. Also behandeln Sie beide gleich und schenken beiden ihr gleiches Maß an Aufmerksamkeit. Beim Futter sieht es aber anders aus. Der eine benötigt am Tag ein Kilo Fleisch, der andere nur 250 Gramm. Deshalb berücksichtigen Sie diese Ungleichheit und füttern nicht beiden gerechterweise nur 250 Gramm, sondern dem Ridgeback die 750 Gramm mehr, die er braucht, um gesund zu sein und sich ebenso gesund zu entwickeln wie der Dackel, dem die 250 Gramm genügen.
Grundsatz der Gleichheit: Gleiches soll nach dem Gleichheitsgrundsatz gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Bei der Gleichbehandlung von Ungleichem oder der Ungleichbehandlung von Gleichem liegt ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz vor. Erklärt für Hundefreunde: Stellen Sie sich vor, Sie besitzen zwei Hunde, einen Rhodesian Ridgeback und einen Dackel. Beide haben das gleiche Bedürfnis an Aufmerksamkeit. Also behandeln Sie beide gleich und schenken beiden ihr gleiches Maß an Aufmerksamkeit. Beim Futter sieht es aber anders aus. Der eine benötigt am Tag ein Kilo Fleisch, der andere nur 250 Gramm. Deshalb berücksichtigen Sie diese Ungleichheit und füttern nicht beiden gerechterweise nur 250 Gramm, sondern dem Ridgeback die 750 Gramm mehr, die er braucht, um gesund zu sein und sich ebenso gesund zu entwickeln wie der Dackel, dem die 250 Gramm genügen.
Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Menschen aufgrund von Vorurteilen oder handfesten Eigeninteressen versuchen, andere Menschen auszugrenzen. Dazu benötigen diese Leute aber Informationen, die sie missbrauchen können. Die DSGVO will dem vorbeugen, indem sie in Art. 9 Abs. 1 bestimmte personenbezogene Daten, die für Missbrauch besonders geeignet sind, besonders schützt. Es handelt sich dabei um die besonderen Kategorien personenbezogener Daten.
 Welche Daten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören, können Sie noch einmal nachlesen in dem Kapitel Personenbezogene Daten unter der Überschrift Besondere Kategorien personenbezogener Daten .
Welche Daten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören, können Sie noch einmal nachlesen in dem Kapitel Personenbezogene Daten unter der Überschrift Besondere Kategorien personenbezogener Daten .
Die Diskriminierung kann zum Beispiel aufgrund bestimmter sexueller Neigungen erfolgen. Sie mögen zu Recht und mit dem Autor rufen: Ist mir doch egal, was andere in ihrem Bett machen! Aber leider gibt es Leute, denen das offenbar gar nicht egal ist und die auch noch glauben, diese peinliche Schnüffelei in fremden Betten sei gottgewollt oder moralisch erforderlich. Halten wir diesen Leuten zugute, dass es in ihren eigenen Betten wahrscheinlich etwas langweilig zugeht und sie Abwechslung in anderen Betten suchen. Aber leider neigen solche zwanghaften Weltverbesserwisserer nicht selten dazu, ihre Ansichten unter Einsatz von Gewalt unter das Volk zu bringen. In manchen Kulturregionen steht sogar Ihr Leben auf dem Spiel, wenn bekannt wird, dass Sie sexuell ein wenig aufgeschlossener sind als die ganzen anderen Langweiler. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass die DSGVO die sexuelle Orientierung unter einen besonderen Schutz stellt. Diskriminierung ist aber auch aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie , aufgrund genetischer Besonderheiten, aufgrund von Religionszugehörigkeiten und vielem mehr in unserer Welt an der Tagesordnung. Es ist deshalb ein besonderer Verdienst der DSGVO, diesbezügliche Daten besonders zu schützen.
Stellen Sie sich vor, Sie führen ein geruhsames Dasein, schlummern verdient Ihrem nächsten Arbeitstag entgegen und plötzlich steht um fünf Uhr morgens ein Sondereinsatzkommando der Polizei vor Ihrem Bett, weil Sie angeblich im Internet Drogen verkauft und dabei auch noch Geldwäsche betrieben haben. Wahrscheinlich genügt Ihnen schon einer dieser beiden Vorwürfe, um die Bedeutung des Begriffs Morgengrauen für die Zukunft völlig neu zu interpretieren. Dabei haben Sie mit all dem rein gar nichts zu tun. Ein findiger Drogendealer hat einfach Ihre Identität angenommen und unter Ihrem Namen – aber leider, ohne Ihnen etwas vom Gewinn abzugeben – einen Account im Darknet eröffnet, auf dem er munter Drogen verkauft. Es könnte dann schnell passieren, dass Sie Ihre Freiheit für lange Zeit einbüßen. Zumindest so lange, bis Sie die Staatsanwaltschaft und das Gericht davon überzeugt haben, dass Sie unschuldig sind. Wie, Ihnen muss doch bewiesen werden, dass Sie schuldig sind? Meinen Sie? Ja, Sie haben recht, das sollte so sein. Aber die Wirklichkeit sieht leider oft anders aus. Haben Sie schon einmal etwas von der Verfügbarkeitsheuristik gehört? Menschen – und Juristen sind bitte schön auch nur Menschen! – neigen zwanghaft dazu, die oft wenigen verfügbaren Informationen in ihrem Kopf zu einem für sie plausiblen Gesamtbild zu vereinen. Egal, ob das Gesamtbild, das dabei dann herauskommt, der Wirklichkeit entspricht oder nicht, ist es verdammt schwer, einen Menschen, der sich auf dieser Basis erst einmal ein Urteil gebildet hat, von seiner Überzeugung wieder abzubringen. Verfügbarkeitsheuristik eben.
Читать дальше
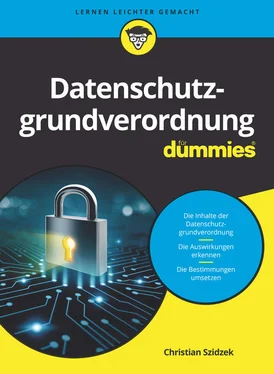
 Datenschutzverletzungenkönnen nach Art. 4 Nr. 12 bestehen in
Datenschutzverletzungenkönnen nach Art. 4 Nr. 12 bestehen in Welche Daten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören, können Sie noch einmal nachlesen in dem Kapitel Personenbezogene Daten unter der Überschrift Besondere Kategorien personenbezogener Daten .
Welche Daten zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gehören, können Sie noch einmal nachlesen in dem Kapitel Personenbezogene Daten unter der Überschrift Besondere Kategorien personenbezogener Daten .