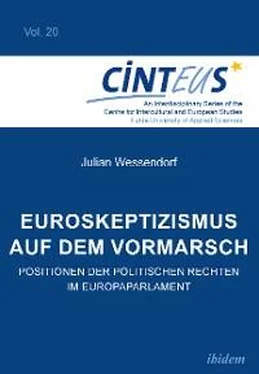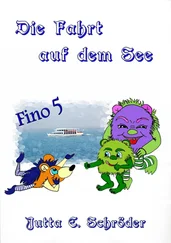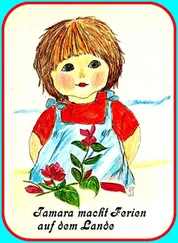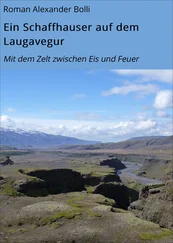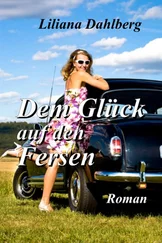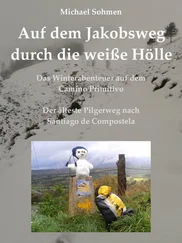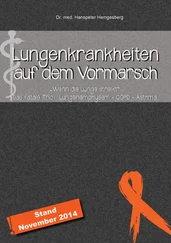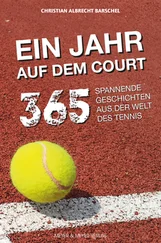Bei Aufkommen des Terminus Euroskeptizismus wurde dieser in Großbritannien zunächst vornehmlich synonym zu dem Begriff „anti-marketeer“ verwendet. Als „anti-marketeer“ bezeichnete man diejenigen Personen, die grundsätzlich gegen den Beitritt Großbritanniens zum Europäischen Binnenmarkt waren und diese Position auch nach dem britischen Referendum 1975 weiterhin beibehielten. Mit der Zeit entwickelte sich die Verwendung des Terminus Euroskeptizismus aber immer mehr zu einem generischen Sammelbegriff britischer Zweifel in Bezug auf Europa (vgl. Spiering 2004: 128). Später öffnete sich der Begriff etwas und fasste von nun an verschiedenste kritische Haltungen gegenüber der Europäischen Integration im Allgemeinen und der EU im Speziellen zusammen. Harmsen und Spiering (2004: 13) gingen sogar noch einen Schritt weiter und sprachen von einem eindeutig britischen Phänomen, dass dazu beitragen sollte, „a sense of the country’s ‚awkwardness‘ or ‚otherness‘ in relation to a Continental European project of political and economic integration“ hervorzuheben. Beschränkte sich die Euroskeptizismusforschung zu Beginn noch vornehmlich auf die westeuropäischen Staaten (u. a. Taggert 1998), so öffnete sich die Debatte mit der ersten Osterweiterung 2004 auch für die Staaten aus Mittel- und Osteuropa (u. a. Hooghe & Marks 2007; Szczerbiak & Taggert 2008).
2.1.1 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Euroskeptizismus und der aktuelle Forschungsstand
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema des Euroskep-tizismus wurde hauptsächlich von der Öffnung des Begriffs und seiner Erweiterung auf ganz Europa vorangetrieben. Die Diskussion erfuhr aber auch durch verschiedenste politische Entwicklungen in den 1990er Jahren zusätzliche Aufmerksamkeit, wie bspw. die Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte (1986) oder des Vertrags von Maastricht (1992). In dieser Zeit wurden vor allem zwei Ebenen des Euroskeptizismus wissenschaftlich untersucht: parteibasierter Euroskeptizismus und Masseneuroskeptizismus. 1Szczerbiak und Taggert (2003: 6) bemerken hierzu, dass die alleinige Verwendung des Sammelbegriffs Euroskeptizismus zur Beschreibung und Analyse der Auswirkung der Europäischen Integration auf Innenpolitik und Parteiensysteme vor allem dann Schwierigkeiten hervorbringe, wenn versucht würde, das Phänomen des Euroskeptizismus vergleichend – und hierbei im Speziellen – pan-europäisch zu untersuchen.
Aus diesem Grund versuchte der britische Politikwissenschaftler Paul Taggert (1998) eine allgemeine Definition des Euroskeptizismus, welche vor allem für den politischen Diskurs verwendbar sein sollte und eine präzisiere Differenzierung erlaubte. In diesem Zusammenhang unterteilte er den Euroskeptizismus zunächst in drei verschiedene Arten, die sich mit der Einstellung zur EU erklären lassen. In der ersten Kategorie definiert er den Euroskeptizismus im Sinne eines vollständigen Widerstandes gegen die europäische Integration und damit auch gegen die EU an sich (Taggert 1998: 365). Während diese Kategorie eine klar ablehnende Haltung gegenüber der EU impliziert, ist die Unterscheidung der anderen beiden Charakterisierungen nicht so eindeutig. Beide richten sich nicht prinzipiell gegen die europäische Integration, stehen jedoch der Annahme skeptisch gegenüberstehen, die EU verfolge die beste Art der Integration. Kategorie 2 argumentiert, die EU sei zu inklusiv und versuche Dinge zusammenzuführen, die zu unterschiedlich sind. Taggert (1998: 366) fasst hierunter diejenigen SkeptikerInnen zusammen, die der Meinung sind, die Rechte der einzelnen Staaten würden eingeschränkt werden und eine europäische Integration würde zwangsläufig große Migrationsströme mit sich ziehen. Typus 3 hingegen argumentiert, die EU sei sowohl auf geografischer als auch auf sozialer Ebene zu exklusiv. Hier bezieht sich Taggert vor allem auf diejenigen KritikerInnen, die bspw. meinen, die EU sollte auch außereuropäische Länder aufnehmen oder sie würde die Interessen der internationalen Arbeiterklasse übergehen. Zusammenfassend stellt Taggert (1998: 366) fest, dass Euroskeptizismus „the idea of contingent or qualified opposition, as well as incorporating outright and unqualified opposition to the process of European integration” ausdrückt. Nur kurze Zeit später konkretisierten Taggert und Szczerbiak Taggerts ursprüngliche Definition des Euroskeptizismus und führten die Unterscheidung zwischen weichem und hartem Euroskeptizismus ein, um vor allem den Grad der Ablehnung der europäischen Integration in der Definition deutlicher zu differenzieren. Demnach sehen sie im harten Euroskeptizismus einen generellen Widerspruch zur Europäischen Integration, der per definitionem die Forderung nach dem EU-Austritt nach sich zieht (Taggert & Szczerbiak 2001: 10). 2Auf der anderen Seite bezeichnen sie es als weichen Euroskeptizismus, wenn nur ein anteiliger Widerspruch gegen die Europäische Integration und die Mitgliedschaft in der EU besteht, die VertreterInnen dieser Form des Euroskeptizismus aber nicht grundsätzlich antieuropäisch eingestellt sind (Taggert & Szczerbiak 2001: 10). Einen zusätzlichen Unterscheidungsfaktor sehen Taggert und Szczerbiak im politisch und nationalistisch motivierten Euroskeptizismus (ebd.). Während der politisch motivierte Euroskeptizismus vor allem eine oppositionelle Haltung gegenüber vereinzelter politischer Themenfelder oder Verfahrensweisen darstellt, die je nach Aktualität oder individuellen Neigungen variieren können, bezeichnet der nationalistisch motivierte Euroskeptizismus das vehemente Eintreten für nationale Interessen auf europäischer Ebene. Bei dieser Unterteilung ist jedoch zu beachten, dass sich beide Formen des Euroskeptizismus nicht gegenseitig ausschließen müssen und es vereinzelt zu Überschneidungen kommen kann.
Vor allem am Begriff des weichen Euroskeptizismus kritisiert Miliopoulos (2017: 61), dass nach dieser Differenzierung keine Möglichkeit bestehe, zwischen weichem Euroskeptizismus und konstruktiv gemeinter EU-Kritik zu unterscheiden und dementsprechend fast jede kritische Haltung gegenüber der Politik der EU als weich euroskeptisch bezeichnet werden müsste. 3Auch Kopecký und Mudde (2002) kritisieren eine fehlende Präzision in der Unterscheidung der unterschiedlichen Ausprägungen des Euroskeptizismus. 4Ihre Kritik zielt vor allem auf vier Punkte ab. Wie auch Miliopoulos (2017) merken sie an, dass der Begriff des weichen Euroskeptizismus so weit gefasst sei, dass nahezu jede Nichtübereinstimmung mit einer EU-politischen Entscheidung in dieser Kategorie angesiedelt werden müsse und die Definition daher überinklusiv sei (Kopecký & Mudde 2002: 300). Zudem kritisieren sie, bereits die vermeintlich klare Unterteilung in hart und weich würde von Taggert und Szczerbiak selbst verwischt werden, da sie behaupten, der harte Euroskeptizismus könne als grundlegender Einwand gegenüber dem aktuellen Zustand der europäischen Integration in der EU identifiziert werden, was nach eigener Definition eher dem weichen Euroskeptizismus entspräche (Kopecký & Mudde 2002: 300). Der dritte Punkt ihrer Kritik zielt darauf ab, die Autoren würden sich nicht dazu äußern, weshalb es so schwierig sei, die Existenz verschiedener Arten des Euroskeptizismus zu unterscheiden, da die expliziten Kriterien, die zur Unterscheidung zwischen hart und weich verwendet wurden, unklar bleiben. Abschließend bemerken sie, eine Kategorisierung in harten und weichen Euroskeptizismus würde der Unterscheidung zwischen den Ideen der europäischen Integration und der EU als Körperschaft dieser Ideen nicht ausreichend gerecht werden. Folglich sei diese Definition des Begriff Euroskeptizismus fälschlicherweise Parteien und Ideologien zugeschrieben, die sowohl grundsätzlich pro-europäisch als auch gänzlich antieuropäisch eingestellt sein können. Dies könnte in der Folge dazu führen, dass es in parteipolitischen Systemen zu einer Über- aber auch zu einer Unterschätzung der Stärke dieses Phänomens kommt und dementsprechend entweder mehr oder weniger Euroskeptizismus erkennen lässt als tatsächlich vorhanden ist (ebd.).
Читать дальше