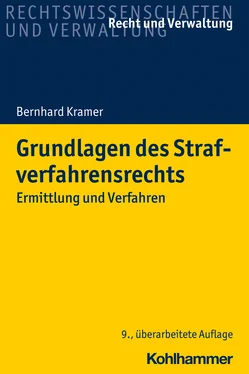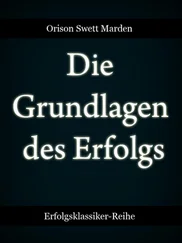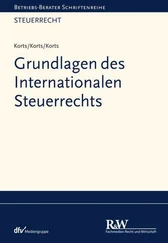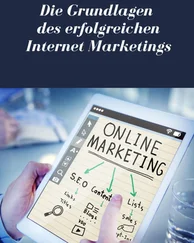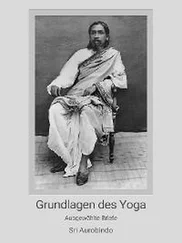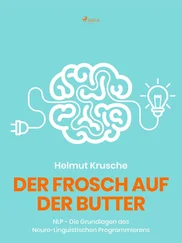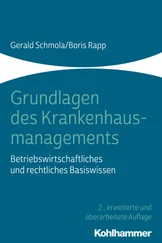Das BVerwG vertritt die Auffassung, die Führung der Kriminalakten sei der Aufgabenstellung der Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr zuzuordnen; sie beruhe auf Polizeirecht, weil die Kriminalakten nicht zur Durchführung des konkret anhängigen Strafverfahrens als Ermittlungsakten dienten 27. Tatsächlich besteht der Hauptzweck der Kriminalakten der Polizei jedoch in der vorsorglichen Bereitstellung eines Hilfsmittels für künftige Fälle der Strafverfolgung. Ihrer bedienen sich die Sachbearbeiter der Polizei, wenn erneut Verfahren gegen denselben Beschuldigten anhängig werden, um sich über dessen Person, Lebensgewohnheiten und Kontakte zu informieren oder um Verdächtige bei noch unaufgeklärten Straftaten aufgrund ihrer Vorgehensweise festzustellen und so Ermittlungsanhalte zu gewinnen. Das BVerwG ist über die Polizeipraxis schlecht unterrichtet, wenn es glaubt, die Kriminalakten würden vornehmlich zur Gefahrenvorsorge herangezogen. Dies mag im Einzelfall einmal vorkommen (z. B. zur Eigensicherung des Beamten), ist jedoch nur ein Nebenprodukt ihrer eigentlichen Zweckbestimmung als Hilfsmittel in künftigen Strafverfahren 28. Damit gehört die Kriminalaktenführung zwar zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, jedoch auf dem Sektor der Strafrechtspflege i. S. v. § 23 EGGVG. Eine Klage auf Auskunfterteilung aus den Kriminalakten ist daher nicht auf polizeirechtliche Bestimmungen zu stützen und vor dem Verwaltungsgericht unzulässig 29.
4Das Strafverfahrensrecht bezieht sich grundsätzlich nur auf die Ahndung von Straftaten, während die Verfolgung von Bußgeldtatbeständen im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) geregelt ist 30. Jedoch finden über § 46 OWiG die Vorschriften über das Strafverfahren weitgehend entsprechende Anwendung. Ausgenommen sind davon verschiedene Zwangsmaßnahmen wie z. B. Anstaltsunterbringung, Verhaftung und vorläufige Festnahme, Beschlagnahme von Postsendungen sowie körperliche Eingriffe mit gewissen Einschränkungen (§ 46 Abs. 3 OWiG). Im Bußgeldverfahren besitzt die zuständige Verwaltungsstelle als Verfolgungsbehörde dieselben Rechte und Pflichten wie die StA bei der Verfolgung von Straftaten (§ 46 Abs. 2 OWiG). Ein grundlegender Unterschied zwischen der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und der von Straftaten liegt indes darin, dass nur bei der Strafverfolgung das Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2) gilt, während das Bußgeldrecht schon bei der Einleitung des Verfahrens, erst recht dessen weiterer Durchführung dem Opportunitätsprinzip unterliegt (§ 47 OWiG). Allerdings sieht die Praxis anders aus: während bei der Verfolgung der Bagatellkriminalität und mittlerer Vergehen die StA in großem Umfang die Ausnahmevorschriften des Opportunitätsprinzips (§§ 153 ff.) anzuwenden pflegt, verfolgen die Bußgeldbehörden – jedenfalls bei Verkehrsordnungswidrigkeiten – regelmäßig, ohne von dem ihnen nach § 47 OWiG eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen; womit das Wertungsgefälle von Kriminalunrecht und Bußgeldrecht auf den Kopf gestellt wird.
II.Rechtsquellen des Strafverfahrensrechts
5Die Beamten eines Funkstreifenwagens der Polizei bemühen sich um die Befriedung einer Wirtshausstreitigkeit. Der daran beteiligte B. beschimpft sie als „Bullen“ und tritt vor Wut eine Beule in den Kotflügel des Funkstreifenwagens. Der Polizeipräsident stellt daraufhin Strafantrag wegen Sachbeschädigung und Beleidigung gegen B. bei der StA. Staatsanwalt S. erkennt, dass B. bisher unbestraft ist und sich zur Zeit des Geschehens wegen ehelicher und beruflicher Probleme in einer Ausnahmesituation befunden hat. S. stellt das Verfahren nach § 153 wegen geringer Schuld und fehlendem öffentlichen Interesses ein, ohne dem Polizeipräsidenten vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Als der Polizeipräsident davon erfährt, beschwert er sich beim Vorgesetzten des S. mit der Behauptung, die Einstellung sei wegen Verstoßes gegen Nr. 93 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) rechtswidrig.
Die Einstellung wäre dann rechtswidrig, wenn sie anwendbaren Rechtsvorschriften (Rechtsnormen) widerspräche. Es fragt sich daher, welches die Rechtsquellen des Strafverfahrensrechts sind, aus denen sich die Rechtslage ergibt.
6Primäre Rechtsquelle des Strafverfahrensrechts ist die Strafprozessordnung (StPO) in der Bekanntmachung vom 7.4.1987 31. Hinzugekommen sind seit 1987 zahlreiche bedeutsame Veränderungen einzelner Vorschriften, wozu gehören: das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15.7.1992 32, das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994 33, das Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 (StVÄG 99) vom 2.8.2000 34, das 1. Justizmodernisierungsgesetz vom 24.8.2004, das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen vom 21.12.2007 35, das Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts vom 29.7.2009 36, die Gesetze zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren 37und zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom selben Tag 38sowie zuletzt die Gesetze zur Modernisierung des Strafverfahrens und zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung vom 12.12.2019. Die modernen gesetzgeberischen Tendenzen sind charakterisiert durch eine ständige Aufweichung des Legalitätsprinzips 39, Schaffung zahlreicher neuartiger Einzelbestimmungen zur Regelung kriminalistischer Vorgehensweisen (z. T. unter Berufung auf Vorgaben des BVerfG im Volkszählungsurteil 40), Erweiterung verdeckter Ermittlungsmethoden, Ausbau des strafprozessualen Opferschutzes sowie – dies allerdings noch eher in Rechtsprechung und Lehre – einer eigenartig schleichenden Anpassung an Vorstellungen des angelsächsischen Rechtskreises, wie die Stichworte „deal“ (Verständigung, Absprache), Kronzeuge, Beweisverwertungsverbote („fruits of the poisinous tree“-Doktrin, Miranda 41) erkennen lassen. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung in Richtung des amerikanischen Parteiprozesses in Strafsachen, welche sich in einem veränderten Rollenverständnis von Staatsanwälten niederschlägt.
7Gleichwohl ist die Grundstruktur der RStPO vom 1.2.1877 (am 1.10.1879 in Kraft getreten) bisher erhalten geblieben, obwohl es im politischen Raum nicht an Stimmen fehlt, die einen radikalen Umbau fordern. Die StPO hat bereits zahlreiche Verfassungslagen in Deutschland überdauert; ausgerechnet das Strafverfahren als „Seismograph der Staatsverfassung“ zu bezeichnen 42, trifft daher nur bedingt zu. Selbstverständlich aber ist, dass Novellierungen der StPO den jeweiligen Zeitgeist reflektieren und dass das Grundgesetz als höherrangiges Recht intensiv in das Strafverfahren hineinwirkt. Die StPO enthält demnach im Wesentlichen vorkonstitutionelles Recht 43. Obwohl etwas ungenau als Strafprozess-„Ordnung“ bezeichnet, stellt sie ein formelles Gesetz dar. Sie ist das Ergebnis einer viele Jahrhunderte währenden Rechtsentwicklung, die im Ausgangspunkt (Gerichtsentscheidung durch die Volksversammlung, sog. Thing) keinen Unterschied zwischen Straf- und Zivilprozess machte. Rudiment dieses Parteiverfahrens ist die Privatklage in §§ 374 ff. Im ausgehenden 15. Jahrhundert setzte in Deutschland die Rezeption des mittelalterlich-italienischen Rechts ein; diese fand ihren Niederschlag in der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. ( Constitutio Criminalis Carolina von 1532). Das Privatklageverfahren trat nunmehr in den Hintergrund; Strafverfolgung wurde mehr und mehr als Aufgabe staatlicher Instanzen erkannt. Offizialprinzip (d. h. das Strafverfahren wird von Amts wegen eingeleitet und betrieben) und Instruktionsmaxime (Sachverhaltsaufklärung von Amts wegen ohne Bindung an Anträge) sind inzwischen die StPO beherrschende Grundsätze geworden. Demgegenüber hat die StPO radikal mit dem Beweisrecht der Constitutio Criminalis Carolina und des auf ihr beruhenden gemeinrechtlichen deutschen Strafprozessrechts gebrochen: galten dort formale Beweisregeln (z. B. Beweis nur durch zwei einwandfreie Zeugen oder Geständnis), herrscht nunmehr nach § 261 der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Die StPO beruht vor allem auf dem Gedankengut der Aufklärung, die sich für die Abschaffung des Inquisitionsprozesses aussprach, den die Folter und die Identität von Ankläger und Richter kennzeichneten. Französischen Vorbildern folgend überträgt sie die Aufgabe der Strafverfolgung bis zur Anklageerhebung und dann die der Urteilsfindung zwei unabhängigen staatlichen Funktionsträgern, nämlich der Staatsanwaltschaft (StA) und dem Gericht, so dass nach §§ 155, 264 Gegenstand der gerichtlichen Urteilsfindung nur die in der Anklage der StA bezeichnete Tat sein kann (Akkusationsprinzip) 44.
Читать дальше