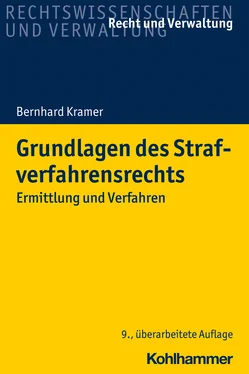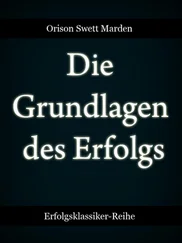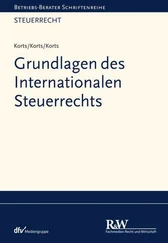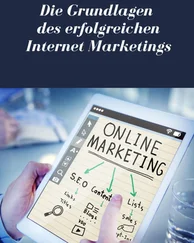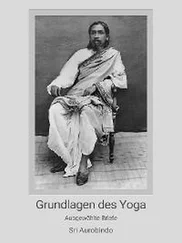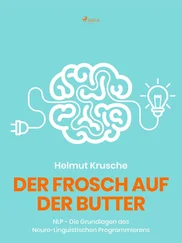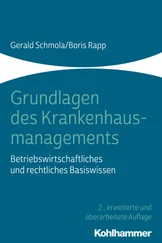H. hat die Tat des B. nicht selbst wahrgenommen. Es ist aber anerkannt, dass der Verfolger nicht unbedingt mit dem Entdecker der Tat identisch sein muss 151. Jedoch müsste die Verfolgung vom ersten Verfolger, der diese auf frischer Tat begonnen hat, abgeleitet werden. Das ist z. B. gegeben, wenn der Entdecker der Tat eine andere Person informiert, diese möge den Täter ergreifen. Im vorliegenden Fall kann H. seine Verfolgungstätigkeit nicht auf den Entdecker der Tat zurückführen. Zwar hat die Polizei in der Fernsehsendung die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Fahndung aufgerufen. Eine individuelle Beauftragung des H. liegt darin jedoch nicht. Darüber hinaus sind auch ersichtlich die zeitliche Komponente und ein ununterbrochener Verfolgungszusammenhang nicht gegeben, wenn eine Fernsehsendung wie „Kriminalreport“ vorbereitet werden musste. Aus den zuvor genannten Gründen greift jedoch für H. der Rechtfertigungsgrund nach § 127 Abs. 1 nicht ein.
58Die hier vorliegende Öffentlichkeitsfahndung zum Zwecke der Festnahme des B., die Gegenstand der Fernsehausstrahlung war, ist nach § 131 Abs. 3 im Rahmen einer Ausschreibung zur Festnahmebei Straftaten von erheblicher Bedeutung zulässig und setzt grundsätzlich einen Haftbefehl voraus, dessen Existenz hier zu unterstellen ist. Das Verbrechen eines schweren Raubs mit Waffen (§ 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB) ist zweifelsfrei als Straftat von erheblicher Bedeutung zu betrachten 152. Bei anderen Straftaten ist dagegen nur die Ausschreibung zur Festnahme gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, aber nicht in der Öffentlichkeit zulässig. Den überkommenen Begriff des Steckbriefs hielt der Gesetzgeber des StVÄG 99 für antiquiert und hat ihn abgeschafft 153. Ausschreibungen zur Festnahme setzen grundsätzlich eine Anordnung des Richters oder des Staatsanwalts voraus; bei Gefahr im Verzug genügt die Ermittlungsperson der StA. Durch das StVÄG 99 ist auch die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlungeines Beschuldigten oder eines Zeugen gesetzlich geregelt worden; § 131a dient daher der Feststellung des Aufenthalts von Personen, ohne dass diese festgenommen werden sollen. Schließlich bildet der neue § 131b die Rechtsgrundlage für die Aufklärungsfahndungund Identitätsfahndung. Danach können Abbildungen eines Beschuldigten – unter engeren Voraussetzungen auch eines Zeugen – zum Zwecke der Aufklärung einer Straftat und zur Feststellung der Identität eines unbekannten Täters veröffentlicht werden. Der letzte Fall ist z. B. gegeben, wenn das Phantombilddes ansonsten unbekannten Täters in den Medien ausgestrahlt wird 154wie im Ausgangsfall.
In Bezug auf den B. liegt eine öffentliche Ausschreibung zur Festnahme gem. § 131 Abs. 3 vor. Diese Vorschrift ist aber nur die Ermächtigungsgrundlage für die Strafverfolgungsbehörden zu den mit einer Fahndung verbundenen Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten. Die Festnahme selbst richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften über den Vollzug eines Haftbefehls oder § 127. Daher ist das Einsperren des B. durch den H. auch nicht aufgrund des § 131 gerechtfertigt. Die Freiheitsberaubung ist damit rechtswidrig. Nur an der Schuld des H. könnte man Zweifel haben, da er irrtümlich meint, er sei aufgrund der öffentlichen Fahndung nach B. zur vorläufigen Festnahme befugt. Er irrt mithin über die rechtliche Auslegung des § 131 oder § 127 Abs. 1. Er befindet sich in einem Verbotsirrtum nach § 17 StGB, der bei Vermeidbarkeit die Schuld unberührt lässt und nur zu einer Strafmilderung führt. In der konkreten Situation hatte H. keine Möglichkeit mehr, Rechtsauskünfte einzuholen. Ob in der Öffentlichkeit allgemein bekannt ist, dass öffentliche Ausschreibungen zur Festnahme Privatpersonen nicht zur Festnahme befugen, kann bezweifelt werden. Letztlich hängt die Frage der Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums und damit der Bestrafung des H. von den subjektiven Gegebenheiten des Einzelfalles ab. Nimmt man Strafbarkeit des H. an, könnte prozessual die Staatsanwaltschaft durch eine Einstellung des Verfahrens nach dem Opportunitätsprinzip (§ 153) die für H. missliche Situation bereinigen.
59Wegen wiederholter Einbrüche in den Keller des von ihm betreuten Hauses hat sich der Hauswart H. in der Nacht hinter einem Busch versteckt und beobachtet das ca. 15 m entfernte Kellerfenster. Als sich eine dunkle Gestalt nähert und in verdächtiger Weise am Kellerfenster zu schaffen macht, schleppt H. die heftig widerstrebende Person ins Haus, wo sich diese bei Licht als der Mieter M. entpuppt, der seinen Kellerschlüssel verloren hatte. M. stellt Strafantrag.
60Wiederum ist zu fragen, ob die tatbestandliche Begehung des § 239 StGB durch H. nach § 127 Abs. 1 gerechtfertigt ist. Die Voraussetzungen des Betreffens auf frischer Tat scheitern nicht an einem fehlenden räumlich-zeitlichen Zusammenhang zum Geschehen. Es kommt jedoch darauf an, was hier unter dem Begriff „Tat“ zu verstehen ist. Dabei ist heftig umstritten, ob es sich um eine wirklich begangene Straftat handeln muss, die zu einer Bestrafung des Festgenommenen führen kann, oder ob es sich nur so aus der Sicht des Festnehmenden darstellen muss. In Teilen des Schrifttums und der Rechtsprechung wird letztere subjektive Sicht vertreten, da das Risiko einer rechtswidrigen Festnahme nicht Privatpersonen aufgebürdet werden solle, die im Interesse staatlicher Strafverfolgung aktiv werden 155. Richtig erscheint jedoch die ebenso stark vertretene gegenteilige Ansicht, es müsse objektiv eine zumindest tatbestandsmäßig und rechtswidrig begangene Straftat vorliegen 156. Die Interessen des unschuldig Festgenommenen verdienen den Vorzug. Jemandem, der sich objektiv auf der Seite des Rechts befindet, kann nicht zugemutet werden, sich einer Festnahme durch eine erkennbar irrende Privatperson zu unterwerfen, z. B. sich durch einen Kaufhausdetektiv abführen zu lassen, nur weil dieser fälschlich annimmt, der Kunde habe gestohlen. Kriminalistisch nicht geschulte Privatpersonen, die sich auf § 127 Abs. 1 stützen, sollten sich bei Verwechslungsgefahr eher größere Zurückhaltung auferlegen. Die Irrtumsproblematik lässt sich angemessen durch das materielle Strafrecht lösen.
Hier lag nicht einmal der Versuch einer Straftat vor, da der Mieter M. nur deshalb den äußeren Anschein eines Einbruchsversuchs vermittelte, weil er seinen Schlüssel verloren hatte. H. handelte nach der hier vertretenen Ansicht rechtswidrig. Jedoch liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum analog § 16 StGB vor, wenn H. tatsächliche Umstände annimmt, bei deren Vorliegen ein Rechtfertigungsgrund nach § 127 Abs. 1 gegeben gewesen wäre. Hätte es sich wirklich um einen Einbruchsversuch gehandelt, wären neben der Voraussetzung der Verfolgung auf frischer Tat auch die sonstigen Tatbestandsmerkmale des § 127 Abs. 1 erfüllt gewesen.
61Zu den weiteren Voraussetzungen des § 127 Abs. 1 gehört, dass der Täter der Flucht verdächtigist. Dies ist gegeben, wenn der Festnehmende damit rechnen muss, dass der Täter fliehen werde 157. Die zweite Tatbestandsalternative des § 127 Abs. 1 besteht darin, dass die Identitätdes Täters nicht sofort festgestelltwerden kann. Hat der Täter keine oder nur unzureichende bzw. überprüfungsbedürftige Ausweispapiere bei sich, kann er festgenommen werden. Da § 127 zur Personenfeststellung selbst nicht mehr ermächtigt, darf der Privatmann diesbezüglich keine weiteren Handlungen vornehmen. Staatsanwälte und Polizeibeamte können sich für die Identifizierung dann auf die Ermächtigungsgrundlage des § 163b Abs. 1 stützen 158. Hätte es sich im Fall tatsächlich um einen Einbrecher gehandelt, so wäre in der konkreten Situation Fluchtverdacht zu bejahen gewesen.
Abb. 5:Belehrung des Beschuldigten bei der Festnahme
Читать дальше