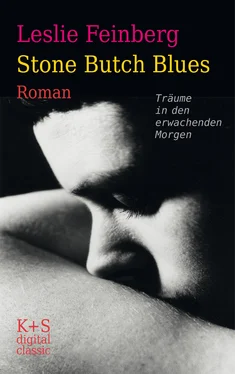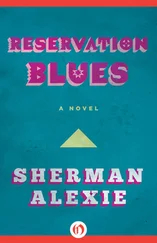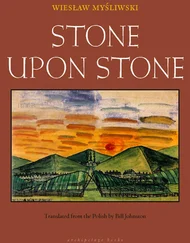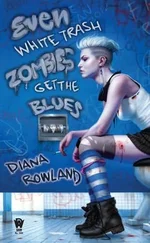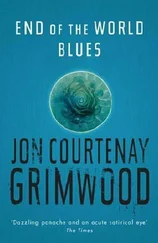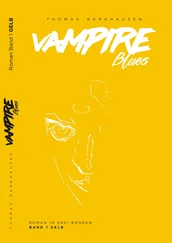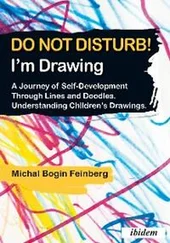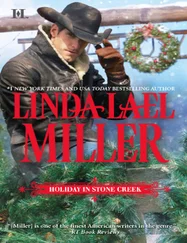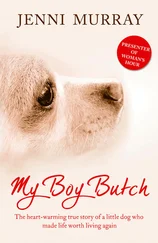„Laß sie in Ruhe!“ brüllte ich.
„Schnauze, du Scheiß-Perverse!“ schrie der Bulle hinter mir und knallte meinen Kopf gegen die Wand. Ich sah ein ganzes Spektrum von Farben.
Ed und ich wandten den Kopf und sahen uns für den Bruchteil einer Sekunde an. Komisch, es schien, als hätten wir viel Zeit, uns zu beraten. Manchmal, hatten mir die alten KVs erzählt, ist es am besten, die Schläge hinzunehmen und zu hoffen, daß du noch einigermaßen am Leben bist, wenn die Bullen mit dir fertig sind. Manchmal aber ist dein Leben unmittelbar in Gefahr oder deine geistige Gesundheit, und dann ist Gegenwehr angesagt. Es ist eine schwere Entscheidung, denn es steht oft auf Messers Schneide.
Mit einem Augenzwinkern beschlossen Ed und ich zu kämpfen. Jede boxte und trat den Bullen, der ihr am nächsten stand. Einen Moment lang sah es ganz gut für uns aus. Ich trat den Bullen vor mir immer wieder gegen das Schienbein. Ed traf den anderen in den Unterleib und schlug ihn mit beiden Fäusten auf den Kopf.
Als der eine Bulle ausholte und zuschlug, traf mich die Spitze seines Schlagstocks genau auf den Solar plexus. Ich krachte gegen die Wand und bekam keine Luft mehr. Dann hörte ich einen ekelhaft dumpfen Schlag, als ein Schlagstock auf Eds Schädel niedersauste. Ich mußte kotzen. Die Bullen schlugen uns, bis ich mich durch die Schmerzen hindurch auf einmal fragte, ob die Anstrengung sie nicht ermüdete. Plötzlich hörten wir Rufe in der Nähe.
„Los, komm!“ rief der eine Bulle dem anderen zu.
Ed und ich lagen reglos am Boden. Ich sah, wie der Bulle, der über mir stand, ausholte, um zuzutreten. „Du verfluchte Verräterin!“ zischte er, und sein Stiefel krachte mir zur Bekräftigung in die Rippen.
Das nächste, an das ich mich erinnerte, war die Morgendämmerung, die den Himmel am Ende der Gasse erhellte. Das Straßenpflaster an meiner Wange war kalt und hart. Ed lag neben mir, das Gesicht abgewandt. Ich streckte die Hand aus, um sie zu berühren, aber ich reichte nicht ran. Meine Hand fiel in eine Blutlache an ihrem Kopf.
„Ed“, flüsterte ich. „Ed, bitte, wach auf. O Gott, bitte sei nicht tot!“
„Was?“ stöhnte sie.
„Wir müssen hier weg, Ed.“
„Okay“, sagte sie. „Du holst das Auto.“
„Bring mich nicht zum Lachen“, sagte ich. „Ich kriege kaum Luft.“ Ich verlor wieder das Bewußtsein.
Darlene erzählte uns später, daß uns eine Familie auf dem Weg zur Kirche gefunden hatte. Sie holten ein paar Leute, die ihnen halfen, uns zu sich nach Hause zu schaffen. Sie brachten uns nicht ins Krankenhaus, weil sie nicht wußten, ob wir vielleicht Ärger mit dem Gesetz hatten. Als Ed zu sich kam, gab sie ihnen Darlenes Telefonnummer. Darlene und ihre Freundinnen kamen und holten uns ab. Darlene pflegte uns beide eine Woche lang in ihrer Wohnung, bis Ed und ich wieder klar denken konnten.
„Wo ist Ed? Wie geht’s ihr?“ war das erste, was ich Darlene fragte.
„Das ist auch das erste, was sie mich gefragt hat – wie es dir geht“, antwortete Darlene. „Sie lebt. Ihr lebt beide, ihr blöden Arschlöcher.“
Keine von uns beiden wollte zum Notarzt, weil wir Angst hatten, sie würden die Bullen anrufen, um rauszukriegen, ob wir was ausgefressen hatten. Als Ed und ich aufstehen konnten, hockten wir tagsüber, wenn Darlene schlief, im Wohnzimmer. Das Sofa diente uns als Bett.
Ed gab mir The Ballot and the Bullet von Malcolm X. Sie ermunterte mich, Autoren wie W.E.B. DuBois und James Baldwin zu lesen. Wir hatten allerdings beide solche Kopfschmerzen, daß wir kaum Zeitung lesen konnten. Wir lagen oft stundenlang nebeneinander und sahen fern: Mini Max oder die unglaublichen Abenteuer des Maxwell Smart, Die Hillbilly Bären, Green Acres . Wir wurden trotzdem gesund.
Ed bekam Krankengeld. Ich verlor meinen Job als Druckerin.
Als Ed und ich schließlich einen Monat später wieder im Malibou auftauchten, zog jemand den Stecker der Jukebox raus, und alle stürzten auf uns zu, um uns in die Arme zu schließen. „Nun mal sachte, wartet mal“, riefen wir und wichen zurück. „Seht ihr die Ähnlichkeit?“ fragte ich, während Ed und ich unsere Gesichter nebeneinander hielten. Wir hatten beide die gleiche Narbe über der rechten Augenbraue.
Was mich betrifft, ich hatte nach dieser Schlägerei eine Menge Selbstvertrauen verloren. Die Schmerzen in meinem Brustkorb erinnerten mich bei jedem Atemzug daran, wie verwundbar ich in Wirklichkeit war.
Ich setzte mich an einen der hinteren Tische und sah meinen Freundinnen beim Tanzen zu. Es war schön, wieder bei ihnen zu sein. Peaches setzte sich neben mich, schlang mir den Arm um die Schultern und pflanzte mir einen langen, zärtlichen Kuß auf die Wange.
Cookie bot mir einen Job als Rausschmeißerin an. Ich hielt mir die Rippen und verzog das Gesicht. Sie sagte, wenn ich wollte, könnte ich die Bedienung machen, bis ich wieder gesund war. Das Geld konnte ich weiß Gott gebrauchen.
Ich sah, wie Justine, eine umwerfende Tunte, mit einer leeren Kaffeedose von Tisch zu Tisch ging und Geld sammelte. Schließlich kam sie an den Tisch, an dem Peaches und ich saßen, und fing an, die Scheine zu zählen. „Du mußt nichts geben, Darlin’.“
„Wofür ist es denn?“ fragte ich.
„Für deinen neuen Anzug“, antwortete sie und zählte weiter.
„Wessen neuen Anzug?“
„Deinen, Schätzchen. Du kannst ja wohl kaum erwarten, daß du in diesem verlotterten Aufzug als Zeremonienmeister der Monte Carlo Night Drag Show Extravaganza auftrittst, oder?“
Ich kapierte gar nichts.
„Wir gehen mit dir einen neuen Anzug kaufen“, erklärte mir Peaches. „Du leitest nächsten Monat die Drag Show.“
„Das hab ich ihr doch grade erklärt“, meinte Justine ungeduldig.
„Aber ich weiß überhaupt nicht, wie man so was macht …“
„Keine Sorge, Schätzchen“, lachte Justine. „Du bist ja nicht der Star.“
Peaches warf den Kopf zurück. „Das sind wir!“
„Aber du wirst göttlich aussehen“, sagte Justine und winkte mit einem Packen Banknoten.
Ich hatte Horrorgeschichten darüber gehört, wie Butches in Begleitung ihrer Femmes versuchten, bei Kleinhan’s einen Anzug zu kaufen. Aber diesmal war das Unbehagen auf Kleinhan’s Seite, als drei mächtige Fummeltrinen in großer Aufmachung mir halfen, einen Anzug auszusuchen.
„Nein.“ Justine schüttelte entschieden den Kopf. „Sie ist Zeremonienmeister, kein Bestattungsunternehmer.“
„Erdfarben.“ Georgetta faßte mein Kinn und drehte meinen Kopf. „Wegen ihrer Farben.“
„Nein, nein, nein“, sagte Peaches, „der hier ist es.“ Sie hielt einen dunkelblauen Gabardine-Anzug hoch.
„Ja“, seufzte Justine, als ich aus der Umkleidekabine kam. „Ja!“
„Hach, Schätzchen, ich könnte dir verfallen!“ rief Georgetta aus.
Peaches fummelte an meinem Revers herum. „Ja, ja, ja.“
„Den nehmen wir“, sagte Georgetta zum Verkäufer, der sichtlich entnervt war. „Passen Sie die Länge an. Und daß er auch schön sitzt!“
Der Verkäufer zog das Maßband von seinem Hals und versuchte, die Hose und das Jackett abzukreiden, ohne mich dabei zu berühren. Schließlich erhob er sich. „Sie können ihn in einer Woche abholen“, verkündete er.
„Wir können ihn heute abholen“, erklärte Georgetta. „Wir schauen uns einfach hier im Laden um und probieren Sachen an, bis er fertig ist.“
„Nein!“ stieß der Verkäufer hervor. „Kommen Sie in zwei Stunden wieder. Aber gehen Sie jetzt. Gehen Sie!“
„Wir sind in einer Stunde wieder da, Darlin’“, sagte Justine über die Schulter.
„Bis dann.“ Georgetta warf ihm eine Kußhand zu.
„Komm schon.“ Peaches winkte mir, ihr zu folgen. „Jetzt sind wir dran.“ Sie bugsierten mich zum Laden nebenan. Wir gingen in die Miederwarenabteilung.
Читать дальше