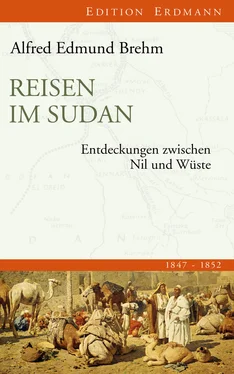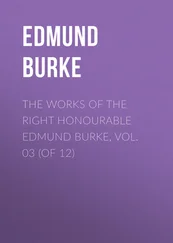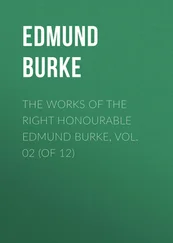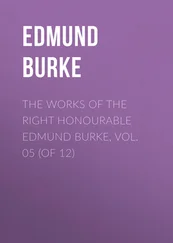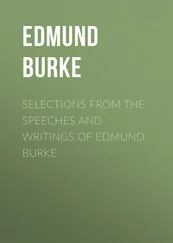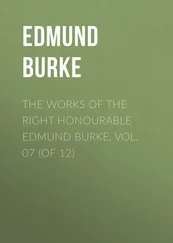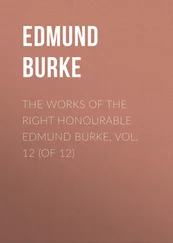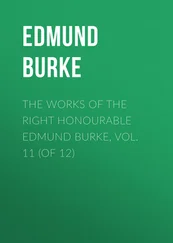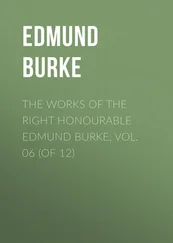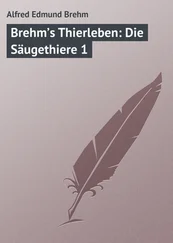Nach kurzer Besichtigung der Altertümer bei Luksor und Karnak schickten wir uns zur Weiterreise an. Da erschienen, in leichte Gewänder gehüllt, drei jener öffentlichen Tänzerinnen »Rhauasïe« – von den Reisenden oft »Almeh« *genannt – und begannen beim Klang ihrer Kastagnetten, eines Tamburins und einer zweisaitigen Violine, die ein alter blinder Kerl bearbeitete, ihre sinnlichen maurischen Tänze aufzuführen. Wir weltliches Personal hätten gern den reizenden Tänzerinnen zugeschaut; die geistlichen Herren aber, vielleicht mit Ausnahme des Bischofs, fürchteten die Versuchung und jagten sie unbarmherzig fort.
Es wurde uns erzählt, dass die Rhauasïaht *hier in der Verbannung leben. Sie übten ihre Künste früher in der Khahira und in Alexandrien aus, trieben es aber dem alten Mohammed-Ali zuletzt doch zu bunt. Plötzlich erzürnt, unterbrach er ihr fröhliches Leben durch den strengen Befehl, nach Oberägypten auszuwandern, und ließ die Säumigen durch Soldaten nach mehreren Städtchen transportieren. Hier führen sie ein höchst unregelmäßiges Leben und werden dem Reisenden durch ihre Zudringlichkeit oft lästig. Man findet unter ihnen sehr schöne Mädchen; gewöhnlich aber sind sie durch Ausschweifungen aller Art, hauptsächlich auch durch Trunksucht, so herabgekommen, dass sie Ekel und Mitleid erregen. Die mit ihnen aufgeführten Orgien und Bacchanalien nennen die Türken »Fanthasïe« **; auf ihre Tänze werde ich zurückkommen.
Wenn die Rhauasïe jung, hübsch und reich gekleidet ist und ihre leidenschaftlichen Tänze gut zu produzieren versteht, ist der Ausdruck Fanthasïe auch in seiner ursprünglichen Bedeutung gerechtfertigt. Ihr Erscheinen schon ist phantastisch. Aber leider verblühen ihre Reize bald, und wenn sie dann Männerherzen zu fesseln nicht mehr fähig ist, sinkt sie gar schnell in die Nacht der Vergessenheit. Nur die allerniedrigsten Kupplerdienste erwerben ihr, wenn sie alt wird, einen notdürftigen Geldgewinn, kaum hinreichend, ihr elendes Leben zu fristen. Dieses kontrastiert mit dem Glanz ihres früheren Auftretens so grell, dass wirklich eine mohammedanische Ergebung in das Walten des unabänderlichen Fatums dazugehört, um den Kontrast ertragen zu können.
Eine wegen ihrer Schönheit berühmte Tänzerin namens Safïe (Sophie) war die Geliebte des nachherigen Vizekönigs Abbas-Pascha. 3Sie soll zur Zeit ihrer Blüte so schön gewesen sein, dass Abbas, damals Gouverneur von Kairo, in seinem Harem keine ihr an Reizen ähnliche Frau besaß. Er besuchte heimlich oft die liebliche Tänzerin, überhäufte sie mit Geschenken, verlangte aber von einem öffentlichen Mädchen Treue, die er nie erwarten konnte. Einst fand er sie in den Armen eines schmucken Arabers. Seine Rache war seiner Roheit und Grausamkeit gleich. Er ließ das unglückliche Weib ergreifen und ihren Rücken mit Peitschenhieben zerfleischen. Monate vergingen, ehe ihre Wunden heilten; ihre Blüte war geknickt, ihre Schönheit vernichtet. Ich sah sie später in Esneh, wo sie ein ziemlich großes Haus bewohnte. Sie zeigte noch immer Spuren ihrer früheren Schönheit; doch war ihr kostbarer Anzug damals noch das Schönste an ihr. Eine unheilbare Lahmheit, die Folge der erlittenen qualvollen Strafe, blieb ihr für immer eine Erinnerung an die Liebe und Rachsucht eines Abbas.
Der Wind war uns unausgesetzt günstig. Schon am 13. Oktober erreichten wir das Städtchen Esneh, am 16. Oktober den »Berg der Kette« ( Djebel el Selseli ) – nach anderen »Berg des Erdbebens« (Djebel el Salßali) genannt –, einen engen Strompass: den letzten Damm, durch welchen sich der Nil Bahn brechen musste, ehe er in dem durch ihn hervorgerufenen Schlammland Ägypten seine Fluten still und ruhig dahinsenden konnte. Die Stelle ist merkwürdig, weil man am rechten Ufer großartige Steinbrüche, am gegenüberliegenden Katakomben und kleine Tempelportale der Alten bemerken kann.
Oberhalb des Djebel el Selseli treten die Gebirge wieder in weitem Bogen zurück und das Ackerland Ägyptens zeigt noch einmal seinen Reichtum. Am rechten Ufer liegt auf einem steilen, jetzt mit Sand überschütteten Felskegel Kom-Ombos, ein Doppeltempel der Pharaonen.
Wir fuhren mit der Schnelligkeit eines kleinen Dampfbootes den Strom hinauf. Auf mehreren Sandinseln bemerkten wir die ersten lebenden Krokodile, welche aber unsere Barke nicht einmal auf Büchsenschussweite an sich kommen ließen und langsam ins Wasser krochen. Vor einigen Tagen sahen wir bereits einen dieser Riesensaurier im Fluss schwimmen, aber, wie ich sogleich wahrnahm, leblos. Dennoch sandten die geistlichen Herren ein halbes Dutzend Kugeln nach der Panzerhaut des keinen Schuss mehr verlangenden Tieres ab. Man wunderte sich allgemein über die Ruhe des »schlafenden Ungeheuers« und ich im Stillen mich über Sonntagsjäger und Sonntagsjägerei.
Gegen Abend legten wir in Assuan, der Grenzstadt Ägyptens gegen Nubien hin, neben einer Sklavenbarke an. Schon von Weitem, lange bevor man die hinter Palmen versteckte Stadt gewahrt, sieht man das hoch auf den Bergen des linken Ufers gelegene Grabmal des Heiligen Muhsa, des Schutzpatrons des ersten Katarakts. Im Strom türmen sich schwarzglänzende Granit- und Syenitmassen zusammen und hemmen im Sommer die Schifffahrt. Dann erscheint die Insel Elephantine wie ein lieblicher Garten und mit ihr Assuan. Bei hohem Nilstand kann man zu Schiff direkt bis an die Stadt gelangen, bei niederem Wasser muss man, am rechten Ufer hinfahrend, die Insel umschiffen und mit großer Vorsicht sich zwischen den letzten Felsblöcken der Stromschnelle hindurchwinden. Dann findet man in höchst romantischer Lage zwischen Granitblöcken mit Hieroglyphenbildern ein stilles Ankerplätzchen, zu welchem nur das ferne Tosen des Katarakts dringt, dicht oberhalb der Stadt.
Assuan ist das alte Syene der Griechen. Früher war es wegen der berühmten Steinbrüche der Alten von größerer Ausdehnung und Bedeutung als jetzt, wie man aus Trümmern, welche den vierfachen Raum der heutigen erbärmlichen Stadt bedecken, leicht schließen kann. Die Steinbrüche, aus denen jene Kolosse, Obelisken und Säulen stammen, deren Massenhaftigkeit, Festigkeit und Schönheit man bei allen Tempelruinen Ägyptens zu bewundern Gelegenheit hat, liegen ganz in der Nähe der Stadt in der Wüste. Man sieht noch überall die Spuren der Sprengarbeiten der Alten: kleine, aber tiefe, in gerader Reihe in das Urgestein eingemeißelte Löcher, in denen man eingetriebene Holzkeile durch Übergießen mit Wasser so ausdehnte, dass sie Blöcke von mehreren tausend Zentnern Gewicht vom Felsen ablösten. Das Urgestein ist jene Quarz-, Glimmer- und Feldspat-Verbindung *, welcher man nach ihrem altbekannten Fundort Syene den Namen »Syenit« erteilt hat.
Weniger solide erbaute Festungswerke, Moscheen und Grabmäler aus einer viel späteren Periode, vielleicht noch aus der Zeit der Mamelukkenherrschaft herstammend, nehmen einen großen Raum der jetzigen Wüste ein. Sie liegen in Trümmern und vereinigen sich mit mehreren wilden Partien der Stromschnelle im Hintergrund zu sehr anziehenden Ansichten. Die große Ausdehnung dieser Trümmermassen deutet darauf hin, dass Assuan, der Stapelplatz des ersten Katarakts, früher eine ansehnliche Handelsstadt gewesen sein muss.
Das heutige Assuan verdient den Namen einer Stadt nicht mehr. Es hat nur wenige und schlechte Kaufhallen, in denen man oft weder Käufer noch Verkäufer sieht, und ist der Sitz einer ägyptischen Maut **, weil alle nach dem Sudan gehenden und von daher kommenden Waren hier versteuert werden müssen. Für die Sklaven, welche ja im Orient überall als Ware betrachtet werden, ist die Steuer sehr hoch ***. Wahrscheinlich lagen wegen der Versteuerung ihrer Neger und Negerinnen während unseres Aufenthalts mehrere Sklavenhändler einige Tage hier. Man bot uns ein sehr niedliches Gallamädchen zum Preis von achtzehnhundert Piastern an; Negerknaben und Negermädchen waren viel billiger.
Читать дальше