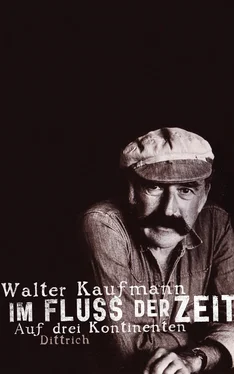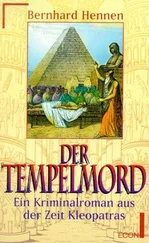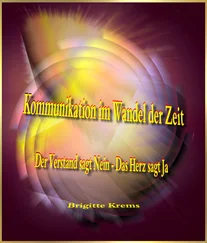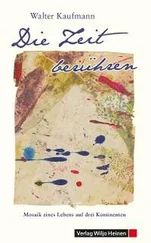Der Mond schwamm hinter Wolken, unendlich fern glitzerten Sterne, im Mangohain aber war es dunkel, der feuchte Boden dämpfte meine Schritte, Frösche quakten, mal schrie schrill ein Vogel, und als ich das Rauschen des Meeres nicht mehr hörte, kehrte ich um und – fand den Weg nicht wieder. Ich hielt inne, wagte weder die eine noch die andere Richtung einzuschlagen, Panik kam in mir auf und die legte sich erst, als ich eine Gestalt wahrnahm, die sich mir näherte. »Talo«, rief ich, »talo, talo.« Es war ein junger Fidschi, der nach meiner Hand griff. Er lachte. Weiß im dunklen Gesicht zeigten sich die Zähne. Willig ließ ich mich führen. Als wir aus dem Mangohain traten, glitt zwischen den Wolken der Mond hervor und warf Licht auf den noch fernen Strand, wo sich die Palmen im Wind wiegten. Laut rauschte die Brandung und bald gelangten wir zu dem Feuer, das ich verlassen hatte. Der junge Fidschi verschwand in der Nacht. Vom Feuer her winkten mir die Männer zu, der Schein des Feuers lag auf ihren Gesichtern. Ich setzte mich wieder zu ihnen, lauschte den Klängen einer Gitarre, die einer anschlug, hörte die Männer und die Frauen singen. Wolken verdeckten wieder den Mond, Schatten fielen, fernab am sichelförmigen Strand leuchteten Feuerzungen auf. Es war angenehm, wo ich saß, die Meereswinde lau. Sie ließen mich teilhaben an ihrem Mahl – geröstete Bananen, frischen Fisch, das Quellwasser, das sie mir reichten, war wie Wein. Dann trank ich von ihrem Kawa, das Getränk berauschte und schärfte zugleich meine Sinne. Es fiel mir jetzt leicht, ihre Gesten, ihr Mienenspiel, ihre Blicke zu deuten, das Lächeln des Mädchens, das Bambusröhrchen mit Garnelen und aus Blättern geformte Kügelchen füllte, die Röhrchen auf die Glut legte und mit einem Stöckchen hin und her bewegte. Sie richtete die Garnelen und Blätter auf einer Holzplatte aus und bot mir davon an. Der alte Mann, der gerade Kawa durch Farnblätter in eine Schale filterte, hielt mir die Schale hin. Und wieder trank ich davon, spürte meine Arme und Beine erschlaffen, ermüdete aber auch jetzt nicht. Überdeutlich sah ich alles um mich her, die Frauen und Männer beim Tanz, auch den jungen Fidschi, der mich aus dem Mangohain gerettet hatte. Er kam auf mich zu, berührte meine Schulter und gab mir einen Walzahn. Den ließ ich in meine Tasche gleiten. Er lachte. »Talo, talo – du mein Freund!« Im Mondlicht sah ich die Fußspuren der Tänzer in der Brandung zerfließen. Neue Spuren formten sich und vergingen. Die Fidschi tanzten bis in die Dämmerung … wer war sie, wie hieß sie, die mir mit hellem Lachen Worte zurief, die ich nicht verstand und doch verstanden habe? Das Mädchen wies auf eine Grashütte, wo wir uns auf einem Lager von Farnen betteten. Sie schlief noch, als ich sie verließ. Das Dorf schlief noch. Ich ging über den Strand zum Meer und schwamm durch die heranrollenden Wellen der Sonne entgegen. Die Brandung trug mich zurück ans Ufer. Weit hinter dem Mangohain hob sich grün die Kette der Hügel gegen den klaren Morgenhimmel ab. Vögel kreisten über dem Hain und der Wind trug mir den Ruf des Hirtenstars zu … 2
Der Traum ist nicht verblasst – aber auch die Erinnerung an ein Hindumädchen nicht, zwölf Jahre jung, das sich in einer Hafenkneipe an einen feisten Schiffskoch verkaufte. Unvergessen auch, dass ein Fidschi über die Reling eines Frachters ins Meer sprang, um sein Dorf zu erreichen, das er aus der Ferne sah, und wie er dann von einem Hai in die Tiefe gerissen wurde … und dass die Inder auf Fidschi für wenig Geld hart schuften mussten und die Polizei mit Wasserwerfern und Gummiknüppeln anrückte, als sie in den Fabriken und auf den Zuckerrohrplantagen zu streiken wagten …
Doch all dem zum Trotz, die Tage und Nächte in den Dörfern der Fidschis, jene kurze Spanne Zeit, die ich zur Crew der Fiona gehörte, wird mir für immer als eine gute Zeit in Erinnerung bleiben. Und weil sie Vertrauen in Mick Moran, ihren Obmann hatten, Vertrauen auch in Männer wie Bill Bird, wuchs auch ihr Vertrauen in mich, den Bücherschreiber, der an Bord aufgetaucht war und dort seine Arbeit wie jeder andere tat und bei Lagebesprechungen Sinnvolles beizutragen wusste – was schließlich bewirkte, dass sie mich gegen Ende der Fidschi-Reise nach Warschau zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten delegierten, wo ich sie vertreten und Berichte für ihre Zeitung Seamen’s Union Journal schreiben sollte. Und das wiederum war mir schon deswegen recht, weil ich nie hatte verwinden können, bei Kriegsende den Dolmetscherposten in einer australischen Armeeeinheit ausgeschlagen zu haben, die auf dem Weg nach Europa gewesen war. Europe, here I come at last …
Am Morgen dieses Sonntags im November 2008 hatte ich zum siebzigsten Jahrestag der Nazi-Pogrome auf einer Straßenkundgebung in Moabit einer großen Schar von Zuhörern die Zerstörung meines Duisburger Elternhauses und die Verhaftung meines Vaters geschildert, und wie mich noch kurz vor Kriegsende die Nachricht erreichte, dass beide Eltern nach Theresienstadt verschleppt worden waren – in die Vorhölle von Auschwitz, wo sie ermordet wurden. Am Abend dieses Tages hatte ich mich im stillgelegten Flughafengebäude von Tempelhof eingefunden, wo bei einer Benefizveranstaltung der – wie die öffentliche Erklärung lautete – Reichskristallnacht gedacht werden sollte. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Tu was! und man hatte Hélène Grimaud, Menahem Pressler, Thomas Quasthoff und weitere namhafte Künstler dafür gewinnen können. Mir war ein Ehrenplatz zugedacht worden und gleich anfangs bewegte mich das von Hélène Grimaud gestaltete Bach’sche Chaconne – es hätte mir als abendfüllend ausgereicht – natürlich blieb ich, und so erlebte ich neben vielem, wie der greise israelische Pianist Menachem Pressler im Anschluss an seine Beethoven-Interpretationen die deutsche Sprache und die deutschen Tonschöpfer zu loben begann, was ihm, zumal ihm kein Wort der Anklage über die Lippen kam, viel guten Willen einbrachte. Als nach nahezu zwei Stunden die Feierlichkeit zu Ende ging, drängte sich aus den vorderen Reihen die geladene Prominenz die Treppe hoch zu einem kulinarischen Gelage, das geradezu geschaffen war, den Anlass des Abends vergessen zu lassen …
Nachdenklich verließ ich spätnachts das Flughafengebäude und erlebte in der U-Bahn, dass sich aus einer Schar von Glatzköpfigen einer löste, der sich laut über die Zeitung mokierte, die ich unterm Arm trug – die Jüdische Zeitung , auf deren Seite 18 ein Beitrag über mich und meine Bücher zu lesen stand. Ehe ich in Stadtmitte die U-Bahn wechselte, schob ich die Zeitung in meine Manteltasche … wobei mir urplötzlich die Erinnerung kam, dass ich als Zwölfjähriger so vorsichtig nicht gewesen war, als ich zwei SS-Offizieren als Erstes kundgetan hatte, dass ich jüdisch sei – ich war von der zum Halt ausrollenden Straßenbahn gestürzt und hatte mir das Knie verletzt und sie hatten ihren Mercedes angehalten, um mich zu verarzten und sich davon nicht abbringen lassen. »Pflicht ist Pflicht!«, hatten sie mir erklärt und nach geleisteter Hilfe darauf bestanden, mich nach Hause zu fahren. Den entsetzten Ausdruck meiner Mutter sollte ich mein Lebtag nicht vergessen – ihr Sohn in einem schwarzen Mercedes mit SS-Standarte … »Heil Hitler – hier haben Sie Ihren Bengel wieder!« Unter Tränen hatte sie gefragt, was ich denn angestellt hätte, worauf sie ihr geantwortet hatten: »Merken Sie sich eins – Deutsche können zwar hart sein, aber immer gerecht.« Dann waren sie weggefahren, und Mutter und ich hatten uns in den Armen gelegen – so wie ein Jahr später, als ich längst den harten Wind der Zeit zu spüren bekommen hatte. Schilder mit Juden unerwünscht! prangten da schon überall in der Stadt – vor Kaufhäusern, vor den Kinos, am Stadttheater, vor den Eingängen zum Fußballstadion und zur Rennbahn in Raffelberg. Selbst Parkbänke waren uns verboten. Zwar war ich auch weiterhin Sonntag morgens zu Naturfilmen im Mercator Palast gegangen, hatte es sogar gewagt, Karten für die Wagner-Opern Lohengrin und Meistersinger zu kaufen, die ich dann weit oben im vierten Rang erlebte, und ich war auch nach Köln zum Zirkus Sarasani gereist, um dort die Wassernixen im Riesenaquarium zu bewundern. Und doch, wirkungslos waren die Verbotsschilder nicht geblieben, und schon gar nicht die Zeitungskästen des Stürmer mit all den Fratzen und der in jeder Ausgabe wiederholten Behauptung Die Juden sind unser Unglück . All das hatte mich zunehmend aufsässiger gemacht, sogar gegen die eigene Mutter. Und als ich dann bei meiner Bar-Mizwa in der Synagoge aufgerufen wurde, einen Abschnitt aus der Thora vorzutragen, den ich mir mühsam Wort für Wort auf Hebräisch hatte einprägen müssen, ich anschließend in der feierlichen Stille zur Kanzel hochstieg, um den Segen zu empfangen und den Rabbiner raunen hörte: »Sei lieb zu deiner Mutter, mein Sohn«, beschämte mich das derart, dass ich mich abrupt abwandte und quer durch die Synagoge zur Treppe lief, die nach oben zu den Frauen führte. Die Orgel hatte zu spielen begonnen, doch das hörte ich nur noch wie von weiter Ferne, während ich der Mutter wieder und wieder versicherte, dass ich nie, nie … den Rest meiner Worte erstickte sie in der Umarmung.
Читать дальше