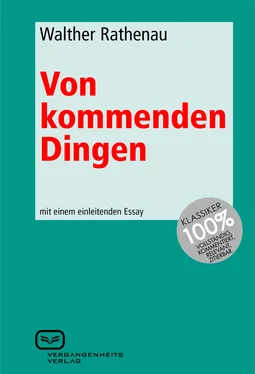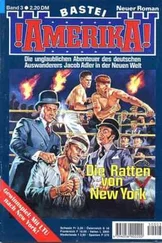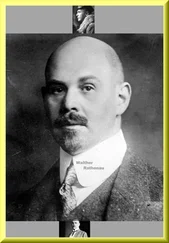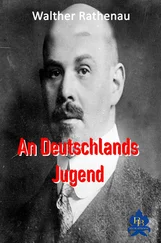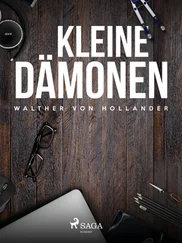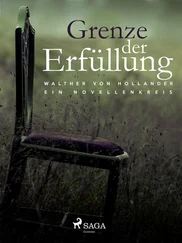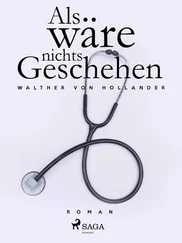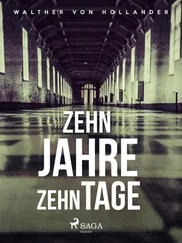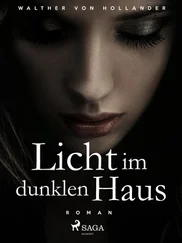[40]Dieser Zustand des mechanisierten Geistes aber ist nichts andres als der zum Großstadttaumel aufgepeitschte Urzustand der niedern Rassen, das Furcht- und Zweckwesen derer, die in ihrem Aufschwung das Zeitalter geschaffen haben. Mehr als ein Atavismus: ein Niedersinken aller, die den Trank genießen, in die Tiefe der Dunklen, die ihn brauten. So sind sie auf dem Zenit der Zivilisation verdammt, das Leben, die Stimmung, die Angst und die Freuden zu erleben, die ihre Vorderen den Sklaven gönnten.
Diese Stimmung aber ist Streben und Verblendung. Streben, dem kein Ziel genügt und das doch so irrational ist, daß es zuletzt die Arbeit zum Selbstzweck macht, und so erdgebannt, daß es alles, was gleißt, vom Wege aufliest und, mit der toten Fracht der Mittel belastet, sich zum Grabe schleppt; Verblendung, der keine Tatsache real genug, kein Wissen zu nebensächlich ist, und die doch jede Vertiefung scheut, die Welt entfleischt und entgeistert, den sterblichen Sinn ertötet und den unsterblichen verschmäht.
Die Freuden sind die der Kinder, Sklaven und niedern Frauen: Besitz, der glänzt und Neid schafft, Unterhaltung und Sinnenrausch. Die Besitzfreude steigert sich zum irrsinnigen Warenhunger, der sich selbst vertausendfacht, indem Übersättigung und Mode alljährlich die Schatzkammern entwerten und leeren müssen, um sie mit neuem Unrat und Tand zu füllen. Tief erniedrigend und entwürdigend sind die Freuden der Großstadt und der Gesellschaft, die in unbewußter Ironie sich die bessere nennt. Verläßt ein denkender Mensch und Menschenfreund die Stätten, an denen dieses Volk sich [41]vergnügt oder, wie es mit dem gemeinsten Wort vulgärer Sprache es bezeichnet, sich amüsiert; verläßt er diese Orte, ohne auch nur einen Augenblick an der Zukunft der Menschheit zu zweifeln, so hat er die stärkste Prüfung seiner Weltzuversicht überstanden. Rausch, Lust und Verbrechen strömt aus Giften und Reizmitteln, die an Aufwand das Dreifache fordern von dem, was die Welt für alle Aufgaben ihrer Kultur zusammenträgt.
2. Mechanisierung ist Zwangsorganisation, deshalb verkümmert sie die menschliche Freiheit.
Der einzelne findet das Maß seiner Arbeit und Muße nicht mehr im Bedürfnis seines Lebens, sondern in einer Norm, die außer ihm steht, der Konkurrenz. Es genügt nicht, daß er nach dem Ausmaß seiner Kräfte und Wünsche schafft, er wird geschätzt nach dem, was der andre, die andren schaffen; halbe oder langsame Arbeit ist wertlos, sie gilt nicht besser als Müßiggang. Die Weltarbeit vom Feldherrn bis zum Postboten, vom Tagelöhner bis zum Finanzmann steht unter dem Druck des Akkord- und Rekordsystems; von jedem wird so viel verlangt, als der andre leistet. Der alte Handwerker ergänzte sein Schaffen durch Liebe und Verschönerung; die Mechanisierung produziert unter dem Sinnbild der Submission: ein Minimum an Güte und Menge wird vorgeschrieben, der geringste Preis ist recht, und Liebe wird nicht bezahlt. Die Grenze der Anspannung bietet der Kampf der Gruppen, aufwärts bis dem der Nationen, und auch der entscheidet sich nach objektiven Kräftesummen, ohne Einfluß des einzelnen.
Selbst in der Richtung und Fassung seiner Werktätigkeit ist der Mensch nicht frei. Mag er zur [42]Einseitigkeit oder zur Vielfältigkeit bestimmt sein die mechanistische Ordnung benutzt ihn zur Spezialisierung. Willig fügt sich das Geschlecht dem Zwang, es erzeugt den geborenen Handelsreisende und Schullehrer, wie es den geborenen Betriebsingenieur und Insektenforscher erzeugt; noch mehr es liefert die Typen in der Zahl und Auswahl, wie Bedürfnis und Überfüllung sie vorschreibt. Rückfall wird bestraft; entsteht noch dann und wann ein Mensch vom alten Schlage der Krieger, Abenteurer, Handwerker, Propheten, so wird er aus der gemeinsamen Anstalt ausgeschlossen und verfemt oder zum niedersten undifferenzierten Dienst entwürdigt.
Der Zwang geht weiter. Auch die Selbstverantwortung wird dem Menschen genommen. Denn das organisatorische Wesen der Mechanisierung beruhigt sich nicht, bevor jeder ihrer Teile, jede ihrer Summen wiederum zum Organismus geworden ist; in gleicher Lückenlosigkeit, wie jedes noch so kleine und noch so große Element der lebenden Natur sich als Organon darstellt. Genossenschaften, Vereinigungen, Firmen, Gesellschaften, Verbände, Bureaukratie, berufliche, staatliche, kirchliche Organisationen binden und trennen die Menschheit in unübersehbarer Verflechtung; niemand ist für sich, jeder ist unterworfen, andern verantwortlich. Dieser Zustand, erhebend in der Großartigkeit der Konzeption und in der naturgewaltigen Tröstlichkeit eines nicht mehr menschengeschaffenen Schicksals, wird zum öden Dienst in jenen gewaltigen, unbewußt dämmernden Regionen, in denen nicht selbstbewußte Verantwortung, sondern unterworfenes Interesse waltete. Auch der zünftige [43]Handwerker war abhängig, doch nicht im gleichen Sinne wie der Angestellte des Warenhauses; seine Gebundenheit war sichtbar, eindeutig und dennoch von innerer Freiheit erfüllt. Ein Blendwerk äußerer Freiheit bedeckt die mechanistische Bindung: der Unzufriedene kann Rücksicht auf Form verlangen, auftrumpfen, die Arbeit niederlegen, wegziehen, auswandern: und doch befindet er sich nach Wochen bei veränderten Namen, Personen und Ortschaften im gleichen Verhältnis. Die Anonymität der Unfreiheit vollbringt durch ihren Zauber, was den alten Despotien und Oligarchien mit ihren Häschern und Spähern nicht gelang: die Abhängigkeit zu verewigen.
Der Einzelzwang aber ist ein geringes Übel, verglichen mit der Massenerscheinung, die ihn überdeckt. Die Mechanisierung als Massenorganisation bedarf der Menschenkraft nicht einzeln, sondern in Strömen. Die Pyramidenmannschaft der Pharaonen genügt nicht, um den Tagesbedarf eines Landes auch nur an Werkzeugen zu decken; die Heeresmacht Napoleons reicht nicht zu für die Besatzung eines Bergwerksbezirks. Völkerschaften müssen bereitstehen, um sich zu wechselnden Heeresströmen beständig neu zu ordnen, millionenfache Maschinenpferde verlangen millionenfaches Zentaurenvolk. Nicht innere Notwendigkeit des Mechanisierungsprinzips, sondern bequem gebilligte Begleitumstände der Entwicklung haben die an sich unvermeidliche Arbeitsteilung zwischen geistiger und körperlicher Leistung zur ewigen und erblichen gemacht und so in jedem zivilisierten Lande zwei Völker geschaffen, die blutsverwandt und dennoch ewig getrennt, im gleichen Verhältnis [44]wie ehedem die stammesfremden Ober- und Unterschichten, einander gegenüberstehen. Beide sondert und beherrscht der Zwang. Ohne Verlust bürgerlichen Ranges und Bewußtseins, ohne Verzicht auf gewohnten Umgang, Güter des Genusses und der Kultur steigt kein Oberer hinab, ohne den Zufall eines Anfangbesitzes an Kapital oder Ausbildung dringt kein Unterer hinauf. Dieser Zufall aber ist, abgesehen vom Falle der Auswanderung, so unverhältnismäßig selten, daß unter Tausenden von Angestellten, die durch den Gesichtskreis unsrer Unternehmer schreiten, sich kaum der Sohn eines echten Proletariers findet.
Von unerhörter Härte ist dieser Trennungszwang für das zweite Volk. Helotie, Leibeigenschaft, Hörigkeit waren auf Landwirtschaft gegründete Abhängigkeiten. Die Arbeit, härter und unlohnender als die der Freien, war doch von gleicher Art; es war der schön bewegte Kreis des Landlebens, wenn auch unter Aufsicht und elende Kürzung des Ertrages gezwängt. Die Arbeit des Proletariers genießt zwar jene lockende Anonymität der Abhängigkeit; er erhält nicht Befehle, sondern Anweisungen, er folgt nicht dem Herrn, sondern dem Vorgesetzten; er dient nicht, sondern übernimmt eine freie Verpflichtung; seine menschlichen Rechte sind die gleichen wie die des Gegenkontrahenten; er hat die Freiheit, Ort und Stellung zu wechseln; die Macht, die über ihm steht, ist nicht persönlich: erscheint sie in der Form eines einzelnen Arbeitgebers oder einer Firma, so ist es in Wahrheit die bürgerliche Gesellschaft. Dennoch verläuft sein Leben, wie er es auch innerhalb dieser Scheinfreiheit gestalte, in generationenlanger Öde und [45]Gleichförmigkeit, über und unter Tage. Wer ein paar Monate lang bei ungeistiger Verrichtung von 7 bis 12 und von I bis 6 das Zeichen einer Pfeife herangesehnt hat, ahnt, welche Selbstverleugnung ein Leben der entseelten Arbeit fordert; niemals wieder wird er versuchen, durch kirchliche oder profane Überredung dieses Leben an sich als ein zufriedenstellendes zu rechtfertigen, und jeden Versuch, es zu mildern, als Begehrlichkeit verschreien. Wer aber ermißt, daß dies Leben nicht endet, daß der Sterbende die Reihe seiner Kinder und Kindeskinder unrettbar dem gleichen Schicksal überliefert sieht, den ergreift die Schuld und Angst des Gewissens. Unsre Zeit ruft nach Staatshilfe, wenn ein Droschkenpferd mißhandelt wird, aber sie findet es selbstverständlich und angemessen, daß ein Volk durch Jahrhunderte seinem Brudervolk frönt, und entrüstet sich, wenn diese Menschen sich weigern, ihren Stimmzettel zur Erhaltung des bestehenden Zustandes abzugeben. Das flache Dogma des Sozialismus ist ein Produkt dieser bürgerlichen Gesinnung; tiefste Notwendigkeit und funkelndes Paradox ist es zugleich, daß dieses Dogma zur stärksten Stütze von Thron, Altar und Bürgertum werden mußte: indem es nämlich mit dem Gespenst der Expropriation den Liberalismus schreckte, so daß er alles freie und eigene Denken fahren ließ und hinter den erhaltenden Mächten Schutz suchte.
Читать дальше