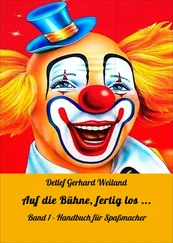Am nächsten Tag fühlt sich Albert Hofmann merkwürdig erfrischt, die Welt erscheint ihm „wie neu erschaffen“. Alles glänzt in einem anderen, einem helleren Licht, und das Frühstück schmeckt ausgezeichnet. Keine Spur von einem Kater. Das, konstatiert der Chemiker nüchtern, muss am LSD liegen.
Der LSD-Erfinder erkennt in dem Stoff, der bereits im Mikrogrammbereich wirkt, medizinisches Potenzial und setzt auf das Interesse der Pharmakologen, Neurologen und Psychiater. Eine wie auch immer geartete Drogenszene kam ihm allerdings nicht in den Sinn: „Ich habe mir nach meinen ersten Erfahrungen nie vorstellen können, dass LSD jemals auf die Straße gelangen würde. LSD ist ja wirklich kein Genussmittel. Es ist eine Art Konfrontation mit seinem eigenen Unterbewusstsein. Das können auch sehr unangenehme Inhalte sein, schreckliche Erlebnisse. Himmel und Hölle, wie Huxley das bezeichnet hat.“
Hofmann verfasste einen ausführlichen Bericht, der bei den Vorgesetzten großes Erstaunen hervorrief. Stimmten denn die Gewichtsangaben? Das Lysergsäurediäthylamid wurde erneut in der pharmakologischen Abteilung getestet, diesmal jedoch nicht an Versuchstieren sondern vom Chef höchstpersönlich. Professor Ernst Rothlin und zwei seiner Mitarbeiter waren die ersten, die Hofmanns Tropfen probierten. Auch bei ihnen traten bewusstseinsverzerrende Wirkungen auf, trotz wesentlich geringer Dosis. Eindeutig, diese Substanz musste weiter untersucht werden!
Nach diesen Selbstversuchen gab es in der pharmakologischen Abteilung weitere neue Testreihen. Bevor eine Substanz, wie von Hofmann vorgeschlagen, in der Psychiatrie direkt am Menschen angewendet werden durfte, musste sie in Tierversuchen auf ihre Giftigkeit und Nebenwirkungen hin geprüft werden. Bei den Tests stellte sich heraus, dass auch Tiere nach der Verabreichung hoher Dosen ein ungewöhnliches Verhalten an den Tag legten. Einige Beispiele: Eine intoxifizierte Katze fürchtete sich plötzlich vor Mäusen (und wahrscheinlich auch vor allem anderen). Spinnen webten bei niedriger Dosierung ihre Netze regelmäßiger und filigraner als gewöhnlich; bei steigender Dosis kippte diese Fähigkeit jedoch dramatisch, und die Spinnweben wurden fahrig und blieben oft unfertig.
Einen aufschlussreichen Hinweis auf ein zukünftiges Zusammenleben mit LSD-Berauschten lieferte eine Käfiggemeinschaft von Menschenaffen. Während bei dem intoxifizierten Schimpansen selbst keinerlei Verhaltensänderung feststellbar war, befand sich der nüchterne Rest der Sippe in heller Aufruhr. Hier liegt die Vermutung nahe, dass sich der Affe nicht der Hierarchie entsprechend verhielt und auf LSD permanent gegen die ausbalanzierte Sippenordnung verstieß. Ähnlich gestaltete es sich später mit den Hippies.
Die Tests ergaben ein optimistisches Bild. Obwohl die wirksame Dosis von LSD außerordentlich niedrig liegt, wurden Überdosierungen körperlich ungewöhnlich gut vertragen. LSD gilt als relativ ungiftig, denn bisher gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass Menschen aufgrund einer Überdosis an LSD gestorben sind. Anders verhält es sich mit einer „psychischen Vergiftung“. Hierbei kann es durchaus zu Unfällen und Verwirrtheitszuständen mit tödlicher Folge kommen.
Darüber hinaus bildet sich rasch eine Toleranz, was bedeutet, dass LSD zu keiner körperlichen Abhängigkeit führen kann, da die Wirkung bei steter Einnahme rapide nachlässt. Nach drei Tagen Dauergebrauch löst das LSD keinerlei Reaktionen mehr aus. Daher kommt LSD zwar als Rauschsubstanz in Betracht, aber niemals als Suchtdroge. LSD-Junkies sind demnach eine rein sprachliche Konstruktion, ohne Entsprechung in der Wirklichkeit.
Nach Beendigung der Tierversuche wurde der neue Wirkstoff erstmals in der psychiatrischen Klinik der Universität Zürich systematisch am Menschen getestet. Die Versuchsreihe fand unter der Aufsicht von Dr. Werner Stoll statt, Sohn des Sandoz-Chefs Arthur Stoll. Die Versuchsgruppe bestand sowohl aus gesunden Probanden als auch aus schizophrenen Patienten. Die Einbeziehung von Schizophrenen erfolgte mit der Überlegung, dass der LSD-Rausch, der einem psychotischen Schub ähnele, künftig zum Verständnis oder gar zur Heilung dieser Erkrankung beitragen könnte.
Die verabreichte Dosis war deutlich niedriger angesetzt als die Hofmann-Dosis und changierte zwischen 20 und 130 Mikrogramm. Die Testreihe war weit entfernt vom heutigen Standard einer Doppelblindstudie, bei der weder Versuchsleiter noch Patienten wissen, ob sie ein Placebo oder ein wirksames Medikament erhalten. Ebenfalls unüblich ist heutzutage die Praxis, dass der zuständige Arzt die neue Substanz am eigenen Leib ausprobiert. Werner Stolls Selbstversuch von 1947 mit 60 Mikrogramm LSD-Tartrat wurde der erste publizierte Trip eines Psychiaters. Nach den Chemikern Hofmann und Rothlin, die eher am Aufbau und der Wirkungsweise von Molekülen interessiert waren, äußerte sich erstmals ein Fachmann der menschlichen Psyche zum LSD-Rausch.
Der Rausch entwickelte sich für Werner Stoll zur emotionalen Achterbahnfahrt, die zwischen Euphorie und Depression oszillierte. Es zeigten sich sowohl Ansätze von Glückseligkeit als auch zum Horrortrip. Bilder vom Vortag, aber auch aus früherer Vergangenheit, gelangten ins Bewusstsein. Diese Fähigkeit des LSD, vergessene oder gar verdrängte Inhalte abzurufen, wird bald das Interesse von Psychoanalytikern wecken. Bemerkenswert bei der Beschreibung seines Rausches ist der Rückgriff auf Elemente der klassischen Bildung:
„Ich fühlte mich eins mit allen Romantikern und Phantastikern, dachte an E. T. A. Hoffmann, sah den Malstrom Poes, schwelgte in den Farben des Isenheimer Altars; ich dachte an abstrakte Bilder, die ich mit einem Mal zu begreifen schien.“ 5
Obwohl LSD eine völlig neue, künstliche Substanz war, die in der Natur so nicht vorkam, existierten bereits Erfahrungen mit ähnlichen Alkaloiden, die allerdings in der Natur vorkamen. Eines davon war das im Peyotekaktus enthaltene Meskalin, das bei den Indianern in Mexiko und im Süden der USA als sakrale Droge im religiös-medizinischen Kontext eingenommen wird. Mehrere deutsche Chemiker hatten dazu wertvolle Vorarbeit geleistet. Der Berliner Pharmakologe Louis Lewin untersuchte den Kaktus bereits 1886. Aufgrund der halluzinogenen Wirkung hatte Lewin den Peyotl in die eigens geschaffenen Kategorie „Phantastika“ eingeordnet. Arthur Heffter gelang es 1896, aus dem Peyotekaktus das wirksame Prinzip Meskalin zu isolieren. Ernst Späth konnte 1919 Meskalin in seiner chemischen Struktur auflösen und synthetisch herstellen. Damit war man nicht mehr auf die unsichere Ernte von Wüstenkakteen angewiesen.
Psychologen, Psychiater und Neurologen experimentierten mit Meskalin und entwickelten das Konzept einer Modellpsychose. Da bereits winzige Mengen Meskalin ausreichten, um im Körper eine radikale Veränderung der Wahrnehmung hervorzurufen, glaubte man, dass durch eine noch unbekannte körpereigene Substanz in ähnlicher Weise Schizophrenie ausgelöst werde könne. Durch die Einnahme von Meskalin hoffte der Therapeut in sich eine temporäre Psychose auszulösen, um mit dem Schizophrenen auf Augenhöhe zu stehen und Einblicke in dessen Welt zu erhalten.
Auch Künstler und Intellektuelle versuchten sich an dem Phantasticum, um durch den Perspektivenwechsel neue Einblicke in die Realität zu erhaschen. Schriftsteller wie Ernst Jünger und Aldous Huxley nahmen Meskalin, lange bevor sie LSD probierten.
Ende der 1950er trat eine weitere Substanz hinzu, die ebenso wie LSD aus einem Pilz gewonnen wurde. Eine Zeitungsnotiz machte 1956 Albert Hofmann auf einen Pilz aufmerksam, der von den Indianern Mexikos im Rahmen ritueller Zeremonien verspeist wurde und im Anschluss Visionen und Halluzinationen erzeugte. Ebenso wie Peyotl ist der Teonanacatl genannte Pilz den Indios heilig. 1957 gelang Hofmann in Basel die Identifikation und Isolation der wirksamen Bestandteile Psilocybin und Psilocin. Die Substanzen gehören wie LSD zu den Indolverbindungen und ähneln dem körpereigenen Botenstoff Serotonin.
Читать дальше