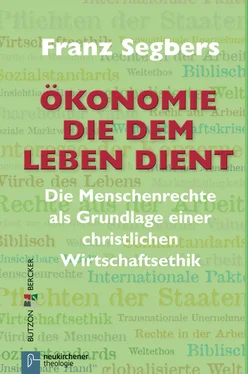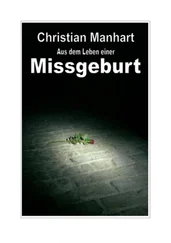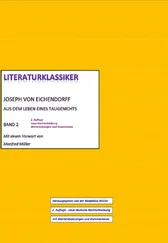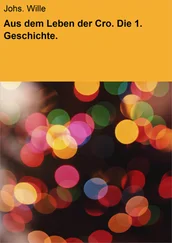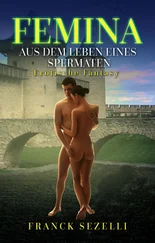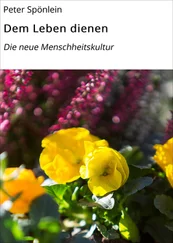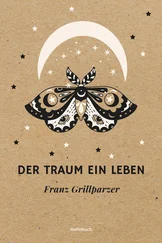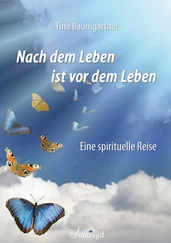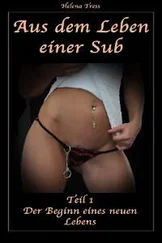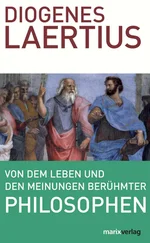Ganz ähnlich argumentiert auch die Ökumenische Vollversammlung in Busan. Sie macht ebenfalls strukturelle und systemische Ursachen in der herrschenden Wirtschaftsverfassung aus:
„Der Marktfundamentalismus ist mehr als ein Wirtschaftsmodell, er ist eine gesellschaftliche und moralische Philosophie. In den letzten dreißig Jahren hat die Marktgläubigkeit auf der Grundlage ungezügelten Wettbewerbs und ausgedrückt durch das Kalkulieren und Monetisieren aller Aspekte des Lebens die Bereiche Wissen, Wissenschaft, Technologie, öffentliche Meinung, Medien und sogar Bildung erfasst und deren Richtung bestimmt. Dieser vorherrschende Ansatz hat vor allem denen Reichtum zugeschanzt, die bereits reich sind, und es den Menschen erlaubt, die natürlichen Ressourcen der Welt weit über die Grenzen hinaus zu plündern, um ihren eigenen Reichtum zu vergrößern. Dem neoliberalen Paradigma fehlen die selbstregulierenden Mechanismen, um mit dem von ihm geschaffenen Chaos umzugehen, mit weitreichenden Folgen, vor allem für die Verarmten und Ausgegrenzten.“ (ÖL 14)
Die Welt ist nicht nur zwischen einem „überentwickelten“ reichen globalen Norden und einem „unterentwickelten“ armen Süden gespalten. Der Norden ist vielmehr in gewisser Weise fehlentwickelt. Und diese Fehlentwicklung zeitigt weltweit katastrophale Folgen. Erstmals in der Geschichte der Christenheit gibt es einen breiten ökumenischen Konsens aller Kirchen von Rom bis zum Ökumenischen Rat der Kirchen über die Ursachen der Katastrophe: Es sind strukturelle Gründe, die zu einer Spaltung zwischen Arm und Reich führen und die die Plünderung der Ressourcen der Erde verursachen. Legitimiert wird diese Lage durch eine Wirtschaftsdoktrin, die die gesellschaftliche Entwicklung nicht an Werten wie Solidarität und soziale Gerechtigkeit ausrichtet, sondern auf einen selbstregulierenden Mechanismus des Marktes vertraut. Nach übereinstimmender Einschätzung der Kirchen sind die Wirtschafts- und Umweltkrisen keineswegs nur technischer Natur, sondern systemisch und haben „tiefe moralische und existenzielle Dimensionen“ (ÖL 13). Nicht anders Papst Franziskus: Für ihn ist die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise Ausdruck einer anthropologischen Krise, der „Leugnung des Vorrangs des Menschen“ (EG 55)!
Der Mensch, dessen Vorrang geleugnet wird, der vom System ausgeschlossen und der seiner Rechte und Würde beraubt ist, bestimmt den Ausgangspunkt und die Blickrichtung der ethischen Reflexion der ökumenischen Christenheit. Der moral point of view ist nicht die Institution oder das Wirtschaftssystem: Dem Menschen gilt der erste Blick. Der systematischen Ausschließung von Menschen setzt der Papst in seinem Schreiben Evangelii Gaudium eine andere Logik entgegen, die in einem kräftigen Bild vor Augen geführt wird:
„Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung.“ (EG 53)
Der Mensch und seine Würde sind das Wahrheitskriterium, an dem sich ein Wirtschaftssystem und seine Effizienz messen lassen müssen. „Die Ausgeschlossenen sind nicht ,Ausgebeutete‘, sondern ,Müll‘, ,Abfall‘.“ (EG 57) Gegen die Exklusionsdynamiken der Wirtschaft pocht Evangelii Gaudium auf das Recht aller auf Würde und Beteiligung. Die menschenrechtliche Grundüberzeugung der gleichen Würde aller, die jeder Differenzierung nach Begabung, Geschlecht oder Rasse vorausliegt, wird zu einem Wahrheitskriterium für eine Wirtschafts- und Sozialordnung.
Weltethos und universelle Menschenrechte
Hans Küng sucht in seinem verdienstvollen Konzept eines „Weltethos“ nach einem weltweit geltenden Ethos als Grundlegung für das Zusammenleben der Völker, Kulturen und Religionen. 18Für ihn sind die Religionen für die Entwicklung eines Weltethos unentbehrlich, um eine „ Unbedingtheit und Universalität ethischer Verpflichtungen begründen“ 19zu können. Küngs Anliegen lautet: „Weltpolitik und Weltwirtschaft verlangen nach einem Weltethos.“ 20Die maßgeblich von Küng inspirierte Erklärung zum Weltethos des Parlaments der Weltreligionen aus dem Jahr 1993 21will die Menschenrechte ethisch mit „unverrückbaren Weisungen“, die allen Religionen gemein sind, abstützen. Menschenrechte seien nämlich der einzig verbindliche Maßstab für Ethik und Politik in einer säkularen Weltgesellschaft mit ihrer Vielfalt von Wertüberzeugungen, Kulturen und Religionen. Vier „unverrückbare Weisungen“ führt das Parlament der Weltreligionen auf. Sie lauten:
„Du sollst nicht töten!“ bzw. „Habe Ehrfurcht vor dem Leben!“
„Du sollst nicht stehlen!“ bzw. „Handle gerecht und fair!“
„Rede und handle wahrhaftig!“ bzw. „Du sollst nicht lügen!“
„Du sollst nicht Unzucht treiben!“ bzw. „Achtet und liebet einander!“
Das ebenfalls von Hans Küng entwickelte Manifest Globales Wirtschaftsethos 22will „gemeinsame fundamentale Vorstellungen über Recht, Gerechtigkeit und Fairness“ für ein globales Wirtschaftsethos auf moralischen Prinzipien und Werten entwickeln, die „seit alters her von allen Kulturen geteilt und durch gemeinsame Erfahrungen getragen werden“. In unverkennbarer Nähe zu den „unverrückbaren Weisungen“ des Parlaments der Weltreligionen aus dem Jahr 1993 werden in dem Manifest u. a. folgende Prinzipien genannt: das grundlegende Prinzip der Humanität sowie Grundwerte für globales Wirtschaften, Gewaltlosigkeit und Achtung vor dem Leben, Gerechtigkeit und Solidarität, Wahrhaftigkeit und Toleranz, gegenseitige Achtung und Partnerschaft.
Zu Küngs „Weltethos“ und den von ihm inspirierten Entwürfen ist zu sagen, dass man ohne grundlegende Prinzipien bei einer ethischen Urteilsbildung sicherlich nicht auskommt. Aber ebenso wenig kann man einfach deduktiv argumentieren, indem aus den Prinzipien direkt Schlüsse gezogen werden. Diese Prinzipien sind ebenso unbestimmt wie vage, sodass nicht klar wird, wie sie denn konkretes Handeln oder Ordnungsstrukturen prägen könnten. Sie können keinen kritischen Maßstab bieten und deshalb auch kaum eine kritische Wirkung entfalten.
Im Zentrum von Küngs Konzeption des „Weltethos“ stehen nicht die Menschenrechte, sondern universale Menschenpflichten. Küng hat auch die Erklärung der Menschenpflichten des „InterAction Councils“ aus dem Jahr 1997 substanziell geprägt. 23Die Betonung der Pflichten gegenüber den Rechten mag zwar religiösen Traditionen entsprechen. Die Menschenrechte haben aus gutem Grund kein Pendant zu entsprechenden Menschenpflichten. Die These, die Einhaltung von Pflichten sei eine Bedingung für die Gewährung von Rechten, oder anders: den Rechten stünden auch entsprechende Pflichten zur Seite, scheint plausibel, versperrt aber den Blick darauf, dass es in einer freien Gesellschaft Rechte und Pflichten gibt, die sich nicht gegenseitig bedingen. Der Bürger, die Bürgerin hat Rechte und Pflichten, und beide stehen für sich. Menschenrechte sind keine Belohnung für Wohlverhalten; sie gelten bedingungslos. Diese Unbedingtheit der Rechte meinte Hannah Arendt, als sie davon gesprochen hat, dass Menschen nur ein Recht haben: das „Recht, ein Recht zu haben“ 24. Wo immer dieses Grundrecht verweigert wird, fallen auch alle anderen Rechte. Das Recht auf Menschenrechte ergibt sich nicht reziprok aus Pflichten. Das Menschenrecht ist ein unbedingtes Recht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte formuliert deshalb in Artikel 3 bedingungslos: „Jeder hat das Recht auf Leben.“ Eine Gesellschaft, die dem Menschen als Menschen Rechte einräumt, schließt zugleich aus, dass zwischen Menschenrechten und Pflichten eine direkte Parallelität besteht. Menschenrechte sind nämlich nicht das Ergebnis eines Tausches nach dem Marktprinzip, sondern Ausdruck der unveräußerlichen Würde des Menschen, der man nicht durch unterlassene Pflichten verlustig gehen kann.
Читать дальше