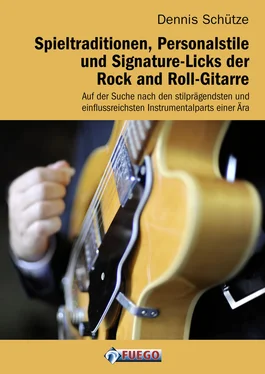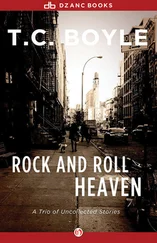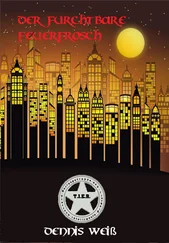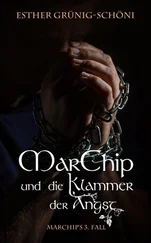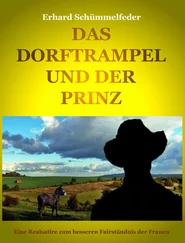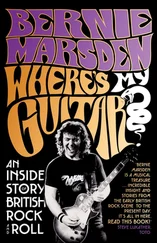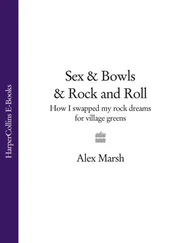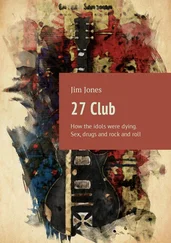„1950s“ (auch: „50s“, „Fifties“ usw.)
Die territoriale Herkunft der Listen entspricht der thematischen Vorgabe, das heißt bis auf wenige begründete Ausnahmen entstammen die insgesamt 40 Listen dem US-amerikanischen Kulturraum. Ohne diese Einschränkung wäre es nahezu unmöglich, bezüglich der Herkunft der Listen eine Grenze zu ziehen. Neben naheliegenden, weil stark nach US-Amerika ausgerichteten Listen aus z.B. England und Deutschland, hätte man auch andere, weniger naheliegende Herkunftsländer wie Japan oder Indien berücksichtigen müssen, deren Listen sicherlich für die Rezeption des Rock and Rolls im jeweiligen Land von speziellem Interesse sein können, die aber die hier formulierte Fragestellung verzerren würden, weil dort mit großer Wahrscheinlichkeit Interpreten eine Rolle spielen, die im Ursprungsland der musikalischen Stilistik keine oder nur eine sehr geringe Rolle gespielt haben. Es folgen in tabellarischer Form die vier Kategorien von Quellen mit den jeweils zehn Listen, Angaben über Titel der Publikation, Autor, Jahr der ersten Erscheinung, Anzahl der genannten Musiktitel und ein Kommentar über Besonderheiten und Auffälligkeiten in der Art und Weise der Zusammenstellung.
2.2.1 Hörempfehlungen und Auswahldiskographien
| Titel |
Autor |
Jahr |
Songtitel |
| The Story of Rock |
Belz |
1969 |
231 |
| The Sound of the City |
Gillett |
1970 |
111 |
| Stranded – Rock and Roll for a Desert Island |
Marcus |
1979 |
313 |
| Unsung Heroes of Rock’n’Roll |
Tosches |
1984 |
182 |
| That old time Rock and Roll |
Aquila |
1989 |
253 |
| The Heart of Rock and Soul |
Marsh |
1989 |
1001 |
| What was the first Rock and Roll Record? |
Dawson/Propes |
1991 |
50 |
| The Classic Rock and Roll Reader |
Studwell/Lonergan |
1999 |
102 |
| A History of Rock |
Scaruffi |
2002 |
170 |
| A brief history of Rock’n’Roll |
Johnstone |
2007 |
48 |
Abb. 3: Hörempfehlungen und Auswahldiskographien in populärwissenschaftlicher Literatur
Eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte des amerikanischen Musikstils Rock and Roll beginnt ab Ende der 1960er Jahre mit zwei kurz hintereinander veröffentlichten Büchern des Amerikaners Carls Belz und seines englischen Fachkollegen Charlie Gillett, der seinen Text im Rahmen einer Masterarbeit an der amerikanischen Columbia Universität in New York verfasste. Beide Autoren fügen ihren Büchern im Anhang jeweils umfangreiche und chronologisch geordnete Diskographien an („Selected Discography“ in Belz 1969, „Play List“ in Gillett 1970). Unter den in Frage kommenden Veröffentlichungen zum Thema galt es vor allem jene zu finden, die sich in irgendeiner Form auf eine Nennung von aus ihrer Sicht repräsentativen Titeln der Ära festlegen konnten oder wollten. Da dies nicht immer der Fall war, konnten einige naheliegende Werke namhafter Autoren (wie Colin Escott, Reebee Garofalo, Peter Guralnick, Arnold Shaw oder Jerry Wexler) nicht berücksichtigt werden. Die beiden letzten Listen stammen von dem seit 1983 in Kalifornien ansässigen Italiener Piero Scaruffi („Best Rock Songs ever“ in Scaruffi 2002) und dem Engländer Nick Johnstone („Further Listening“ in Johnstone 2007). Die letzte Liste wurde vor allem deswegen aufgenommen, weil sie das vorgegebene Thema zeitlich besonders gut abdeckt und zusätzlich die im Augenblick aktuellste Publikation dazu darstellt. Generell gibt es in dieser Sammlung von historischen und zum Teil durchaus auch wissenschaftlichen Betrachtungen die Tendenz den Startpunkt der Ära ausgehend vom allgemein anerkannten kommerziellen Beginn (um 1954) weiter zurück in die Vergangenheit zu verlagern, früher als in den anderen Kategorien enden zu lassen (zum Teil bereits 1956 oder 1958) und oft auch wenig bekannte, manchmal fast obskur anmutende Titel zu berücksichtigen. Es liegt die Vermutung nahe, dass insbesondere diese ernsthaften Versuche sich dem Thema zu nähern besonders bemüht sind, tendenziell keine allzu deutliche Beziehung zwischen der Auswahl und dem kommerziellen Erfolg einzelner Titel erkennen zu lassen, um damit die künstlerische Komponente ihrer Betrachtung zu betonen. Mit pro Liste durchschnittlich 246 Songnennungen kann diese Kategorie als breit angelegt, divers und aus gitarristischer Sicht wenig spezifisch angesehen werden.
2.2.2 Populäre Bestenlisten
| Titel |
Autor |
Jahr |
Songtitel |
| Billboard-Charts |
Whiteburn |
1954-60 |
- |
| Best of Top 40 Singles 1955-1960 |
Marsh/Bernard |
1981 |
274 |
| Rock and Roll: The 100 best Singles |
Williams |
1993 |
100 |
| Top 100 Guitar Solos of all time |
Guitarist Magazine |
1998 |
100 |
| 100 Greatest Solos of all-time |
Guitar World |
2001 |
100 |
| 100 greatest Rock’n’Roll Records |
Record Collector |
2005 |
100 |
| 500 Songs that shaped Rock and Roll |
Rock and Roll Hall of Fame |
2007 |
500 |
| 100 greatest guitar songs of all time |
Rolling Stone |
2008 |
100 |
| Top 200 Songs from the 1950s |
Acclaimed Music |
2008 |
200 |
| Wikipedia-Artikel |
Wikipedia |
2009 |
- |
Abb. 4: Populäre Bestenlisten
So genannte Bestenlisten existieren für nahezu jeden Bereich der Popkultur, der gelistet werden kann. Für die vorliegende Zusammenstellung wurden nur Bestenlisten ausgewählt, die aus renommierten amerikanischen Fachpublikationen stammen und von denen man annehmen darf, dass sie durch einen hohen Grad der Verbreitung besonders großen Einfluss auf die landläufige Meinung genommen haben. Die in der zeitlichen Chronologie erste und ausschließlich nach Maßstäben des kommerziellen Erfolges eines Songtitels erstellte Liste ist die Hitparade des amerikanischen Branchenmagazins Billboard. Die Single-Charts wurden in den 1950er Jahren noch in die drei Kategorien Pop (P), Rhythm and Blues (R&B) und Country and Western (C&W) unterteilt. Ein Eintrag in eine dieser Kategorien, egal welcher Platzierung, wurde als Nennung des Titels gewertet. Bei Mehrfachnennung eines Titels in zwei oder gar allen drei Chartkategorien lassen sich Rückschlüsse auf das sogenannte Crossmarketing einer Einspielung ziehen. Gerade weil die Musiktitel des Rock and Roll nicht genau einer dieser kommerziellen Kategorien zugeordnet werden konnten, gilt eine Listung in mehreren Kategorien als Indikator für die Zugehörigkeit in dieses damals nicht näher definiertes Genre. Ähnlich wie bei den Billboardcharts wurde auch bei der letzten Quelle verfahren, die die Kategorie der Bestenlisten zeitlich mit der Gegenwart (2010) abschließt. Ein eigener Artikel zum Songtitel in der populären und global ausgerichteten englischen Version der Online-Enzyklopädie Wikipedia (wikipedia.org) wurde als Nennung gewertet.
Auch wenn diese Kategorie mit der Billboardliste die insgesamt zeitlich am frühesten entstandene Liste beinhaltet (weil zeitgleich mit dem Phänomen erhoben) und die letzte Wikipedialiste aus dem Jahr 2010 stammt, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass fast alle weiteren Listen erst mit Beginn der 1990er Jahre publiziert wurden und somit eine bemerkenswerte Gewichtung entstanden ist. Eine weitere Besonderheit dieser Kategorie ist die überwiegend höchst subjektive und kommentarlose Entstehung der Listen, auch wenn ihnen zu Gute gehalten werden muss, dass sie ausschließlich von Fachleuten für Fachleute verfasst wurden. Die Gefahr einer allzu großen Abweichung von der im jeweiligen Fachgebiet unter Spezialisten anerkannten Norm kann also nicht im besonderen Maße bestanden haben. Mit pro Liste durchschnittlich 147 Songnennungen kann diese Kategorie durch den meist hierarchischen Aufbau und den zum Teil vorformuliert erhobenen Anspruch bzgl. der Gitarrenrelevanz als relativ breit angelegt und zeitlich divers („of all time“), gleichzeitig aus gitarristischer Sicht aber auch als fachspezifisch relevant („solos“, „guitar songs“, „that shaped Rock and Roll“) angesehen werden.
Читать дальше