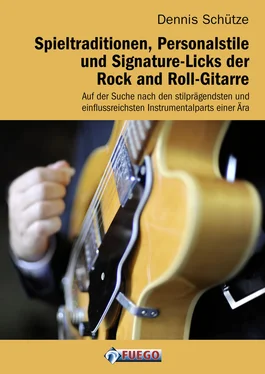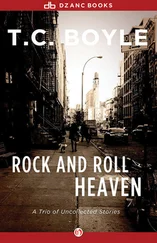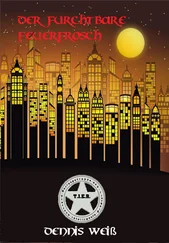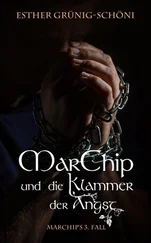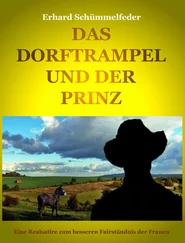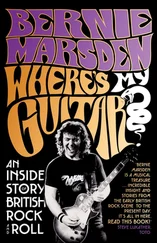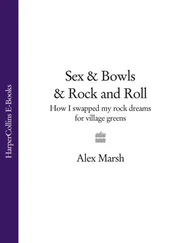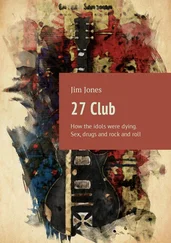2.1.3 Traditionsstrom
Neben dem Kanon und der dazugehörigen Kanonbildung hat Assmann in Anlehnung an Leo Oppenheim die Idee des so genannten Traditionsstroms entwickelt. Sowohl Kanon als auch Traditionsstrom haben normativen und formativen Anspruch. Der entscheidende Unterschied liegt in der Fortschreibbarkeit bzw. Veränderlichkeit des Traditionsstroms gegenüber der (Ab-)Geschlossenheit des Kanons. Assmann beschreibt den Traditionsstrom als einen „lebendigen Fluss: Er verlagert sein Bett und führt bald mehr, bald weniger Wasser. Texte geraten in Vergessenheit, andere kommen hinzu, sie werden erweitert, abgekürzt, umgeschrieben, anthologisiert in wechselnden Zusammenstellungen. Allmählich prägen sich Strukturen von Zentrum und Peripherie heraus. Gewisse Texte erringen aufgrund besonderer Bedeutsamkeit zentralen Rang, werden öfter als andere kopiert und zitiert und schließlich als eine Art Klassiker zum Inbegriff normativer und formativer Werte“. (Assmann 1997, S. 92)
Der deutsche Musikwissenschaftler Dietmar Elflein hat in einem Essay (Elflein 2008) das Konzept des Traditionsstroms auf einen Teilbereich der populären Musik (Heavy Metal) angewendet und dem Konzept der Kanonbildung alternativ gegenüber gestellt. Er übersetzt das soeben erwähnte Assmann-Zitat in die Sphäre der Populärmusik und beschreibt den Umgang mit Musik innerhalb einer bestimmten Szene oder innerhalb eines Genres.
„Manche Stücke werden vergessen, neue kommen hinzu. Sie werden umgeschrieben (gecovert), bearbeitet und anthologisiert in einem nicht endenden Strom von persönlichen Plattensammlungen, Mixtapes (-CDs) und iPod-Playlists. Die Musikindustrie trägt aktiv zum Vergessen bei, indem der Bestand zugänglicher, also erwerbbarer Stücke klein gehalten wird, während permanent Neues veröffentlicht wird, das seinen Platz im Traditionsstrom finden soll. Durch zahllose Best of-Veröffentlichungen und thematische Zusammenstellungen versucht die Musikindustrie einen bestimmten Bereich des Traditionsstroms als endgültig normativ und formativ darzustellen. Kleinstfirmen, Plattensammler, private Webseiten-Betreiber, Blogs und die illegalisierten Filesharing-Netzwerke entreißen permanent Stücke diesem Vergessen und halten sie weiter zugänglich für Interessierte und Neugierige. In diesem ungleichen Wechselspiel prägen sich Strukturen von Peripherie und Zentrum, von fast vergessen und viel kopierten bzw. bearbeiteten Texten heraus, die weiter im Fluss sind.“ (Elflein 2008, S. 130)
Nach dieser ausführlichen Paraphrase fährt er fort mit seiner Definition des Begriffs.
„Der Traditionsstrom beinhaltet damit eine sich verändernde Auswahl dessen, was gewusst werden kann, darf und soll. Er entspricht weder dem gesamten verfügbaren Wissen noch dem gesamten Wissen, sondern dem momentan nicht vergessenen Teil des verfügbaren Wissens.“ (Elflein 2008, S. 130)
Elfleins grundsätzliche Überlegung zur Anwendung des Konzepts des Traditionsstroms auf die Populärmusik lässt sich in geradezu idealer Weise auf die in sich zeitlich geschlossene Ära des Rock and Roll übertragen. Sie bewahrt uns gleichzeitig vor den Problemen, die der Versuch einer Kanonbildung mit sich bringen würde. Auch die Fragestellung für die Suche nach den einflussreichsten und stilprägendsten Personalstilen und Signature-Licks der Rock and Roll-Gitarre ist nun offensichtlich. Wir suchen nach einer Manifestation des Traditionsstroms der einflussreichsten und stilprägendsten Instrumentalparts der Rock and Roll-Gitarre.
2.1.4 Inhaltliche Eingrenzung
Für die Auswahl der zu untersuchenden Werke wurden bereits einige eingrenzende Kriterien erläutert und definiert (siehe1.b.). Die Auswahl soll den Zeitraum vom Beginn des Jahres 1954 bis zum Ausklang des Jahres 1960 umfassen. Berücksichtigt werden lediglich US-amerikanische Produktionen, das heißt Produktionen die auf dem Staatsgebiet der USA aufgenommen und dort im regulären Handel erhältlich waren. Ein wesentliches Kriterium, das die Auswahl im weiteren Verlauf der Untersuchung beträchtlich eingrenzt, ist die Bedingung, dass die Gitarre, vorzugsweise E-Gitarre, eine herausragende Position innerhalb der Produktion einnimmt, also als Soloinstrument in Erscheinung tritt oder zumindest charakteristische Anteile zum musikalischen Arrangement beisteuert.
Die Zugehörigkeit zum Genre Rock and Roll wird bewusst nicht als Kriterium herangezogen, weil dies durch die Unschärfe des Genre-Begriffs (siehe 1a.)) in den meisten Fällen nicht zweifelsfrei zu belegen wäre. Die Entscheidung über die Zugehörigkeit wurde aus den zugrunde liegenden Quellen der Auswahl unkommentiert übernommen.
Der Begriff Werk bzw. Titel bezeichnet in den folgenden Betrachtungen kommerzielle Schallplatten-Veröffentlichungen im Single-Format 45RPM aus Vinyl, zum Teil auch noch 78RPM aus Schellack. Insbesondere die ab dem Jahr 1949 von der Firma RCA eingeführte 45er-Single löste das Vorläufer-Format der 78er-Single bis ca. 1955/56 weitgehend ab und wurde im regulären Tonträgerhandel, bei Diskjockeys und in Jukeboxen zum etablierten Standard der amerikanischen Populärmusik (Dawson 2003). Longplayer-Veröffentlichungen (LPs) spielten hingegen im Genre Rock and Roll bis Anfang der 1960 Jahre keine bedeutende Rolle und werden daher ebenso wie der Sonderfall der Extended Plays (EPs: Singleformat mit zwei Titeln pro Seite) im Folgenden nicht weiter berücksichtigt.
2.2 Methode und Quellen der Selektion
Aufgrund der unter 2.1 zusammengefassten Überlegungen zum Thema kommunikatives Gedächtnis und Traditionsstrom wird im Folgenden der Versuch unternommen, eine Methode zu entwickeln, um eine Manifestation des Traditionsstroms der einflussreichsten und stilprägendsten Instrumentalparts der Rock and Roll-Gitarre zu erstellen.
Eine Auswahl sollte einerseits normativen und formativen Anspruch haben und sich andererseits noch in Kommunikation befinden, also noch diskutiert werden und im Fluss sein (Assmann 1992). Um die Dynamik eines solchen noch aktiven Prozesses abzubilden, sollte daher sicher auf mehr als nur eine einzige Quelle zurückgegriffen werden. Mehrere Quellen sollten das Thema idealerweise aus verschiedenen fachlichen Blickwinkeln betrachten, damit sich mögliche Unterschiede in den Sichtweisen erkennbar im Datenmaterial niederschlagen. Alle Quellen sollten ernsthaft und kompetent aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich, also in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht worden sein um damit auch nachvollziehbar zu sein. Um die Veränderlichkeit eines solchen Prozesses im Lauf der Zeit abzubilden ist es von Vorteil, wenn die Entstehungsdaten der verschiedenen Quellen den Zeitraum von Beginn des vorliegenden Phänomens bis zur Jetztzeit möglichst breitflächig abdecken, also falls möglich die Zeit von Ende der 1950er Jahre bis 2010 umfassen.
Aufgrund dieser Vorgaben wurden vier Kategorien mit jeweils zehn, insgesamt also 40 Listen gebildet. Die vier Kategorien unterteilen sich in:
- Hörempfehlungen/Auswahldiskographien in populärwissenschaftlicher Literatur
- Populäre Listen aus Fachzeitschriften und andere verbreitete Empfehlungslisten
- Kompilierte Notenausgaben zum Thema Rock and Roll bzw. Rock and Roll-Gitarre
- Kompilierte Tonträger zum Thema Rock and Roll bzw. Rock and Roll-Gitarre
Die dafür herangezogenen und nach einer aufwändigen Sichtung ausgewählten Quellen entstammen sämtlich den Publikationen international etablierter und anerkannter Autoren, Verlage und Labels und beziehen sich meist bereits im Titel, zumindest aber im Untertitel dezidiert auf das Thema Rock and Roll. Schlagworte in allen erdenklichen Schreibweisen bei der Sammlung der Quellen in Bibliotheken, Literaturverzeichnissen, Verlagskatalogen, Internet usw. waren:
„Rock and Roll“ (auch: „Rock’n’Roll“, „Rock & Roll“, „R&R“ usw.)
„Guitar“ (auch: „Rockguitar“, „Rock Guitar“ usw.)
Читать дальше