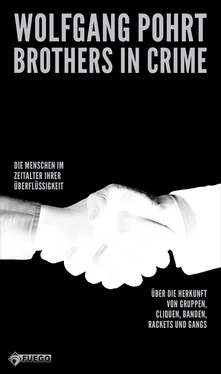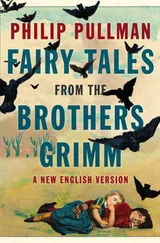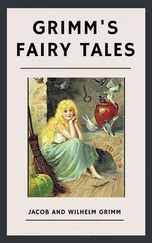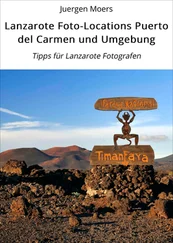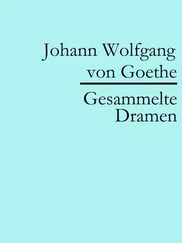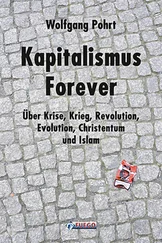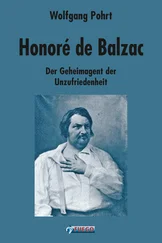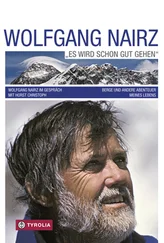Die eine mögliche Schlussfolgerung daraus wäre der Verzicht. Die Kämpfer für eine bessere Gesellschaft ziehen sich zurück im Moment, wo das Ziel erreicht ist. Den Grund dafür hat Oppenheimer in seinem Guerilla-Buch erläutert. Menschen, schreibt er, die als Untergrundkämpfer leben müssen; die sich an solche Bedingungen gewöhnen und sich am Ende darin sogar »wohlfühlen, können, und wenn sie sich noch so leidenschaftlich darum bemühen, keine Gesellschaft hervorbringen, die von den Gesetzen der Menschlichkeit regiert wird. Das war der Grund, warum es Moses lediglich gestattet war, das Gelobte Land zu sehen, nicht aber, es zu betreten.« (Oppenheimer 1972:70f.)
Die andere Konsequenz zieht Debray: Die Kämpfer sollen im Triumphmarsch einmarschieren und Beute machen dürfen. So war es immer, nur Debrays Begründung ist neu. Die Depersonalisierung der Einzelnen in der Kampfgruppe gilt ihm als exemplarisch für die Transformation der Klassengesellschaft in die klassenlose. Der Guerilla-Krieg samt seiner Grausamkeiten und Strapazen stellt sich deshalb als gelebter Sozialismus im Kleinen dar. Es versteht sich dann von selbst, dass später einen besonderen Rang einnehmen wird, wer dabei war: »Ist das nicht die beste Ausbildung für einen sozialistischen Führer oder Kader?« (Debray 1967:118) Der Guérillero weiß aus Erfahrung und Selbsterfahrung, wie und durch welche Mittel man Menschen dazu bringt, sich nicht als freie Einzelwesen, sondern als Mitglieder einer Schicksalsgemeinschaft zu begreifen. Und er hat es schätzen und lieben gelernt, dass Menschen mit solchem Bewusstsein einen unschlagbaren Kampfverband bilden.
Wird ein Mann mit diesem Erfahrungsschatz als optimaler Bewerber für die Stelle eines »sozialistischen Führers« eingestuft, so kann dies nur heißen, dass die ganze Menschheit ein unschlagbarer Kampfverband werden soll, so tüchtig, klassenlos und homogen wie eine Guerillagruppe. Nicht der Kampf hört also auf, wenn die Revolution gesiegt hat, nur die Zerstrittenheit der Kämpfer. Vereint und gestärkt ziehen sie dann in immer neue Schlachten, gegen den Hunger, die Armut, den Analphabetismus, die Liste der Feinde ist endlos.
Als Leitvorstellung, die hinter solchen Szenarien sich verbirgt, haben Adorno und Horkheimer die Idee von der »menschlichen Gesellschaft als einem Massen- Racket 2in der Natur« entziffert. (Adorno Bd.3:292) Das Bandenwesen soll nicht abgeschafft werden, sondern sich unbehindert entfalten dürfen, und mit einigem Recht könnten die Revolutionäre von damals heute sagen: »Wir haben gesiegt.«
Dass die Menschen im Kapitalismus das Objekt übermächtiger ökonomischer Prozesse sind, welche zur Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen kleiner Minderheiten führen, ist ein unbestreitbarer Sachverhalt. Nimmt man hinzu, dass die so beschaffene Gesellschaft Gleichheit und Freiheit für sich reklamiert, wird aus der Tatsachenfeststellung Kritik.
Auch Debray misst die Realität der bürgerlichen Gesellschaft an ihrem Selbstverständnis. Allerdings greift er nicht das Freiheitspathos auf, das die schrankenlose Selbstsucht eines jeden zur Voraussetzung für das Wohlergehen aller verklärt, weil – so das liberale Dogma – die Ordnung des Ganzen der »invisible hand« überlassen werden muss. Statt die Idee vom frei und ungestüm sich entfaltenden Subjekt durch die Arbeiter- und Angestelltenheere verhöhnt zu sehen, wirft Debray der bürgerlichen Gesellschaft umgekehrt vor, sie hielte die Einzelnen an zu langer Leine. Dabei kann er sich auf die — zum Freiheitspathos komplementäre – Korporationsideologie berufen, wonach Gesellschaft dergestalt entsteht, dass die Einzelnen durch den Beitritt zu einem Gemeinwesen auf einen erheblichen Teil ihrer ursprünglichen Freiheitsrechte verzichten. Der Preis fürs Dabeisein ist die Pflicht, sich auch gegen eigene Interessen dem Wohl des Ganzen zu unterwerfen. Von solcher Verbindlichkeit aber, meint nun Debray, könne in der Praxis keine Rede sein. Die Bürger reklamierten für sich zwar den Contrat social. Aber wenn sie das Ding in unverwässerter Form auch mal erfahren wollten, müssten sie zur Guerilla kommen; das zivile Leben biete davon bloß einen müden Abklatsch.
Horkheimer hatte die gleiche Vermutung, nur bewertete er den vermuteten Zusammenhang anders. Richtig ist zwar, dass die Gruppen, Cliquen und Banden, revolutionär oder nicht, kontrastreicher abbilden, was das Wesen des Zusammenhalts in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Aber das spricht nicht für jene Gruppen, sondern es spricht gegen die bestehende Gesellschaft. In ihr ist das Regime der Zwangsverbände nur verschleiert und temporär gemildert, abgeschafft ist es nicht. Die alten Kasten und Stammesgebilde leben hinter der Fassade fort in neuer Form, und die Ursache dieser Kontinuität ist die der Herrschaft selbst.
Dergleichen Überlegungen hat Horkheimer vielerorts formuliert, unter anderem in Die Rackets und der Geist, einer Schrift, die im Zusammenhang mit der Arbeit an der Dialektik der Aufklärung entstanden ist. Sie beginnt mit dem Satz: »Die Grundform der Herrschaft ist das Racket. «
Als Einmannbetrieb erscheint die Herrschaft häufig zwar. Aber selbst in der simplen Urhorde kann der Obergorilla den ganzen Verein nur kontrollieren, wenn der schon hierarchisch gegliedert ist. So stark ist keiner, dass er ganz allein alle anderen bezwingt. Sie könnten ihn in Stücke reißen, wenn sie sich nur zusammentun. Der Anführer braucht daher, wenn er sich behaupten will, die Gruppe der nächststarken Männchen. Sie helfen ihm, sie stützen seine Position, denn sie »wachen gegenüber den minder starken ebenso eifersüchtig über ihre Vorrechte wie ihnen gegenüber der Patriarch.« (Horkheimer Bd. 12: 287)
Macht ist zunächst mit physischer Kraft identisch, aber die Arbeitsteilung bringt mit neuen gesellschaftlichen Funktionen auch neue Kommandostrukturen ins Spiel. Befehlsgewalt und Vorrechte hat, wer die Schlüsselpositionen besetzt. Die Einzelnen können dies nur als Mitglieder einer Gruppe, und jede Gruppe setzt alle anderen voraus. Also hat man die Gesellschaft als ein abgestuftes System von Gruppen mit unterschiedlichem Anteil an Vermögen und Macht zu begreifen, und damit es so bleibt, müssen die Gruppen ihre Exklusivität verteidigen. Könnte jeder dem Club der Milliardäre beitreten, hätte man bald statt vieler Gruppen nur noch eine.
Der Beitritt ist daher stets an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft, und je nach Herkunft des Bewerbers fallen sie verschieden aus. In einen Stand oder eine Kaste hineingeboren zu werden, reicht selbstverständlich nicht, auch Kinder privilegierter Eltern müssen vor der Aufnahme in den Privilegierten-Club vielfältige Prüfungen absolvieren. Das bedrohliche Brimborium und die Paukerei lehren den Nachwuchs, das Dabeisein als eine Gunst zu schätzen, die entzogen werden kann. Wenn der Junge aus gutem Haus gezwungen wurde, sich durch das verhasste Gymnasium zu quälen, und wenn er dann das Abitur nur durch Protektion seines Vaters bekommen hat, ist er klüger geworden. Er weiß, dass man ohne die eigene Sippe und Clique verloren ist.
Bei »Individuen, die nicht auf Grund der Abstammung schon ein Anrecht haben, in ein Racket aufgenommen zu werden«, kommt erschwerend hinzu, dass der Bewerber die Auswahlkriterien nicht weiß. In diesem Fall »gleicht die Prozedur nicht der Aufnahme der Jugendlichen in den Stamm, sondern der Einweihung ins bevorzugte Racket der Zauberer.« Aus Gründen des Machterhalts gibt sich die Clique rätselhaft, ihre Ratschlüsse müssen für Außenstehende unbegreiflich und unberechenbar bleiben. Leistung kann keinen Anspruch begründen, wenn unbekannt bleibt, welche zählt.
Gnade wiederum kann nur erwarten, wer aufgegeben hat. Er muss bereit sein, alles mit sich geschehen zu lassen. Zum Beitrittsritual gehört daher bei Jugendbanden oft, dass der Neuankömmling eine Tracht Prügel ohne Gegenwehr über sich ergehen lässt. Er muss die Schläge und die Demütigung wegstecken können, er darf nicht wehleidig, übelnehmerisch oder gar nachtragend sein. Er darf also weder Stolz besitzen noch Gedächtnis, vor allem aber keinen Hass. 3Andernfalls wäre zu befürchten, dass er die neue Position zum Begleichen alter Rechnungen nutzt. Wer drin ist, soll schon vergessen haben, wie man ihn behandelt hatte, als er ein Außenstehender war.
Читать дальше