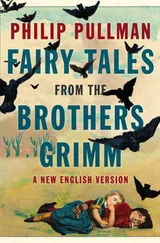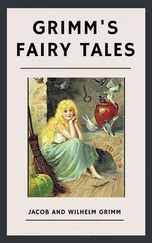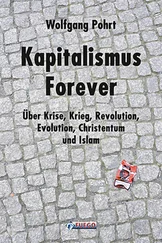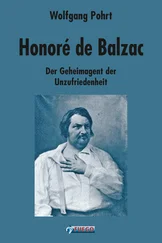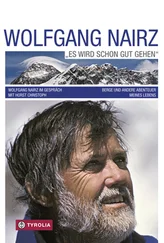Auch dieser Krieg aller gegen alle hat seine Ordnung. Dafür sorgt der Duke, der gefürchtete Slumlord, der in der Hierarchie über den Bandenchefs steht. Sein Hauptquartier sind abgestellte Eisenbahnwaggons auf der früheren Grand Central Station, wohin mittlerweile der Präsident verbracht worden ist. Gefesselt und an die Wand gestellt, soll er, zum Slumlord gewandt, nachsprechen: »Sie sind der Duke von New York, Sie sind die Nummer Eins.« Das fällt ihm schwer, er stammelt. Paar dicht neben seinen Kopf gezielte Schüsse aber räumen alle Hemmungen weg, und er schreit die Botschaft lauthals hinaus.
Später wendet sich das Blatt, und der Präsident hat die Demütigung nicht vergessen. Es kommt zu einer Autojagd, vom Duke verfolgt erreichen Plissken und sein Schützling den Polizeikordon. Statt erst mal durchzuatmen, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen oder seinen Rettern einen dankbaren Blick zu schenken, schreitet der Präsident sofort zur Tat. Er entreißt einem der Beamten die Maschinenpistole und richtet sie gegen den auf Schussweite herangerückten Verfolger. Dann bricht er in ein irrsinniges Lachen aus und kreischt so laut, dass es die Salve, mit der er den Duke niedermäht, übertönt: »He, Du bist die Nummer Eins? Du bist der Duke? Ich scheiß auf den Duke.«
Die Exekutions-Szene zeigt den Präsidenten als einen Chef von der Sorte, die auch selber mit anfassen kann. 1 Sich über die Bedienung der Waffe instruieren lassen braucht er nicht, die Griffe sitzen. Trotzdem ist klar, dass es sich um keinen Politiker mit Guérillero-Vergangenheit handelt, wie Allende einer sein wollte, als er in der Moneda mit der Maschinenpistole eigenhändig die Stellung hielt. Die Bilder vermischen sich, hinter dem verblassenden vom Guérillero taucht das ältere vom Gangsterboss wieder auf. Für die Schmutzarbeit hat er zwar längst seine Leute, bisweilen aber fällt er in alte Gewohnheiten zurück. Skrupellosigkeit, Impulsivität, Jähzorn, Sadismus – die Charaktereigenschaften, die ihn hochbrachten –, schlagen dann durch, und er lässt es sich wider alle Vernunft nicht nehmen, beim Erledigen ausgewählter persönlicher Feinde selber Hand anzulegen, wie er dies vor seinem Aufstieg an die Spitze tat.
Aus der Kalaschnikow am emporgereckten Arm des Revolutionärs wird wieder der »Hacker«, die »Schreibmaschine«, das »Chicagoklavier«, wie in den Zwanziger Jahren unter Gangstern deren Lieblingswaffe hieß. Das war die Thompson-Maschinenpistole, benannt nach dem amerikanischen Brigadegeneral, der sich den »Kehrbesen für Schützengräben« ausgedacht hatte. Allerdings fielen dann Produktionsreife und Kriegsende zusammen, so dass als einziger Abnehmer für die neue Wunderwaffe zunächst nur die Unterwelt blieb.
Viel anders als drinnen muss der Zuschauer beim Anblick des Präsidenten mit Maschinenpistole denken, kann es draußen nicht sein, denn hier wie dort sind die gleichen Typen am Ruder. Plissken sieht es ebenso, und das hat Konsequenzen. Seinen Auftraggebern ging es weniger um den Amtsträger selbst als um die Tonkassette, die der Staatsmann bei sich hatte. Eine ominöse Botschaft ist darauf, und nur diese Botschaft kann einen ebenso ominösen Atomkrieg, für den schon alle Vorbereitungen angelaufen sind, in letzter Minute noch verhindern. Präsident und Kassette waren zwischenzeitlich getrennt, Plissken hat beide eingesammelt, aber nur den Präsidenten abgeliefert. Die Übergabe des kostbaren Tonträgers steht noch aus.
Sie findet nun statt, wie Empfänger und Zuschauer glauben müssen, und dann kommt der große Augenblick. Doch statt dass das rettende Wort – über Fernsehen adressiert an ein »historisches Gipfeltreffen«, damals schon – zu hören wäre, dudelt aus dem Lautsprecher blöder Swing. Also noch einer, der weiß, dass man stets ein Reserve-As im Ärmel haben, sich immer ein Hintertürchen offenhalten muss. Dass es in die Hölle führt, spielt keine Rolle.
Verdientermaßen kam der Film bei der Kritik schlecht weg. Zu echt sind die Figuren, als dass sie überzeugen könnten. Echte Geschäftsleute und Politiker sehen stets wie im B-Picture aus. Kein Mensch kaufte Clinton die Präsidentenrolle ab, wenn er sie im Studio spielen müsste. Auch die Gegenseite, die Stadtguerilla-Gruppe mit dem offizielle Amtlichkeit nachäffenden und deshalb affig klingenden Namen »Soldaten der Nationalen Befreiungsfront der Vereinigten Staaten«, wirkt ohne echte Kulissen und Requisiten läppisch. Das Vermächtnis der Desperados scheint aus der Feder eines schriftstellern- den Gymnasiasten zu stammen. Kein Kunstgenuss zwar und von mäßigem Unterhaltungswert, aber realistisch, weil die Protestbewegung wirklich schlechtes Theater war. Eine Laienschar spielte vor allem sich selbst was vor. Sie tat es im besten Glauben, und vielleicht hatte sie keine andere Wahl.
Entgegen einem weitverbreiteten Irrtum heißt Revolution machen wollen keineswegs primär, Mitgefühl für die Ausgebeuteten zu entwickeln und den Entschluss zu fassen, deren Lage zu bessern. Revolution machen wollen heißt vielmehr, einen großen Ausbruch zu planen – den Ausbruch aus einem Zeitabschnitt, von dem man meint, dass man darin nicht mehr die Luft zum Atmen fände. Um die Details wie Wohnung, Entlohnung, Ernährung, die durch allmähliche Reformen zu verbessern wären, geht es nicht. Man will ans Fenster stürzen, um es aufzureißen, und zwar mit einem Ruck.
Marx hat erklärt, wie es dazu kommen kann. Im Lauf ihrer Entwicklung, schreibt er, bringt eine bestimmte Produktionsweise irgendwann »die materiellen Mittel ihrer eignen Vernichtung zur Welt. Von diesem Augenblick regen sich Kräfte und Leidenschaften im Gesellschaftsschoße, welche sich von ihr gefesselt fühlen.« (Marx, MEW 23:789) Für den Menschen, der von solchen Kräften und Leidenschaften ergriffen worden ist, stellt die alte Ordnung ein Gefängnis dar. Die vorgefundenen Verhältnisse hindern ihn daran, die Welt als »Laboratorium seiner Kräfte« zu behandeln, als »Domäne seines Willens« (Marx, Grundrisse:396). Er leidet unter aufgezwungener Kraftlosigkeit und Willenlosigkeit, weil er umständehalber auf möglich erscheinende Unternehmungen verzichten muss. Beklagt werden Armut und Elend immer, aber ein Motiv für Rebellion und Revolution stellen quälende Entbehrungen erst im Moment ihrer objektiven Überflüssigkeit dar. Bedingung und Folge ihrer Fortdauer ist dann, dass die Menschen ihr Selbstbewusstsein verlieren, weil sie sich wie unfreie, willenlose Wesen verhalten. Nehmen sie die Verhältnisse hin, von denen sie sich gefesselt fühlen, werden sie Gefangene. Mit der Zeit entwickelt sich bei ihnen ein Insassensyndrom, sie empfinden die Welt als Zuteilungsstelle und sich selber als Empfänger. Wer reicher ist, fühlt sich besser abgefüttert, selber essen kann er auf legalem Wege nicht. Deshalb schmecken geklaute Äpfel besser.
Oft allerdings ist das Lebensgefühl revolutionär, doch die Verhältnisse sind es keineswegs. Damals, Ende der Sechziger Jahre, waren sie nicht nur ausbruchssicher, dicht wie Manhattan Island in Carpenters Riesengefängnisfilm, sondern sie glichen abhärtendem Beton. Was an der Protestbewegung fröhlich wirkte und aufbruchsgestimmt, war die Ausgelassenheit einer Abschiedsparty, wie sie von Junggesellen vor der Heirat gefeiert wird oder von jungen Männern vor der Einberufung zum Militär. Man kostete den Restbestand hinfällig gewordener alter Freiheit auf eine Weise aus, als wolle man ihn vernichten.
Eine solche Konstellation entsteht, wenn die Realität sich schneller geändert hat als das Bewusstsein der Menschen. Die Leute kämpfen dann, getrieben von zwiespältigen Gefühlen, gegen die eigenen, lästig gewordenen Denk- und Lebensformen an, während sie eine Welt aus den Angeln zu heben meinen. Wie bei Kindern, die der Puppe zufügen, was die Mutter mit ihnen tat, liegt der Grund des Missverständnisses darin, dass der Leidende lieber Täter wäre, wenn er die Qual nicht verhindern kann. Identifikation mit vorhandenen Verhältnissen heißt, dass die Menschen das Vorgefundene als von ihnen Hervorgebrachtes betrachten. Sie verhalten sich so, dass ihnen die eigene Anpassung an die äußere Welt als deren Umwälzung erscheinen muss.
Читать дальше