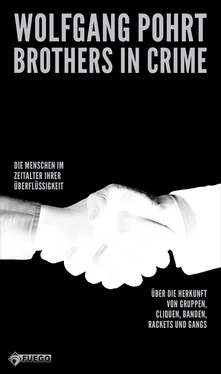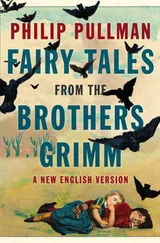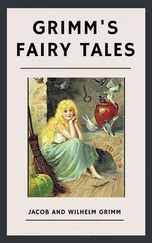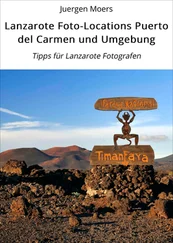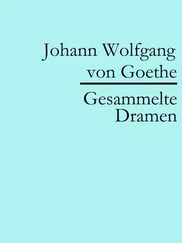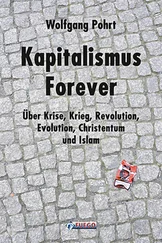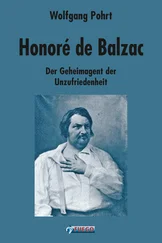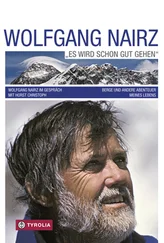Mit großem Schwung rannte die Protestbewegung also offene Türen ein, soweit sie ein kulturrevolutionäres Unternehmen blieb, das seinen Hauptgegner in den tradierten Moralvorstellungen und den sie konservierenden Institutionen hatte. Die selbstquälerische Ablehnung von Repressivität stieß auf allgemeine Sympathie, auch wenn dies zunächst nicht allgemein eingestanden wurde. Dass die Alten, als sie die ersten nackten Jungen sahen, sich empörten, bevor sie ihrerseits die Hüllen fallenließen, gehörte zum Spiel mit verteilten Rollen, welches der Unterwerfung unter den Status quo den kämpferischen Anstrich gab, dessen euphorisierende Wirkung den Umstellungsschmerz unfühlbar machen sollte.
Anders hingegen sahen die Chancen aus, wenn statt der neuartigen unbegrenzten Nacktbadekonzession die überfällige Einlösung alter Versprechen gefordert wurde. Auch die Traditionalisten, denen es um die Herstellung einer Welt ohne Entmündigung, Elend und Hunger ging, waren Produkt des aktuellen Veränderungsdrucks, nur missverstanden sie starrsinnig dessen Bedeutung. Im Glauben, statt der Anpassung an die Verhältnisse stünden diese selbst zur Disposition, wollten sie zum Abschluss bringen, was stets nur begonnen, dann aufgeschoben und halb vergessen worden war.
Das aber hieß, sich mit dem Blechlöffel durch meterdickes Mauerwerk zu kratzen, und als Konsequenz daraus ergab sich die Alternative Resignation oder Realitätsverlust. Zwei Weltkriege, Faschismus und hundert nicht wahrgenommene Chancen hatten tausendmal das Manifest der Kommunistischen Partei von 1847 widerlegt. Die Bourgeoisie, glaubten Marx und Engels damals, »produziert vor allem ihren eignen Totengräber. Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich« (Marx/Engels 1989:50). In absehbare Nähe gerückt schien der Punkt, wo der versteckte Bürgerkrieg »in eine offene Revolution ausbricht und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie das Proletariat seine Herrschaft begründet«. Anlässlich der Jubiläumsausgabe 25 Jahre später waren es dann die Verfasser selbst, die in ihrem alten Text nur noch ein »historisches Dokument« sahen.
Und nun, um 1970 herum, war wiederum ein knappes Jahrhundert vergangen, das Industrieproletariat eine Schrumpfgröße geworden und die Masse keine Klasse mehr. Nach dem Konzept für die Angestelltenheere suchte man in der Literatur vergeblich, sie kamen bei Marx und Engels gar nicht vor. Die Bevölkerung stellte sich als amorphe Menge dar, unterteilbar in beliebig viele Schichten. Den Willen und die Kraft, ein besseres Zeitalter zu erkämpfen, besaß sie offensichtlich nicht.
Wie vom Himmel geschickt mussten deshalb Che Guevara und Régis Debray erscheinen. Der eine hatte angeblich das Wundermittel entdeckt, um die apathisch dahindämmernde Masse der Bauern in Lateinamerika zu revolutionieren. Der andere, sein Begleiter, hatte sich dabei Notizen gemacht. Die kamen 1967 in Frankreich unter dem Titel Révolution dans la révolution? und zeitgleich in deutscher Übersetzung auf den Markt. Das Bändchen wurde aufgenommen wie eine Offenbarung. Denn wenn der Kunstgriff, den es verriet, bei der abgestumpften Landbevölkerung armer Länder wirkte, wirkte er bei der stumpfsinnigen Masse in den reichen Ländern sicher auch. Somit bestand kein Bedarf mehr danach, sich den abgesessenen, schmächtigen, müden Mann hinter der Rechenmaschine als schmiedehammerschwingenden Donnergott (»Wenn dein starker Arm es will«) vorzustellen. Das Trugbild von der Fortdauer alter klassenkämpferischer Arbeitermacht war überflüssig, denn die neue Methode wies offenbar über Marx hinaus. Keine Revolution ohne revolutionäre Klasse, hatte der gesagt. Man kommt auch ohne aus, schienen die Erfahrungen in Lateinamerika nun zu zeigen.
Debrays Rezept ist eine Konsequenz aus der Tatsache, dass keine Revolution bislang über intakte Sicherheitskräfte siegte. Es sieht vor, zunächst die Unterdrückungsmaschinerie der staatlichen Exekutivorgane durch viele militärische Nadelstiche zu schwächen. Erst danach habe der Widerstand der Landbevölkerung eine Chance. Die Massen, die nach parteikommunistischer Überzeugung aus Mangel an Bewusstseinsbildung stillhalten, sind ihren philosophisch geschulten Aufklärern an materialistischer Einsicht voraus. Sie wissen genau, warum sie sich nicht wehren. Spontane Aufstände würden zerschlagen mittels der »modernen, von einer wohlausgerüsteten amerikanischen Militärmission trainierten und unterstützten Armee«, »die mit einer zahlenmäßig kleinen, aber aggressiven Elitetruppe ausgerüstet ist« (Debray 1967:34). Machtverhältnisse sind nur durch Machtmittel zu ändern, »Brüderlichkeit und Mut ersetzen keine Waffen: siehe Spanien, siehe die Pariser Commune« (56).
Gegen die kleine, aber aggressive Elitetruppe tritt nun, so Debrays Szenario, ein Verbund noch kleinerer, noch aggressiverer bewaffneter Gruppen an – die Guerilla. Sie operiert vollkommen isoliert, ohne Unterstützung durch die Zivilbevölkerung, welche der Repression der Exekutivorgane hilflos ausgeliefert wäre. Wer nicht gefasst, gefoltert und getötet werden will, muss nach der Methode »hit and run« zuschlagen können. Die Bevölkerung kann es nicht. Sie klebt an dem Stück Erde, das sie ernährt, und es muss auf die Frauen und Kinder Rücksicht genommen werden. Außerdem bleibt den Bauern zum Kämpfen wenig Kraft. Sie sind von der schweren Landarbeit erschöpft, und sie leiden unter schlechter Ernährung.
Auch im eigenen Interesse aber muss die Guerilla »von der Zivilbevölkerung in ihren Aktionen wie in der militärischen Organisation unabhängig« (43) sein. Wer schwach ist, ist erpressbar. Er wird leicht zum Verräter und zum Kollaborateur: »Mehrere einsichtige Gründe machen das Misstrauen der Zivilbevölkerung gegenüber notwendig und zwingen dazu, sich von ihr entfernt zu halten.« (44)
Am Anfang operiert die Guerilla deshalb autark und autonom. Ihre Aufgabe besteht ausschließlich darin, den Repressionsapparat zu zermürben. Feuerüberfälle auf abgelegene Polizeiposten und Armeekasernen bewirken, dass er seine Kräfte bündeln muss. Wenn sein Aktionsradius kleiner wird, bleiben Gebiete zurück, welche die Guerilla kontrolliert. Unter ihrem Schutz werden die Massen revolutionär, sie erwachen aus ihrer Apathie, die von umfassender Machtlosigkeit herrührte. Guerillatätigkeit ist für Debray ein Unternehmen, »das aus sich selbst heraus die Vorbedingungen für eine Revolution schafft, das heißt also nicht unbedingt auf Bedingungen gegründet sein muss, die vorher geschaffen worden sind« (Oppenheimer 1971: 52). Die Revolutionäre mögen nicht länger warten auf den »richtigen Augenblick«; sie führen ihn herbei.
Lösen soll sich der Bann, unter dem die Menschen verdummen und verwildern—nicht nur in den Armutsgebieten der Dritten Welt. Auch die freudlosen Spaßvögel mit ihren Baby-faces und ihrem penetranten kindischen Getue in den reichen Ländern sind Ausdruck der Ohnmacht des Einzelnen vor der gesellschaftlichen Übermacht. Ihr als erwachsene Person gegenüberzutreten hieße, sie herauszufordern. Weil Infantilismus Selbstschutz ist, ahmen erwachsene Frauen die Stimmlage und den Tonfall kleiner Mädchen nach. Deshalb klingt der Sprecher im Werbefunk wie ein Kastrat, wenn er ekstatisch irgendwas bejubelt.
Im Alltag mag jene Übermacht erfahren werden als gewaltloser Zwang, ausgeübt von Verhältnissen, die keine Angriffsflächen bieten, weil bis zum Kanzleramt hinauf hinter jedem Schalter ein freundlicher Angestellter sitzt, der mit Bedauern auf seinen eingeschränkten Handlungsspielraum verweist, wenn er die Bittsteller abwimmelt. Doch der Frieden dauert nur, solange alle Einsicht aufbringen und Geduld. Die Schwachen zeigen sich verständig, weil die geschichtliche Erfahrung besagt, dass sie im Konfrontationsfall keine Chance hätten. Beim Umsturz werden sie auf die Straße gerufen, wenn die Würfel gefallen sind. Die Toten, anders als bei Kriegen nicht allzu viele meist, sind dann echt, der Kampf, worin sie starben, war es nicht. Den hatte der neue Befehlshaber nach gelungenem Staatsstreich zu Propagandazwecken inszeniert. Mit dem Sturm auf die Bastille verglichen waren die Montagsdemonstrationen das miesere Straßentheater, keine schlechtere Politik.
Читать дальше