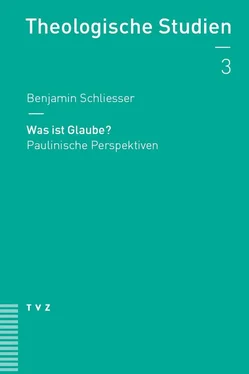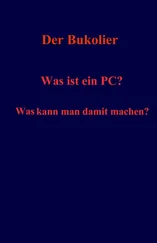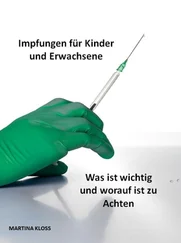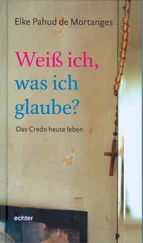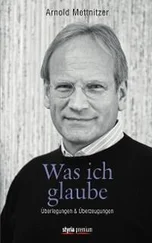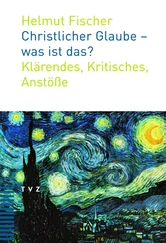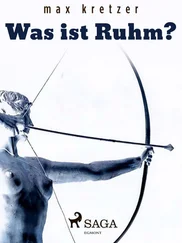Paulus selbst gehörte zu einer jüdischen Gemeinschaft der Diaspora und besaß wohl römisches Bürgerrecht. Seine Griechischkenntnisse lassen darauf schließen, dass er seine jüdische Elementarausbildung in Tarsus erhalten hatte.66 Die theologische Ausbildung und weitere prägende Einflüsse empfing er in Jerusalem, im religiösen, nationalen und kulturellen Zentrum des Judentums.67 Der für seine Theologie und damit für sein Glaubensverständnis entscheidende Traditionshintergrund ist das Judentum. Auch und gerade in Paulus’ Rede vom Glauben macht sich das alttestamentlich-jüdische Erbe |23| geltend: Er schließt sich primär an den Sprachgebrauch der Septuaginta an, der griechischen Übersetzung des »Alten Testaments«, das in weiten Teilen des Urchristentums verwendet wurde. Zwischen dem hebräisch abgefassten Alten Testament und dessen griechischen Übersetzung besteht eine bemerkenswerte Kongruenz: »Die griechischen Wörter pistis und pisteuein sowie der ganze Stamm pist- entsprechen hier [sc. in der Septuaginta] mit ungewöhnlicher Konstanz Wörtern vom hebräischen und aramäischen Stamm ’mn, zu dem auch das bis in unsere liturgische Sprache reichende Amen gehört.«68 Die Grundbedeutung des Stammes ’mn wirkte über die griechische Übersetzung und durch sie hindurch auf den Sprachgebrauch des Neuen Testaments ein: »Glauben heißt im Hebräischen ›sich fest machen in Jahwe‹«69 und meint die »Betätigung der innerlichen Festigkeit durch Zuversicht und Vertrauen«70; wer glaubt, gewinnt eine »feste Beständigkeit«71.
Doch eine exklusive Herleitung aus dem Alten Testament im Sinne eines bruchlosen und kontinuierlichen Sich-Entfaltens wäre nicht zutreffend: Während das Gottesverhältnis dort mit einer Reihe weiterer Wörter bezeichnet wird, entwickelt sich der Glaube im frühen Christentum zur wesentlichen und umfassenden Bezeichnung für das Gottesverhältnis. Dieses analogielose Phänomen ist nicht zuletzt auf Paulus zurückzuführen, der an zentralen Argumentationsgängen im Römer- und Galaterbrief eine prominente alttestamentliche Belegstelle zum Glauben herausgreift – Gen 15,6 – und so mittels einer »Wesensbeschreibung des Glaubens Abrahams«72 zu einer fassbaren und äußerst wirkungsvollen Beschreibung seines Glaubensverständnisses gelangt. Doch spiegelt sich selbst im Rekurs auf die Gestalt des Abraham ein zweites charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zum alttestamentlich-jüdischen Umfeld wider: Glaube steht für Paulus nicht nur für die umfassende Bezeichnung der Gottesbeziehung, sondern ist zugleich unlösbar auf Jesus Christus bezogen: »Der Glaube ist, was er ist, weil es Christus gibt.«73 Von dieser Neubestimmung des Glaubens aus erklärt sich die eigenständige Weiterentwicklung des Glaubensbegriffs im frühen Christentum. Sie wird schon formal greifbar in der erstaunlichen Häufigkeit der Belege wie auch in neuartigen präpositionalen Konstruktionen wie »glauben an/in« oder in der Genitivverbindung »Christusglaube«, die durchweg in Bezug auf Christus Verwendung |24| finden.74 Daneben fällt die Selbstverständlichkeit auf, mit der Paulus vom Glauben spricht, scheinbar ohne sich zu einer näheren Definition oder Begriffsklärung genötigt zu fühlen. Man hat vermutet, dass die Wurzeln seines Sprachgebrauchs nach Antiochien weisen; in der dortigen hellenistisch-jüdisch geprägten Gemeinde seien die Grundlagen für das Verständnis und den kreativen Umgang mit dieser Terminologie vorhanden gewesen.75 Trifft diese Vermutung zu, ist zu erwarten, dass das kulturelle Milieu dieses »melting pot« sich ebenfalls auf das semantische Repertoire der Glaubensterminologie auswirkte, zusätzliche Nuancen eintrug und zur Beweglichkeit und Polyphonie der Rede vom Glauben bei Paulus beisteuerte.
Damit eröffnet sich ein weiterer Problemkreis, der zu einer beachtenswerten wissenschaftlichen Debatte führte: Wie wurde der Stamm pist- in der pagan-griechischen Sprachwelt außerhalb des Judentums verwendet? Gibt es Texte aus vorchristlicher Zeit, die unbeeinflusst von jüdischem Denken das Gottesverhältnis mit diesem Wortfeld umschreiben? Falls ja: Findet dieser Sprachgebrauch einen Widerhall in den neutestamentlichen Schriften, in den Briefen des Paulus? Lange Zeit war Richard Reitzensteins Urteil unangefochten, dass pistis ein »Schlagwort der Propaganda treibenden Religionen« war und das Christentum darum sowohl an jüdische wie pagane Missionstätigkeit und Propaganda anknüpfen konnte.76 Gestützt hat Reitzenstein seine Behauptung durch »ein paar rasch zusammengeraffte Beispiele«77. Dieser zunächst spärlich belegten, aber fast schon kanonisch gewordenen These der Religionsgeschichtlichen Schule hat seit den 1970er Jahren Dieter Lührmann in einer Reihe von Veröffentlichungen vehement widersprochen. »Glaube« sei nicht im allgemeinen religiösen Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu finden und keinesfalls eine verbreitete Kategorie der Religionsphänomenologie im Umfeld der frühen Christenheit. In der nichtjüdischen hellenistischen Literatur gebe es keinen religiösen Gebrauch des Stammes pist-, und die zum Beleg der genannten religionsgeschichtlichen These angeführten Verweisstellen seien – sofern sie überhaupt vom »Glauben« redeten – allesamt beeinflusst von der jüdisch-christlichen Sprachtradition. Pistis und pisteuein sind für Lührmann also Worthüllen, die ihre inhaltliche Füllung ausschließlich |25| dem Hebräischen zu verdanken haben, sprachgeschichtlich vermittelt v. a. durch Jesus Sirach und Philo. Sie seien also schlicht »Bedeutungslehnwörter«78 und zudem »Begriffe des internen Sprachgebrauchs«79, die »in der Sprache der Mission […], im Judentum wie im Christentum« nicht angesiedelt seien.80
Nachdem Lührmanns Gegenentwurf zunächst zustimmend aufgenommen worden war,81 konnte er sich in der Folgezeit aufgrund von neu beigebrachten Belegen aus dem hellenistischen Schrifttum nicht mehr in der vorgetragenen Zuspitzung halten.82 Religiöser Gebrauch von pistis war auch im nichtjüdischen Hellenismus verbreitet und geläufig83 und nicht auf eine interne jüdisch-christliche Verwendung beschränkt. Insbesondere Plutarch (ca. 45–125 n. Chr.), Zeitgenosse des Paulus, Philosoph und zeitweilig Priester am Apollotempel in Delphi kann als Zeuge dafür gelten, wie facetten- und beziehungsreich damals vom Glauben in einem religiösen Sinn gesprochen wurde und welche Bedeutung er für das Verständnis religiösen Lebens annehmen konnte. »Das Frühchristentum gebrauchte auch hier eine Sprache, die der heidnische Hörer verstehen konnte.«84
Als Ertrag dieser Debatte kann festgehalten werden, dass einseitige Zuschreibungen und Kontextualisierungen nicht angemessen sind; die primäre und inhaltlich prägende sprachliche Verwurzelung der Glaubensterminologie ist im Judentum zu suchen, eine sekundäre in der pagan-hellenistischen Sprachwelt. Neuerdings wird noch ein dritter Kontext zur Erhellung der paulinischen Rede vom Glauben herangezogen, »einer, der, über den Aspekt rein sprach- und traditionsgeschichtlicher Einflüsse hinausgehend, die Dimension soziokultureller Konventionen sowie politischer Machtstrukturen und Interessen mit ins Kalkül zieht« – nämlich der Kontext der imperialen römischen Kultur.85 »Angesichts der enormen Bedeutung der fides in der römischen Politik, Kultur und Gesellschaft« votiert beispielsweise Christian Strecker dafür, »sie als wichtigen Kontext bzw. Verstehenshorizont der pistis-Aussagen |26| des im Imperium Romanum wirkenden Paulus mit zu berücksichtigen«.86 Er geht davon aus, dass Bedeutungsmomente der römischen fides umfassend auf die griechische pistis übertragen wurden und dass die häufig behauptete Unvereinbarkeit zwischen beiden Konzepten nicht aufrechterhalten werden kann.
Welche inhaltlichen und sprachlich-formalen Linien nun sowohl aus den jüdischen wie auch aus nichtjüdischen griechischen, hellenistischen und römischen Texten und Vorstellungen zur Glaubensterminologie des Paulus zu ziehen sind, soll in den einzelnen Kapiteln unter der Überschrift »Verstehenshorizont« exemplarisch erörtert werden. Die Art und Weise, wie Paulus vom Glauben spricht, scheint dabei eine gewisse Einseitigkeit der These zu relativieren, derzufolge alles, was »an bleibenden ›paganen Einflüssen‹ im frühen Urchristentum vermutet wurde, […] durchweg auf jüdische Vermittlung zurückgehen« kann.87 Vielmehr haben die ersten Christen sprachliche und kulturelle Gräben auch dadurch überbrückt, dass sie in ihrem missionarischen und didaktischen Wirken direkt auf das zeitgenössische kulturelle und semantische Repertoire zurückgegriffen, es kreativ weiterentwickelt und adressatenspezifisch angewandt haben – auch und gerade im Blick auf den Glauben. Bei allem Verbindenden bleibt jedoch ein »eklatantes ›Mehr‹« des frühchristlichen Redens vom Glauben, das weder aus dem Judentum noch aus dem Hellenismus noch aus der römischen Herrschaftsideologie abgeleitet werden kann.88
Читать дальше