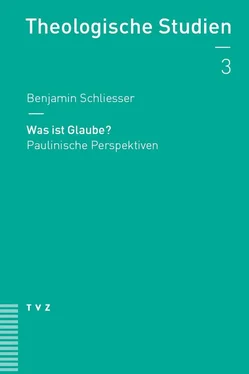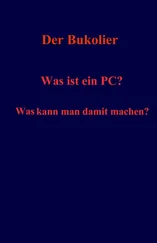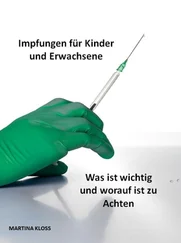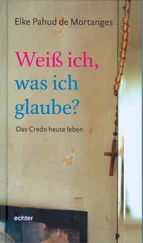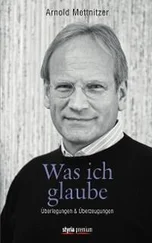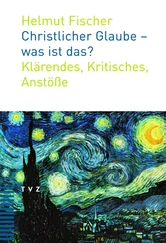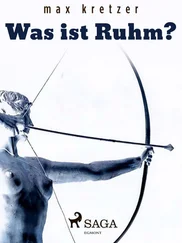Diesem Missverständnis kann man begegnen, indem man den Glauben vom »Standpunkt des Glaubens« und damit vom Christusgeschehen her denkt. Aus einer solchen Betrachtungsweise sind dezidiert theologische Aussagen zu erwarten wie: »Der Glaube hat keine Geschichte, wohl aber bestimmt er Geschichte.«42 |19| Oder in den drastischen Worten Johann Georg Hamanns: »Glaube ist nicht jedermanns Ding, und auch nicht communicable wie eine Ware, sondern das Himmelreich und die Hölle in uns.«43 Dieser Ansatz birgt die Gefahr, den Glauben der Wirklichkeit und der Welt zu entheben und ihn abzukoppeln von erkenntnistheoretischen, hermeneutischen oder humanwissenschaftlichen Annäherungen. Das Gespräch über den Glauben wird so zum Binnendiskurs aus der Theologie für die Theologie und geht Gesprächspartnern aus anderen Diskursen verlustig.
Es kann nicht sinnvoll sein, die Betrachtung des Glaubens auf einen der beiden Standpunkte zu reduzieren. Der Glaube ist eine anthropologische Kategorie, geht in dieser Bestimmung aber keineswegs auf. Er ist nicht jenseits von allgemein-menschlichen Konstanten zu beschreiben, aber zugleich markiert er einen qualitativen Sprung, der wie im Fall des Paulus zu einer »rigorosen Umwertung aller bisherigen Werte und Ideale (Phil 3,7–11)« führen kann.44 Es wird sich zeigen, dass auch Paulus in seiner Rede vom Glauben immer zugleich vom Menschen und von Gott her denkt.
Bultmanns existentiale Interpretation richtet sich ganz auf das gläubige Subjekt und räumt der Welt- und Heilsgeschichte lediglich eine Randstellung ein: »Die entscheidende Geschichte ist nicht die Weltgeschichte, die Geschichte Israels und der anderen Völker, sondern die Geschichte, die jeder Einzelne selbst erfährt.«45 Damit ist aber, was die pistis angeht, »eine radikale Individualisierung gesetzt: Die Botschaft trifft den Einzelnen und isoliert ihn.« »Der Glaube führt in die Vereinzelung.«46 Diese Linie kann bis in die autobiographischen »Bekenntnisse« Augustins zurückverfolgt werden, welcher Gott preist für »meinen Glauben, den du mir gegeben hast«.47 Im Gegensatz dazu stehen beispielsweise die Erwägungen Karl Barths zum Individualismus eines solchen »Ich-Glaubens.« Er kritisiert, »dass der Christ in den letzten Jahrhunderten (auf dem weiten Weg vom alten Pietismus bis hin zu dem an Kierkegaard sich inspirierenden theologischen Existentialismus der Gegenwart) begonnen hat, sich selbst in einer Weise ernst zu nehmen, die dem Ernst des Christentums durchaus nicht angemessen ist«.48 Schon früh zeichnete sich der Dissens zwischen Bultmann und Barth in dieser Frage ab. In seinem Römerbriefkommentar schreibt Barth: »Nirgends ist er [sc. der |20| Glaube] identisch mit der historischen und psychologischen Anschaulichkeit des religiösen Erlebnisses. Nirgends reiht er sich ein in die kontinuierliche Entwicklung menschlichen Seins, Habens und Tuns.«49 Bultmann entgegnet, dass Barth die Paradoxie des Glaubens überspanne: »Ist der Glaube, wenn er von jedem seelischen Vorgang geschieden, wenn er jenseits des Bewusstseins ist, überhaupt noch etwas Wirkliches? Ist nicht das ganze Reden von diesem Glauben eine Spekulation, und zwar eine absurde? Was soll das Reden von meinem ›Ich‹, das nie mein Ich ist? Was soll dieser Glaube, von dem ich höchstens glauben kann, dass ich ihn habe?«50
Ein erster exegetischer Ansatz, diesen scheinbar unvereinbaren Positionen zu begegnen, liegt darin, den Blick auf einige sprachliche Besonderheiten in Paulus’ Rede vom Glauben zu lenken. Ernst Lohmeyer stellt zu Recht fest, dass »ein merkwürdiger Sprachgebrauch […] die paulinischen Gedanken über den Glauben« kennzeichnet.51 Zunächst sticht die Dominanz des Substantivs »Glaube« gegenüber dem Verb »glauben« heraus. Sodann fällt auf, dass das Nomen »Glaube« meist absolut bzw. in Verbindung mit »Christus« steht und recht selten mit Possessivpronomen erscheint: »sein Glaube« findet sich nur in Bezug auf Abraham (Röm 4,5.12.16), einmal äußert Paulus den Wunsch, »in eurer Mitte gemeinsam mit euch ermutigt zu werden durch unseren gemeinsamen Glauben, den euren wie den meinen« (Röm 1,12), und an einer weiteren Stelle erwähnt er den Glauben, den Philemon hat (»dein Glaube«, Phlm 5–6); häufiger verweist Paulus auf »unseren Glauben«. Was das Verb angeht, sagt Paulus an keiner Stelle »ich glaube«.52 In all dem drückt sich eine Tendenz aus, den Glauben nicht zu beschränken auf eine individuelle »Tat und Gesinnung des Herzens«53. Gleichwohl ist das »Ich« des Glaubens deutlich im Blick, und zwar vor allem dort, wo Paulus den Einzelnen in die Gemeinschaft der »Glaubenden«54 stellt und sich selbst in diese Gemeinschaft einreiht (»unser Glaube«55, »wir glauben« bzw. »wir kamen zum Glauben«56). |21| Ferner ist zu denken an die Wendungen »jeder, der glaubt«57 bzw. »alle, die glauben«58 und »der, der aus Glauben ist«59 bzw. »die, die aus Glauben sind«60.
Schon allein der Sprachgebrauch macht deutlich, dass keine Rede sein kann von einer »isolierenden« Auffassung des Glaubens bei Paulus. Ebenso wenig bleibt der Glaube auf ein paradoxes »Ich glaube, dass ich glaube« reduziert. Vielmehr vereint der paulinische Glaubensbegriff drei grundlegende Perspektiven: Er ist vom Einzelnen zu vollziehender Lebensakt (subjektiv), Identität stiftendes Kennzeichen einer Gemeinschaft (intersubjektiv bzw. ekklesiologisch) und in seiner Verbindung zum Christusereignis heilsgeschichtliches Phänomen (transsubjektiv). Diese drei Dimensionen teilt sich sein Glaubensbegriff mit seinem Versöhnungsgedanken (vgl. nur Röm 8,18–25; 11,15; 2Kor 5,19)61 und seiner Rechtfertigungslehre (vgl. nur Röm 1,17; 3,21).62
Die Rubrik »Verstehenshorizont« trägt wichtigen Einsichten der kognitiven Semantik Rechnung, derzufolge nicht nur der unmittelbare literarische Kontext für die Bedeutung von Worten ausschlaggebend ist, sondern auch das sogenannte enzyklopädische Wissen, das durch Erfahrung und Lernen angeeignet wird und das Autor und Rezipienten (vermeintlich) teilen. Die Rede vom »Glauben« evoziert ein Geflecht von Vorstellungen, Bildern und Eindrücken, die eingebettet sind in ein spezifisches kulturelles Milieu und die dem Wort »Glaube« Bedeutung verleihen. Einem Text ist immer eine intertextuelle Qualität eigen, die der Autor eingeschränkt steuern kann, und er setzt umgekehrt eine intertextuelle Kompetenz seitens der Rezipienten voraus: »Kein einziger Text wird unabhängig von den Erfahrungen gelesen, die aus anderen Texten gewonnen wurden.«63 Dadurch wird die »Aktivität der Mitarbeit« gefordert, »durch die der Empfänger dazu veranlasst wird, einem Text das zu entnehmen, was dieser nicht sagt (aber voraussetzt, anspricht, beinhaltet und miteinbezieht), und dabei Leerräume aufzufüllen und das, was sich im Text befindet, mit dem intertextuellen Gewebe zu verknüpfen, aus |22| dem der Text entstanden ist und mit dem er sich wieder verbinden wird«.64 Solche Mitarbeit ist abhängig von einer überkulturellen Kernbedeutung eines Begriffs, vom sozialen und kulturellen Kontext sowie vom Bildungs- und Wissensstand und den Erfahrungen und Erwartungen der Rezipienten.
Paulus’ Rede vom Glauben ist eingebunden in ein »intertextuelles Gewebe«, und zunächst gilt für seinen Glaubensbegriff, was für alle zentralen Begriffe des paulinischen Denkens zutrifft: Sie haben »eine jüdische und eine griechische Geschichte, die es gleichermaßen zu erheben und zu berücksichtigen gilt«.65 Neben der Betrachtung der pagan-griechischen und alttestamentlich-jüdischen Geschichte des Glaubens bei Paulus ist auch eine Unterscheidung zu treffen zwischen seinen eigenen Sprachvoraussetzungen einerseits und dem Verstehenshorizont des Glaubensbegriffs bei seinen Adressaten andererseits. In welcher Vorstellungs- und Denkwelt gründet sein eigenes Denken und Reden vom Glauben und welche Assoziationen ergaben sich bei den Rezipienten seiner Briefe? Kommunikation wird dann als gelungen erlebt, wenn beide Akteure, Autor und Rezipient, einen gemeinsamen »geistigen Raum« finden, in dem sich Verständigung und Einverständnis ereignen; dabei ist neben individuellen Bewusstseinsstrukturen und kulturellen Prägungen auch die Sozialität der Akteure relevant, wenn Kommunikation nicht auf einen einzelnen Akt beschränkt bleibt, sondern Interaktion stattfindet. Paulus tauchte auf seinen Missionsreisen in verschiedene Sprach- und Kulturmilieus ein, trat intensiv in persönliche und schriftliche Kommunikationssituationen, ging schöpferisch mit dem kulturellen Repertoire seiner Adressaten um und verstand es, seine eigene kulturelle und geistige Prägung zu kontextualisieren. Nur durch eine auf solche Art praktizierte Inkulturation des Evangeliums bei zugleich reflektierter Adaption anderer Traditionen erreichte seine »Glaubensbotschaft« eine derart hohe Anschlussfähigkeit.
Читать дальше