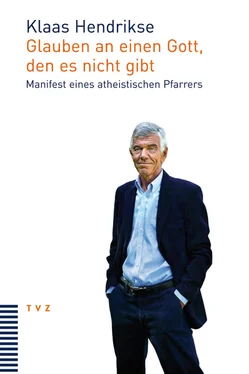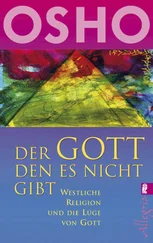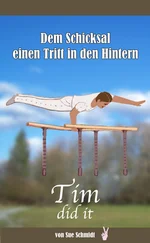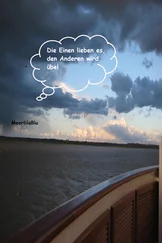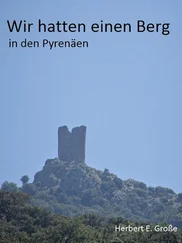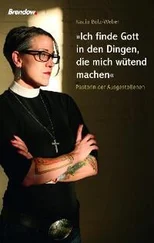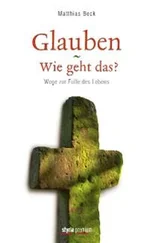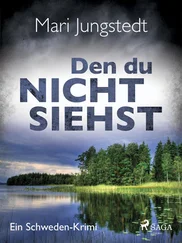Dass es Gott nicht gibt, ist für einen Pfarrer eine gefährliche Aussage. Darum schreibe ich dieses Buch jetzt und nicht erst – wie ich ursprünglich dachte – nach meiner Pensionierung.3 Ich will hinterher nicht sagen hören, ich hätte gut reden, da man mich ja nicht mehr aus dem Kirchendienst ausschliessen könne.
Natürlich hoffe ich, dass sich viele Pfarrer und Gläubige nach der Lektüre dieses Buches zum Atheismus bekehren, und andersherum (obwohl ich mir in dieser Richtung weniger Illusionen mache), dass viele Atheisten anfangen, an Gott zu glauben, und dass wenigstens einige von ihnen Pfarrer werden. Der Schritt erscheint wechselseitig grösser als er in Wirklichkeit ist, denn Pfarrern und Atheisten ist eines gemeinsam: Sie wissen nicht, wer oder was Gott ist, und haben, wenn sie das zugeben, keine Existenzberechtigung mehr.
Dieses Buch wurde mit einem gewissen Schmunzeln geschrieben. Als einer, der mit Leib und Seele Pfarrer und Atheist ist, habe ich mich frei gefühlt, sowohl den Pfarrer als auch den Atheisten aufs Korn zu nehmen, und dies – ehrlich gesagt – mit Vergnügen. Ich hoffe, der Leser, die Leserin habe ebenso viel Spass daran und lerne vielleicht auch etwas dabei.
Ein spannendes Buch wird es nicht werden, denn das Ergebnis steht ja bereits fest: Ein Pfarrer kann Atheist sein und umgekehrt. Und wenn ich der Einzige wäre: Ich bin so einer – vielleicht eher ein atheistischer Prediger als ein predigender Atheist – aber immerhin!
Der Leser, den ich beim Schreiben stets vor Augen hatte, ist sich nicht so sicher. Er zweifelt oder glaubt überhaupt nicht (mehr) daran, dass es Gott gibt, und fragt sich, welchen Sinn es hat zu glauben, wenn es Gott nicht gibt. (Mancherlei Sinn, sage ich mal vorläufig.)
Innerhalb der Kirche sehe ich ihn als einen, der Woche für Woche erfährt, wie gross der Unterschied ist zwischen seinem eigenen Glaubensempfinden und der Selbstverständlichkeit, mit der die Kirche jedem, der sich fragt, ob es Gott gibt, den Mund stopft. Für ihn versteht sich das eben nicht mehr von selbst, und darin fühlt er sich nicht ernstgenommen; seine Fragen werden nicht beachtet oder umgangen.
Ausserhalb der Kirche sehe ich ihn als einen, der mit den Jahren der Kirche enttäuscht den Rücken gekehrt hat, jedoch nicht ungläubig geworden ist. Er hat bloss die Antworten hinter sich gelassen, die Fragen aber mitgenommen. Vielleicht versteht er sich selbst als «Etwasist»4, glaubt er doch, dass es «etwas» gibt, das er aber nicht Gott nennt, weil er inzwischen allergisch reagiert auf das, was in den Kirchen unter diesem Wort verstanden wird.
Ausserhalb der Kirche sehe ich ihn auch als einen, der sich auf dem Markt der Religionen und Sinngebungen herumtreibt und versucht, sich sein eigenes «Glaubens-Paket» zusammenzustellen. Er möchte offen sein für etwas, was die alltägliche Oberflächlichkeit übersteigt, er ist unbefangen und vorurteilslos gegenüber dem Wort «Gott», in der Überzeugung, dass mit diesem Wort jeweils das gemeint sei, was er gerade sucht. Und ich sehe ihn überall suchen ausser in der Kirche, denn er weiss, dass er in einer Institution, die auf aktuelle Fragen mittelalterliche Antworten gibt, nichts finden wird.
Ich fühle mich als Bundesgenosse des zweifelnden Lesers, der ringt mit überholten Gottesvorstellungen, der sich verabschieden möchte von dem, was die Kirchen von Gott behaupten, aber nicht von seinem Glauben. Ich stehe auf der Seite derer, die in Nebel gehüllt werden von Theologen, die so tun, als ob es Gott gäbe oder – schlimmer noch – die Frage, ob es Gott gibt, als überholt oder irrelevant betrachten. Ich fühle mich verwandt mit jenen Sinnsuchern, die davon ausgehen, dass es etwas gibt, das mehr ist als das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können, die aber um das Wort «Gott» einen Bogen machen, solange es nicht vom kirchlichen Ballast befreit ist.
Dieses Buch ist ein Buch für ganz normale Menschen.
Diese Bemerkung soll auch als Kritik verstanden werden: Ich habe für die Arbeit an diesem Buch eine Menge Bücher in Händen gehabt und durchgeackert; sie waren nahezu ausnahmslos unlesbar für Nichttheologen. Das darf doch nicht so sein, denn wenn Gott je eine Absicht verfolgt haben sollte (was ich nicht glaube), dann gewiss nicht die, der Menschheit Rätsel aufzugeben, die nur von Theologen gelöst werden können.
Kein schwieriges Buch also. Für Liebhaber habe ich im Anhang eine Liste von «absichtlich vermiedenen» Fachausdrücken angefügt.
Um an Gott glauben zu können, ist Jesus an sich nicht nötig. Ich betrachte das Christentum als ein Gleis (neben anderen), auf das wir als Westeuropäer mehr oder weniger zufällig gestellt sind. Auf diesem Gleis zu stehen, verleugne ich nicht, ich relativiere es aber. Die kirchliche Fixierung auf Jesus betrachte ich als Irrtum, Jesus selbst war kein Christ. Ich bewundere ihn als einen besonderen Menschen, der auf seine Weise gezeigt und gelebt hat, was Gott ist, so wie es andere vor und nach ihm taten und noch immer tun. Ich hänge mehr an biblischer als an kirchlicher Überlieferung. Weil ich zufällig in den Niederlanden und nicht in Thailand geboren wurde, bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, ein buddhistischer Mönch zu werden, sondern bin nun eben Pfarrer in einer protestantischen Kirche und sehe in der Bibel meine bevorzugte religiöse Inspirationsquelle.
Was es nicht gibt, ist weder ein «er» noch eine «sie» noch ein «es». Wenn ich mit «er» auf Gott verweise, dann bloss, um gelegentlich nicht dreimal im gleichen Satz «Gott» sagen zu müssen. Auch wenn ich mich auf den Menschen beziehe, sage ich meistens «er». Ich hoffe, dass «sie» dafür Verständnis hat.
Eine Entschuldigung im Voraus
Was einst notierte Lesefrüchte waren, ist im Lauf der Jahre in meine eigene Ausdrucksweise eingegangen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass da jemandem etwas entgegenkommt, was von ihm stammt, ohne dass er als Quelle genannt wird; er möge es als Kompliment nehmen.
Ich glaube nicht, dass es Gott gibt; ich glaube aber an Gott.
Dass es Gott nicht gibt, ist für mich kein Hindernis, sondern eine Voraussetzung für den Glauben an Gott. Ich bin ein gläubiger Atheist.
Im 1. Kapitel gehe ich näher auf den Begriff «Atheismus» ein, versuche die nebulösen Vorstellungen von «Existenz» etwas zu klären, wobei ich mich auch ziemlich ereifere über Kollegen, die behaupten, die Existenz Gottes spiele gar keine Rolle. Mit der Bibel in der Hand sage ich mit den Atheisten: Gott gibt es nicht, und wende ich mich zugleich gegen die Kirche, indem ich behaupte, dass, was sie «Gott» nennt, auf einem historischen Missverständnis beruht: Diesen Gott hat es nie gegeben. Die Tatsache, dass sich der Glaube an einen allmächtigen Gott auf ein wackeliges biblisches Fundament stützt, war bis gegen Ende des Mittelalters ein von der Kirche wohlgehütetes Geheimnis. Mit dem Aufkommen der Wissenschaften wurde er immer unhaltbarer. Heutzutage ist ein solcher Glaube meines Erachtens der Katalysator der Entkirchlichung: Wenn sich die Leute nicht mehr ernstgenommen fühlen, laufen sie der Kirche davon.
Im 2. Kapitel geht es um das, was «glauben» heisst. Das hat mehr mit dem Leben als mit der Religion zu tun. Die ursprüngliche Bedeutung von «glauben» ist «vertrauen». Man vertraut, genauso wie man lebt: aufgrund von Erfahrungen, die man gemacht hat. Gott kann das Wort sein, mit dem man eine Erfahrung bezeichnet, muss es aber nicht. Mit der Bibel bezeichne ich Gott als «das, was Menschen, die unterwegs sind, begleitet». Darum sage ich nicht, dass es Gott «gibt», sondern dass er sich ereignet oder sich ereignen kann. Dazu braucht es Menschen, ohne Menschen ist Gott nirgends.
Читать дальше